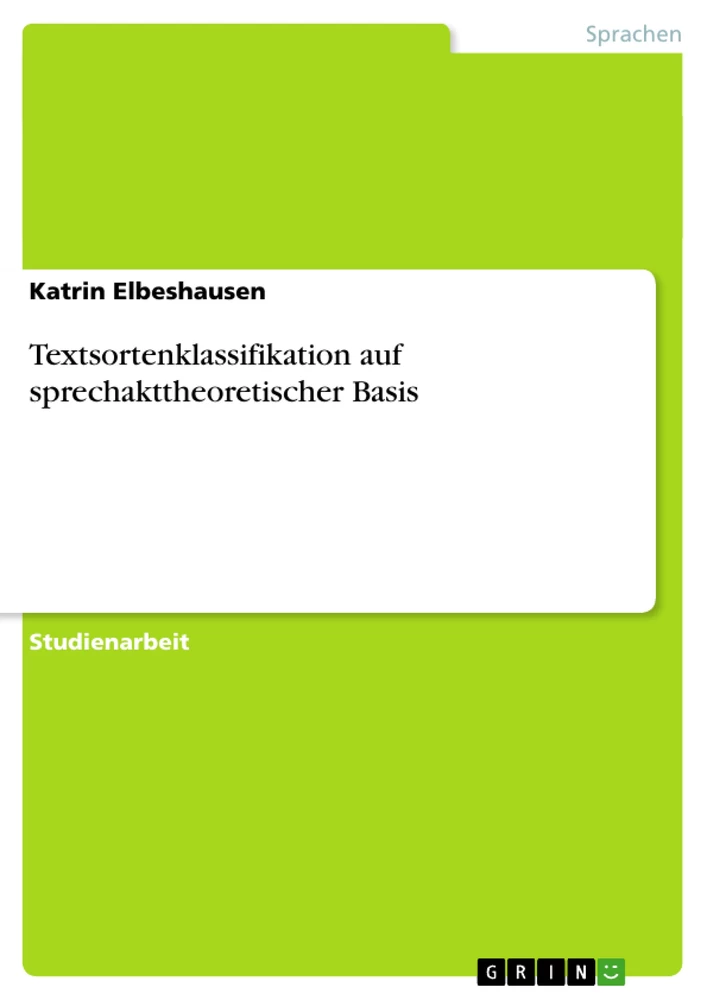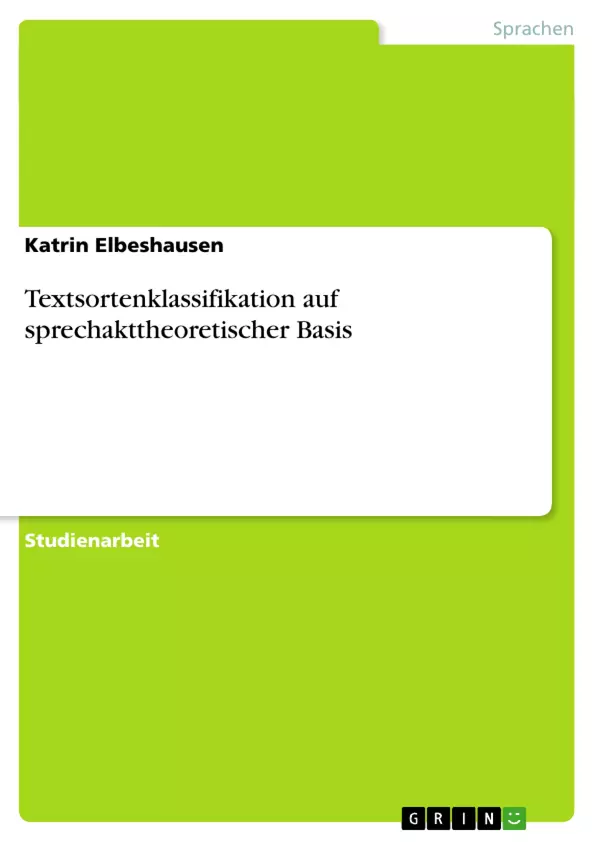Es wurden schon viele Versuche unternommen, Texte als grundlegende Einheiten zur linguistischen Betrachtung in ihren so variablen und individuellen Erscheinungsformen voneinander abzugrenzen und Klassen zu bilden. Hierbei stehen zum Teil sehr unterschiedliche Kriterien für die Analyse im Vordergrund. Eine mögliche Ausrichtung ist die funktionale Texttypologie, welche in unterschiedlichen Zwecken der Entstehung und Einsetzung von Texten ein wesentliches Differenzierungskriterium zur Klassenbildung sieht.
In dieser Arbeit soll nun ein verhältnismäßig neues funktionales Klassifikationsmodell von Textsorten dargestellt, erläutert und diskutiert werden. Es handelt sich um die Theorie Eckard Rolfs von 1993, in welcher Textsorten auf Basis der Sprechakttheorie klassifiziert werden. Untersuchungsgegenstand sind hierbei ausschließlich Gebrauchstextsorten beziehungsweise alltagssprachliche Textsorten. Diese sind grundlegend monologisch, das heißt es wird zum Beispiel auch das Gespräch, als dialogische Textform, ausgeschlossen. Die insgesamt ca. 2100 Gebrauchstextsortenbezeichnungen entnimmt Rolf dem Dudenwörterbuch. Seine Typologie befasst sich in erster Linie mit textexternen Differenzierungskriterien.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Sprechakttheorie nach John R. Searle
- 3. Das Textklassifikationskonzept E. Rolfs
- 4. Eine Diskussion des Klassifikationskonzeptes von E. Rolf
- 4.1 Zu den Erfolgs- und Erfüllungsbedingungen
- 4.2 Die Sprechakte als Klassifikationskriterium
- 4.2.1 Assertive Textsorten
- 4.2.2 Direktive Textsorten
- 4.2.3 Kommissive Textsorten
- 4.2.4 Expressive Textsorten
- 5. Zu den Anforderungen an eine Texttypologie nach H. Isenberg
- 6. Linguistische Modelle der Textsortenklassifikation
- 7. Zur Frage der (Un-)Eindeutigkeit von Textklassenzuordnungen
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das funktionale Klassifikationsmodell von Eckard Rolfs (1993) zur Textsortenklassifizierung auf Basis der Sprechakttheorie. Ziel ist die Darstellung, Erläuterung und Diskussion dieses Modells, welches sich auf alltagssprachliche, monologische Gebrauchstextsorten konzentriert. Die Arbeit beleuchtet Rolfs' Kriterien für die Klassenbildung und vergleicht sie mit anderen Ansätzen, insbesondere dem von Horst Isenberg.
- Die Sprechakttheorie als Grundlage für die Textsortenklassifikation
- Analyse von Rolfs' Klassifikationskriterien und -bedingungen
- Vergleich mit den Anforderungen an eine Texttypologie nach Isenberg
- Bewertung der Eindeutigkeit von Textklassenzuordnungen
- Gesamtbeurteilung von Rolfs' Klassifikationskonzept
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Textsortenklassifikation ein und stellt verschiedene Kriterien für die Analyse vor. Sie hebt die Besonderheiten schriftlicher Texte im Vergleich zu gesprochenen hervor und betont die Schwierigkeit der eindeutigen Klassifizierung. Die Arbeit fokussiert auf das funktionale Klassifikationsmodell von Eckard Rolfs (1993), welches Gebrauchstextsorten auf Basis der Sprechakttheorie klassifiziert. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die zu behandelnden Fragen.
2. Die Sprechakttheorie nach John R. Searle: Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in die Sprechakttheorie nach John L. Austin und John R. Searle. Es beschreibt die fünf von Searle entwickelten Klassen von Sprechakten: Assertive, Direktive, Kommissive, Expressive und Deklarationen. Für jede Klasse werden charakteristische Merkmale und Beispiele genannt. Das Verständnis dieser Sprechaktsklassen bildet die Grundlage für die spätere Diskussion von Rolfs' Modell.
3. Das Textklassifikationskonzept E. Rolfs: Kapitel drei präsentiert die Grundidee von Rolfs' Textklassifikationskonzept. Es beschreibt den Ansatz, Gebrauchstextsorten anhand der Sprechakttheorie zu klassifizieren. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der textexternen Differenzierungskriterien, die Rolf verwendet, um die ca. 2100 im Dudenwörterbuch erfassten Gebrauchstextsorten zu kategorisieren. Das Kapitel legt die Basis für die anschließende kritische Auseinandersetzung mit Rolfs' Ansatz.
4. Eine Diskussion des Klassifikationskonzeptes von E. Rolf: Dieses Kapitel analysiert Rolfs' Modell detailliert. Es untersucht die Erfolgs- und Erfüllungsbedingungen der Klassifikation und die Verwendung von Sprechakten als Klassifikationskriterium, differenziert nach assertiven, direktiven, kommissiven und expressiven Textsorten. Die Diskussion beleuchtet die Stärken und Schwächen des Modells und bereitet den Weg zum Vergleich mit anderen Ansätzen.
5. Zu den Anforderungen an eine Texttypologie nach H. Isenberg: Kapitel fünf befasst sich mit den allgemeinen Anforderungen an eine Texttypologie nach Horst Isenberg. Es dient als Vergleichsmaßstab für die Beurteilung von Rolfs' Modell. Die Übereinstimmung oder Abweichung von Rolfs' Konzept von Isenbergs Kriterien wird untersucht, um die Gültigkeit und Reichweite des Modells zu bewerten.
6. Linguistische Modelle der Textsortenklassifikation: In diesem Kapitel werden verschiedene, meist ältere linguistische Modelle der Textsortenklassifikation vorgestellt und mit Rolfs' Ansatz verglichen. Dieser Vergleich soll weitere Stärken und Schwächen des von Rolf entwickelten Modells aufzeigen und dessen Position innerhalb des Forschungsfeldes der Textsortenklassifikation einordnen.
7. Zur Frage der (Un-)Eindeutigkeit von Textklassenzuordnungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Frage der eindeutigen Zuordnung von Texten zu bestimmten Klassen. Es diskutiert die Möglichkeit von Doppel- oder Mehrfachzuordnungen und analysiert die Konsequenzen für die Anwendbarkeit und Praktikabilität von Rolfs' Klassifikationsmodell. Verschiedene Positionen zu diesem Thema werden verglichen und bewertet.
Schlüsselwörter
Textsortenklassifikation, Sprechakttheorie, Searle, Rolf, Isenberg, Gebrauchstextsorten, Assertive, Direktive, Kommissive, Expressive, Texttypologie, Monosemierung, Eindeutigkeit von Textklassenzuordnungen.
Häufig gestellte Fragen zur Textsortenklassifikation nach Eckard Rolf
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert und diskutiert das funktionale Klassifikationsmodell von Eckard Rolfs (1993) zur Textsortenklassifizierung. Der Fokus liegt auf alltagssprachlichen, monologischen Gebrauchstextsorten und untersucht die Anwendung der Sprechakttheorie auf die Klassifizierung dieser Textsorten.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Rolfs' Modell darzustellen, zu erläutern und kritisch zu diskutieren. Sie vergleicht Rolfs' Kriterien für die Klassenbildung mit anderen Ansätzen, insbesondere dem von Horst Isenberg, und bewertet die Eindeutigkeit von Textklassenzuordnungen innerhalb des Modells.
Welche Hauptthemen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Sprechakttheorie als Grundlage für die Textsortenklassifikation, die Analyse von Rolfs' Klassifikationskriterien und -bedingungen, einen Vergleich mit Isenbergs Anforderungen an eine Texttypologie, die Bewertung der Eindeutigkeit von Textklassenzuordnungen und eine Gesamtbeurteilung von Rolfs' Konzept.
Welche Sprechakttheorie wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Sprechakttheorie von John L. Austin und John R. Searle. Insbesondere werden Searles fünf Sprechaktsklassen (Assertive, Direktive, Kommissive, Expressive und Deklarationen) erläutert und in Bezug auf Rolfs' Modell analysiert.
Wie klassifiziert Rolfs Gebrauchstextsorten?
Rolfs klassifiziert Gebrauchstextsorten anhand der Sprechakttheorie. Seine Klassifikation basiert auf textexternen Differenzierungskriterien und umfasst ca. 2100 im Dudenwörterbuch erfasste Textsorten.
Wie wird Rolfs' Modell kritisch diskutiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die Erfolgs- und Erfüllungsbedingungen von Rolfs' Klassifikation und die Verwendung von Sprechakten als Klassifikationskriterium. Sie untersucht die Stärken und Schwächen des Modells und vergleicht es mit anderen Ansätzen, insbesondere mit Isenbergs Anforderungen an eine Texttypologie.
Welche Rolle spielt Horst Isenberg?
Isenbergs Anforderungen an eine Texttypologie dienen als Vergleichsmaßstab für die Beurteilung von Rolfs' Modell. Die Übereinstimmung oder Abweichung von Rolfs' Konzept mit Isenbergs Kriterien wird untersucht, um die Gültigkeit und Reichweite von Rolfs' Modell zu bewerten.
Wie wird die Eindeutigkeit von Textklassenzuordnungen behandelt?
Die Arbeit widmet sich der Frage der eindeutigen Zuordnung von Texten zu bestimmten Klassen. Sie diskutiert die Möglichkeit von Doppel- oder Mehrfachzuordnungen und analysiert die Konsequenzen für die Anwendbarkeit und Praktikabilität von Rolfs' Modell.
Welche weiteren linguistischen Modelle werden betrachtet?
Die Arbeit stellt verschiedene, meist ältere linguistische Modelle der Textsortenklassifikation vor und vergleicht sie mit Rolfs' Ansatz, um dessen Position innerhalb des Forschungsfeldes einzuordnen und weitere Stärken und Schwächen aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Textsortenklassifikation, Sprechakttheorie, Searle, Rolf, Isenberg, Gebrauchstextsorten, Assertive, Direktive, Kommissive, Expressive, Texttypologie, Monosemierung, Eindeutigkeit von Textklassenzuordnungen.
- Quote paper
- Katrin Elbeshausen (Author), 2006, Textsortenklassifikation auf sprechakttheoretischer Basis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78757