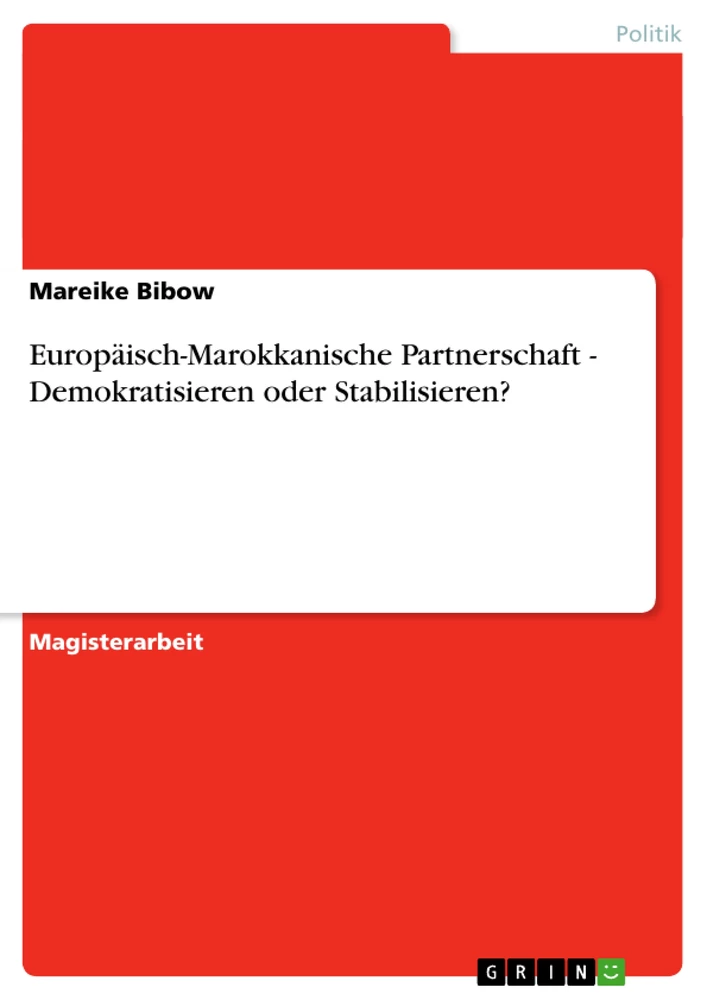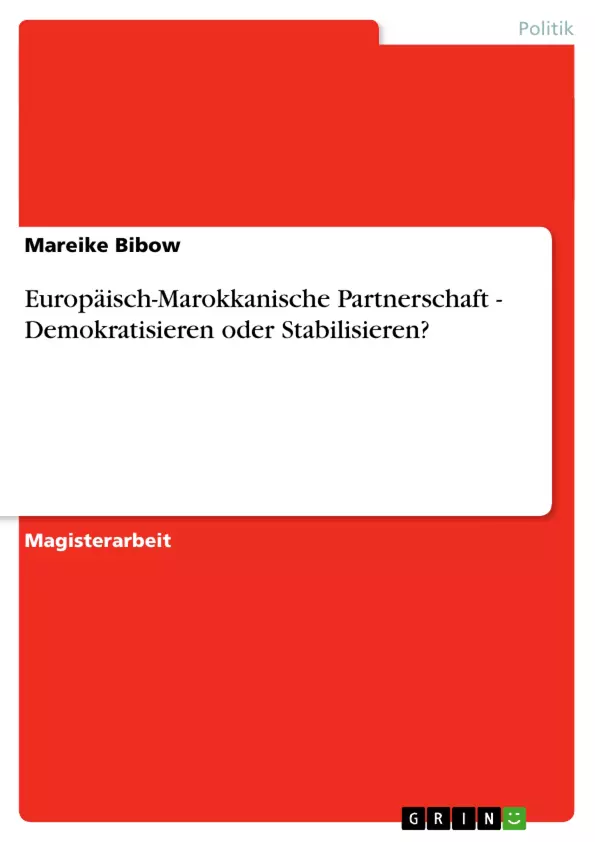Diese Arbeit hat zwei zentrale Thesen der aktuellen Debatte um den Barcelona-Prozess aufgegriffen und anhand der neuen liberalen Theorie überprüft. Die häufig beklagte Asymmetrie in der EMP wurde in dieser Arbeit nicht bestätigt. Im Gegenteil charakterisieren eine mangelnde Asymmetrie und eine starke Interdependenz zwischen der EU und Marokko die Beziehungen. Diese Erkenntnis, die auf dem Interdependenz-Ansatz von Keohane/Nye basiert, vermag ebenso zu erklären, warum die EU Demokratisierung als Ziel proklamiert, aber kaum Demokratisierungserfolge unter den MDL aufweisen kann: Sie kann ihre Agenda nicht durchsetzen. Sowohl in der EU selbst, als auch insbesondere in den Verhandlungen mit den MDL ist sie deutlichen Restriktionen unterworfen. Die EU ist eben kein einheitlicher Block, sondern ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Interessen. Es werden sich nur wenige Interessengruppen finden, die gegen ein demokratisches Marokko agieren; es gibt jedoch einige, die das europäische Angebot an Marokko begrenzen und die Mittel für andere Ziele verwenden möchten.
Die neue liberale Theorie nach Moravcsik hat einen geeigneten Rahmen geliefert, um die EMP am Beispiel Marokkos aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Dabei ist insbesondere deutlich geworden, dass Staaten keine Black Boxes sind. Sie stehen unter dem Druck vielfältiger gesellschaftlicher Interessen. Eine eher allgemeine Fragestellung wie in dieser Arbeit, die umfangreiche Verträge zwischen einem Staat und einem Staatenbund - was die Untersuchung noch verkompliziert hat - untersucht, kann die vielfältigen gesellschaftlichen Interessen, die das Vertragsergebnis beeinflusst haben, nur ansatzweise berücksichtigen. Studien, die hingegen einen gesellschaftlichen Akteur in den Mittelpunkt stellen, entsprechen zwar den Ansprüchen der liberalen Theorie, sie können aber keinen Überblick über zwischenstaatliche Beziehungen liefern, da sie stark punktuell ausgerichtet sind. Diese Arbeit hat durch die beispielhaft angeführten gesellschaftlichen Interessengruppen versucht, dem liberalen Ansatz zu folgen und die Gesellschaften in die Internationalen Beziehungen mit einzubeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen und methodisches Vorgehen
- 2.1 Bisherige Forschungsansätze
- 2.1.1 Die islamistische Bedrohung: eine neorealistische Analyse
- 2.1.2 Der softly-softly-Ansatz: unentschieden
- 2.1.3 Die Ablehnung der Demokratisierungsforderungen: eine konstruktivistische Analyse
- 2.1.4 Implikationen für die Arbeit
- 2.2 Neuer Liberalismus nach Andrew Moravcsik
- 2.2.1 Die politischen Akteure
- 2.2.2 Die Rolle des Staates
- 2.2.3 Die netzwerkanalytische Bestimmung gesellschaftlicher Interessen
- 2.2.4 Kooperation im internationalen System
- 2.2.5 Asymmetrische Interdependenz
- 2.3 Methodisches Vorgehen
- 2.4.1 Demokratie
- 2.4 Begriffsklärung
- 2.4.2 Stabilität
- 2.4.3 Implikationen für die Arbeit
- 2.5 Zusammenfassung
- 2.1 Bisherige Forschungsansätze
- 3 Verhandlung I: Das Assoziationsabkommen 1996
- 3.1 Europäische Präferenzen
- 3.1.1 Regieren im Mehrebenensystem
- 3.1.2 Die Präferenzen der Entscheidungsträger
- 3.1.3 Zusammenfassung der Analyse-Kategorien
- 3.1.4 Gesellschaftliche Interessen
- 3.1.4.1 Politische Akteure
- 3.1.4.2 Administrative Akteure
- 3.1.4.3 Wirtschaftliche Interessengruppen
- 3.1.4.4 Soziale und politische Interessengruppen
- 3.2 Marokkanische Präferenzen
- 3.2.1 Regieren in Marokko unter Hassan II.
- 3.2.1.1 Das politische System
- 3.2.1.2 Ein stabiles Regime?
- 3.2.1.3 Wirtschaftliche und politische Öffnung
- 3.2.1.4 Wirtschaftliche und soziale Entwicklung
- 3.2.2 Gesellschaftliche Interessen und ihre Durchsetzungsfähigkeit
- 3.2.2.1 Politisch-administrative Akteure
- 3.2.2.2 Politische Parteien
- 3.2.2.3 Wirtschaftliche Interessengruppen
- 3.2.2.4 Politische und soziale Interessengruppen
- 3.2.3 Präferenzen der Entscheidungsträger
- 3.2.1 Regieren in Marokko unter Hassan II.
- 3.3 Das Verhandlungsergebnis
- 3.3.1 Das Assoziationsabkommen
- 3.3.2 Vergleich der Präferenzen mit dem Verhandlungsergebnis
- 3.3.2.1 Demokratisierungshilfe
- 3.3.2.2 Stabilisierungsmaßnahmen
- 3.3.2.3 Wirtschaftliche Entwicklung
- 3.3.2.4 Migration
- 3.3.2.5 Extremismus, Terrorismus, Drogen und Kriminalität
- 3.3.2.6 Finanzielle Zuwendungen für Marokko
- 3.3.3 Bewertung des Verhandlungsergebnisses
- 3.1 Europäische Präferenzen
- 4 Verhandlung II: Das NRP 2002-2004
- 4.1 Europäische Präferenzen
- 4.1.1 Die Präferenzen der Entscheidungsträger
- 4.1.2 Die Transnationalisierung der politischen und sozialen Interessengruppen
- 4.2 Marokkanische Präferenzen
- 4.2.1 Institutioneller Wandel (1996-2001)
- 4.2.1.1 Die Institutionalisierung des Konsens-Prinzips (1996-2001)
- 4.2.1.2 Thronwechsel
- 4.2.1.3 Elitenwandel?
- 4.2.2 Wandel gesellschaftlicher Interessen und ihrer Durchsetzungsfähigkeit
- 4.2.2.1 Die Alternance
- 4.2.2.2 Mohammed VI.
- 4.2.2.3 Die CGEM
- 4.2.2.4 Islamistische Gruppen
- 4.2.2.5 Menschenrechtsgruppen
- 4.2.3 Präferenzen der Entscheidungsträger
- 4.2.1 Institutioneller Wandel (1996-2001)
- 4.3 Das Verhandlungsergebnis
- 4.3.1 Verwaltungsreformen
- 4.3.2 Migration
- 4.3.3 Liberalisierung des Verkehrswesens
- 4.3.4 Bewertung des Verhandlungsergebnisses
- 4.1 Europäische Präferenzen
- 5 Demokratisieren oder Stabilisieren?
- 6 Ausblick
- 7 Literaturverzeichnis
- 7.1 Dokumente der Organe der Europäischen Union
- 7.1.1 Europäische Kommission
- 7.1.2 Europäischer Rat
- 7.1.3 Europäisches Parlament
- 7.2 Reden und Interviews der marokkanischen Monarchie und Regierung
- 7.3 Internetadressen
- 7.4 Monographien, Sammelbände, Aufsätze
- 7.1 Dokumente der Organe der Europäischen Union
- 8 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die europäisch-marokkanische Partnerschaft im Kontext der europäischen Erweiterungspolitik. Im Fokus stehen die beiden Verhandlungen zum Assoziationsabkommen von 1996 und dem Nationalen Richtprogramm (NRP) von 2002-2004. Die Arbeit analysiert die Präferenzen der europäischen und marokkanischen Akteure, die Verhandlungsergebnisse und die jeweiligen Auswirkungen auf die Demokratisierung und Stabilisierung des Landes.
- Die Rolle der europäischen Erweiterungspolitik
- Die Präferenzen der europäischen und marokkanischen Akteure
- Die Verhandlungsergebnisse der beiden Abkommen
- Die Auswirkungen auf die Demokratisierung und Stabilisierung Marokkos
- Die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung Marokkos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen und das methodische Vorgehen. Es werden verschiedene Forschungsansätze zur Analyse europäisch-marokkanischer Beziehungen vorgestellt, wobei der Fokus auf dem neuen Liberalismus nach Andrew Moravcsik liegt. Dieses Kapitel erklärt auch die gewählten Konzepte von Demokratie und Stabilität. Kapitel 3 analysiert die erste Verhandlungsrunde zum Assoziationsabkommen von 1996. Es untersucht die Präferenzen der europäischen und marokkanischen Entscheidungsträger und die gesellschaftlichen Interessen, die in diesen Verhandlungen eine Rolle spielten. Anschließend werden die Verhandlungsergebnisse und ihre Auswirkungen auf die Demokratisierung und Stabilisierung Marokkos beleuchtet. Kapitel 4 fokussiert auf die zweite Verhandlungsrunde zum Nationalen Richtprogramm (NRP) von 2002-2004. Es betrachtet die Veränderungen der Präferenzen seit der ersten Verhandlungsrunde, vor allem im Kontext des Thronwechsels in Marokko. Schließlich werden die Ergebnisse der zweiten Verhandlungsrunde und ihre Auswirkungen auf die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung Marokkos analysiert.
Schlüsselwörter
Europäische Erweiterungspolitik, Assoziationsabkommen, Nationales Richtprogramm, Demokratisierung, Stabilisierung, Marokko, Präferenzen, Entscheidungsträger, gesellschaftliche Interessen, Verhandlungsergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Europäisch-Marokkanischen Partnerschaft?
Die Partnerschaft (Barcelona-Prozess) zielt offiziell auf Demokratisierung und wirtschaftliche Entwicklung ab, wobei die Arbeit kritisch hinterfragt, ob oft die Stabilisierung des Regimes im Vordergrund steht.
Warum ist die Demokratisierung Marokkos für die EU schwierig?
Aufgrund starker Interdependenzen kann die EU ihre Agenda nicht einseitig durchsetzen. Zudem ist die EU kein einheitlicher Block, sondern ein Konglomerat verschiedener Interessen.
Was besagt die liberale Theorie von Moravcsik in diesem Kontext?
Sie besagt, dass Staaten keine „Black Boxes“ sind, sondern unter dem Druck vielfältiger gesellschaftlicher Interessengruppen stehen, die das Verhandlungsergebnis beeinflussen.
Wie beeinflusste der Thronwechsel zu Mohammed VI. die Beziehungen?
Der Wechsel brachte einen Elitenwandel und eine Veränderung der marokkanischen Präferenzen mit sich, was in der Verhandlung des Nationalen Richtprogramms (NRP) 2002-2004 deutlich wurde.
Welche Rolle spielen Migration und Terrorismus in den Abkommen?
Diese Themen sind zentrale Bestandteile der Stabilisierungsmaßnahmen und beeinflussen die finanziellen Zuwendungen der EU an Marokko maßgeblich.
- Citar trabajo
- M.A. Mareike Bibow (Autor), 2006, Europäisch-Marokkanische Partnerschaft - Demokratisieren oder Stabilisieren?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78832