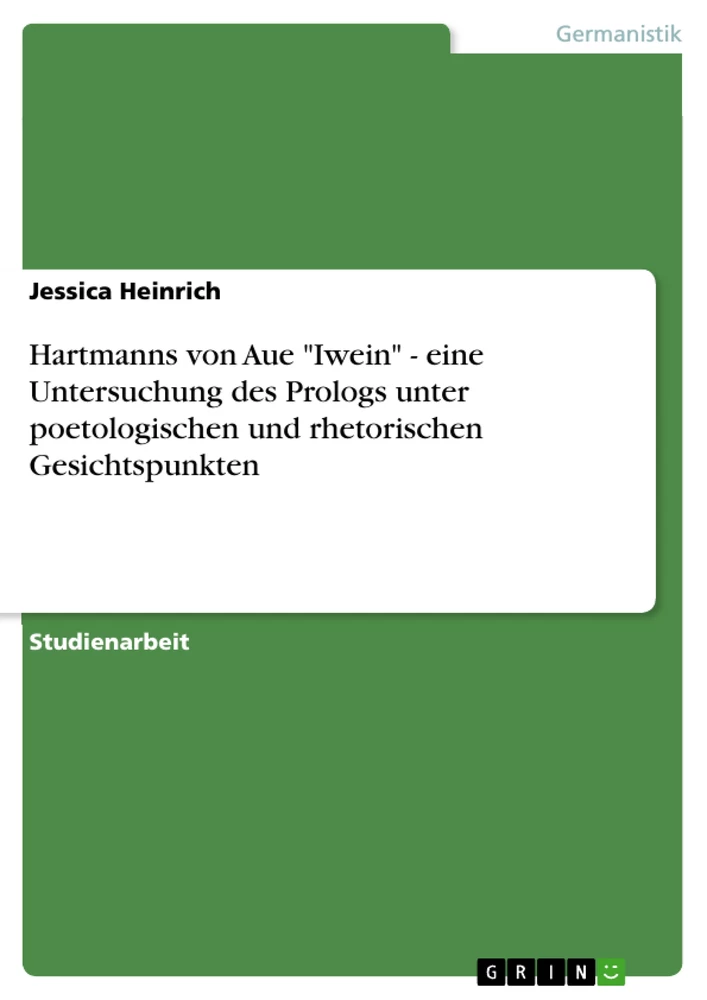Diese Arbeit befasst sich mit dem Prolog des Hartmann’schen „Iwein“ und untersucht ihn hinsichtlich poetologischer und rhetorischer Aspekte, die auf dem antiken Verständnis von Poetik sowie Rhetorik beruhen.
Als Poetik bezeichnet man die Lehre von der Dichtkunst. Sie setzt sich als Dichtungstheorie mit dem Wesen der Dichtung, also mit ihrer Wirkung, ihrem Wert, ihren Aufgaben und Funktionen, ihren spezifischen Ausdrucksmitteln und ihren poetischen Gattungen auseinander. Die Verfasser von theoretischen Abhandlungen versuchen, das Wesen der Dichtung zu fassen, indem sie abgrenzen, was Dichtung (Poesie) „eigentlich“ sei und es so von dem abheben, was ihrer Auffassung nach nicht als Dichtung zählt. In der normativen Regelpoetik werden sogar praktisch anwendbare und erlernbare Anweisungen aufgestellt, die bei der „richtigen“ Erstellung poetischer Werke helfen sollte – eine Theorie, die in großem Maße von der Rhetorik beeinflusst wurde.
Die Kunst der freien Rede wird als Rhetorik bezeichnet und wurde von Aristoteles in die drei Richtungen Pathos, Ethos und Logos unterteilt. In der Antike hatte die Rhetorik die Aufgabe, Gemeinsamkeiten zwischen dem Redner und seinen Zuhörern herzustellen und ihm so die Möglichkeit zu geben, seine Zuhörer von seinen Worten zu überzeugen. Aus diesem Grund wird die Rhetorik auch „Kunst der Überzeugung“ genannt. Hierbei spielte auch die Ansicht, dass man sich nicht allein auf die Vernunft verlassen konnte, da der Mann ein triebhaftes Wesen habe, eine große Rolle. In der Aufklärung jedoch wurde diese Vorstellung abgelehnt und die Rhetorik weitgehend aus dem alltäglichen Leben, den Wissenschaften und dem Denken verbannt. Auch in der Neuzeit wird die Rhetorik häufig nur als Redetechnik bzw. Theorie und Praxis der Rede angesehen.
Die mittelalterlichen Dichtungstheorien haben ihren Ursprung in der Antike. Sowohl Aristoteles (384-322 v. Chr.) als auch Horaz (65-8 v. Chr.) beeinflussten mit ihren Ausführungen zur Poetik nachhaltig über Jahrhunderte hinweg die Dichtung. „Peri poietikes“ („Über die Dichtkunst“), die Poetik des Aristoteles und die horazische „Ars Poetica“ („Die Dichtkunst“) gelten als die wichtigsten Poetiken der Antike. Allerdings unterscheiden sie sich deutlich voneinander, so ist Aristoteles’ Poetik eine klar strukturierte Abhandlung, während Horaz’ Pisonenepistel als Brief aufgebaut und formuliert ist.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Prologschema im Mittelalter
- 2.1. Die antike Tradition des Prologs
- 2.2. Die Rolle der antiken Rhetorik im Prolog des Artusromans
- 2.3. Hartmanns,,Iwein“
- 2.3.1. Die Struktur des „Iwein“-Prologs
- 2.3.2. Die Selbstdarstellung des Autors
- 2.3.3. Das Erzählen im Erzählen
- 2.3.3.1. Die Kalogrenant-Erzählung
- 2.3.3.2. Die Entführung der Königin
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Prolog von Hartmanns „Iwein“ hinsichtlich poetologischer und rhetorischer Aspekte, die auf antiken Konzepten von Poetik und Rhetorik basieren. Ziel ist es, die Anwendung klassischer Rhetorik- und Poetik-Prinzipien im Prolog zu beleuchten und deren Einfluss auf die Gestaltung des Werkes zu untersuchen.
- Die Rolle des Prologs in der mittelalterlichen Literatur
- Die Verbindung von antiker Poetik und Rhetorik im Prolog von Hartmanns „Iwein“
- Die Selbstdarstellung des Autors und seine Beziehung zum Leser
- Die Verwendung von Erzählungen im Erzählen und deren Funktion im Prolog
- Die Bedeutung von Rhetorik für die Überzeugungskraft und Wirkung des Prologs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Gegenstand der Untersuchung, den Prolog von Hartmanns „Iwein“, und den Fokus der Analyse – Poetik und Rhetorik – definiert. Anschließend werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen für die Analyse erläutert. Es wird die antike Tradition des Prologs und die Rolle der Rhetorik im Prolog des Artusromans beleuchtet. In Kapitel 2.3 wird der Prolog von „Iwein“ detailliert untersucht. Hier werden die Struktur des Prologs, die Selbstdarstellung des Autors und die verschiedenen Erzähltechniken analysiert. Das Kapitel 2.3.3 widmet sich den „Erzählungen im Erzählen“ und untersucht die Rolle der Kalogrenant-Erzählung und der Entführung der Königin im Prolog. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Dichtungstheorie, Hartmann von Aue, „Iwein“, Prolog, Poetik, Rhetorik, Antike, Artusroman, Selbstdarstellung, Erzählstruktur, Erzählen im Erzählen, Kalogrenant, Entführung der Königin.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Untersuchung von Hartmanns „Iwein“?
Die Arbeit analysiert den Prolog des Epos unter poetologischen und rhetorischen Gesichtspunkten der Antike.
Welche Rolle spielt die antike Rhetorik im Prolog?
Die Rhetorik dient als „Kunst der Überzeugung“, um eine Verbindung zwischen dem Erzähler und dem Publikum herzustellen und die Wirkung des Werks zu steuern.
Wie stellt sich der Autor Hartmann von Aue im Prolog dar?
Die Arbeit untersucht die Selbstdarstellung des Autors und wie er seine Rolle als Vermittler von ritterlichen Werten und Geschichten definiert.
Was versteht man unter „Erzählen im Erzählen“ im Iwein-Prolog?
Es bezieht sich auf Binnenerzählungen wie die von Kalogrenant, die bereits im Prolog wichtige Themen des gesamten Romans vorwegnehmen.
Was bedeutet „Poetik“ in diesem Kontext?
Poetik ist die Lehre von der Dichtkunst, die sich mit dem Wesen, der Funktion und den Ausdrucksmitteln literarischer Gattungen befasst.
- Quote paper
- Jessica Heinrich (Author), 2007, Hartmanns von Aue "Iwein" - eine Untersuchung des Prologs unter poetologischen und rhetorischen Gesichtspunkten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78860