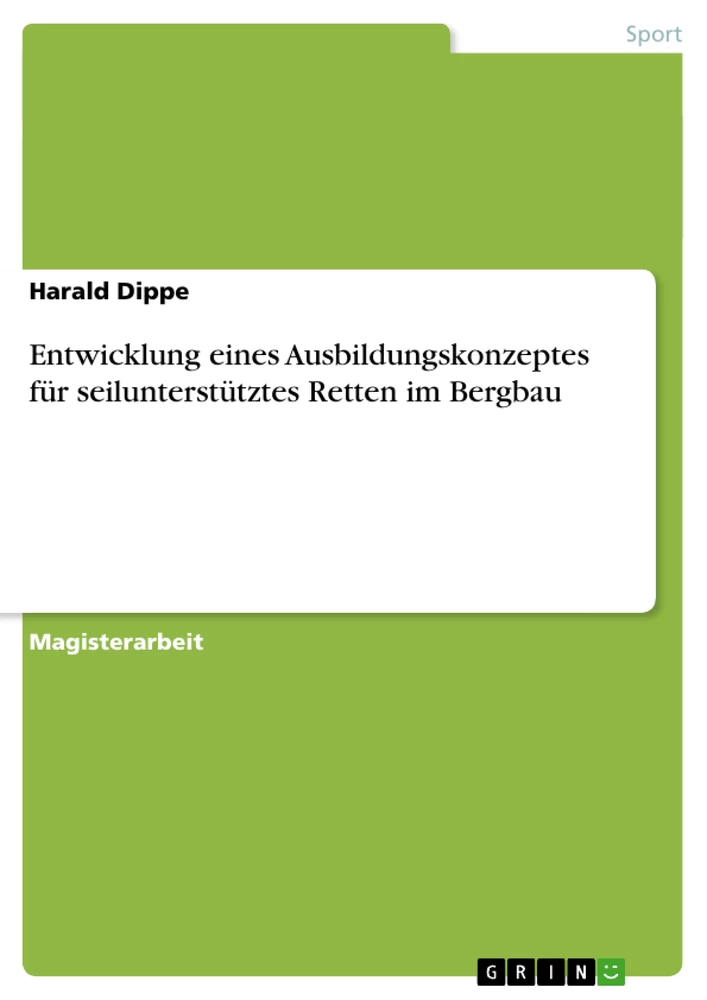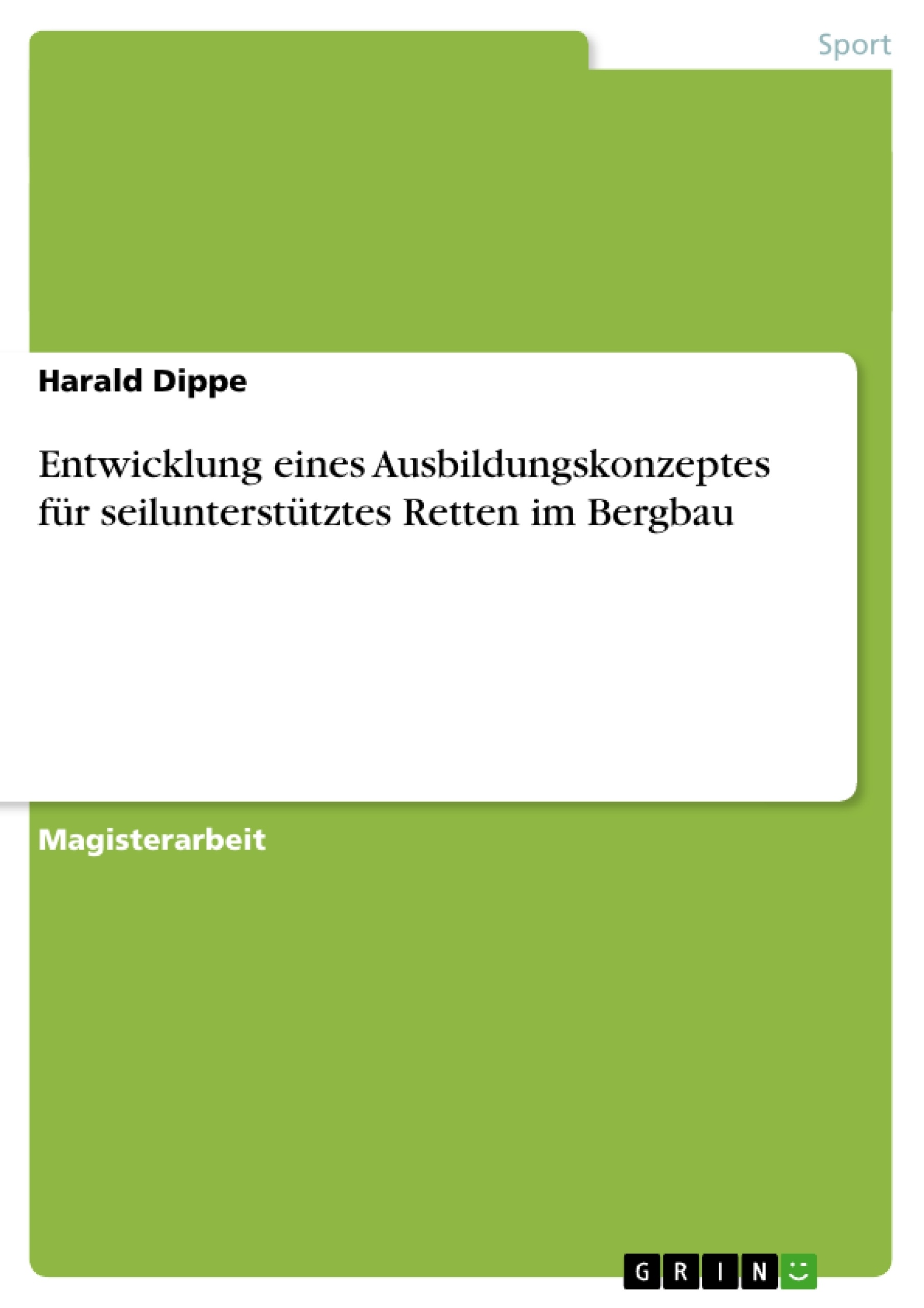Ein Jahr vor der Fußball Weltmeisterschaft wird das Waldstadion in Frankfurt renoviert. Unter anderem erhält es ein 40 Meter hohes spinnennetzartiges Dach aus einer modernen Stahlseilkonstruktion. Strom für Licht und Fernsehkameras wird mit Hilfe von Hochspannungsmasten, die zum Teil bis zu 80 Meter Höhe erreichen, transportiert. Ein Teil der Stromproduktion wird durch das Verbrennen von Kohle, die der Bergbau im Tagebau mit riesigen Baggern oder Untertage in tiefsten Schächten fördert, abgedeckt. Kommunikation wird durch ein gut ausgebautes Mobilfunknetz gewährleistet, das Sendemasten, die über ähnliche Höhen verfügen, nutzt. Die Herstellung eines Handys ist ohne chemische Produkte unmöglich. Rohstoffe, Zwischen – und Endprodukte der Chemieindustrie werden in Bunkern und Silos gelagert, die mit bis zu 50 Metern ebenfalls stattliche Höhen erreichen.
In diesen Höhen und Tiefen wird gebaut und gewartet. Bis zu sechs Tonnen schwere Stahlbaugruppen werden im Dach des Frankfurter Waldstadion mit 2mm Toleranz zusammengefügt, um später Kameraleuten optimale Blickwinkel für Übertragungen zu ermöglichen. Im Pumpspeicherwerk Markersbach hängen Aluminiumschweißer in 90 Meter tiefen dunklen Schächten und reparieren Stromleitungen. Um Funklöcher zu beheben werden Sendemasten für Mobilfunkanlagen modifiziert und aufgebaut. Die korrekte Lagerung von Chemieprodukten, in Silos innerhalb und außerhalb von Gebäuden, muss aus Sicherheits – und Umweltgründen regelmäßig geprüft werden. Skifahrer verlassen sich auf sichere, funktionsgerechte Seilbahnen, deren Masten, Rollen und Lager regelmäßig geprüft und gewartet werden müssen.
Ob Schächte, Masten, Gebäude, Silos, Bunker, Dach – und Fassadenbau, Tagebaubagger oder Kräne, an allen diesen Orten wird gearbeitet und all diese Arbeiter setzen sich der Gefahr aus, abzustürzen. Um dies zu vermeiden, nutzen sie die Seiltechnik.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielseitig und scheinen unbegrenzt. Die Schwierigkeit und die Gefahr der Anwendung hängen stark von der Arbeitsaufgabe ab. Das Besteigen eines Mastes, der über ein bereits montiertes modernes Leitersystem verfügt, ist leichter zu gestalten als die Montage des Leitersystems. Masten auf Korrosion zu überprüfen, ist weniger gefährlich, als auf einem Brett sitzend zu schweißen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Kennzeichnung der Problemlage
- 1.2 Fragestellung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Stand des Wissens
- 2.1 Empirischer Befund
- 2.2 Hermeneutischer Befund
- 2.2.1 Rechtliche Grundlagen
- 2.3 Theoretische Konzepte
- 2.3.1 Regulation von Handlungen und Ansätze des Lernen und Lehrens
- 2.3.2 Ausbildungsgestaltung und Organisation
- 2.4 Synthese und Konsequenzen
- 3 Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes
- 3.1 Inhalte der Ausbildung
- 3.1.1 Grundkenntnisse für seiltechnische Rettungen
- 3.1.2 Geräte und Verfahren
- 3.1.3 Anschlagpunkte, Knoten, Theorie und Dokumentation
- 3.2 Organisatorisch – methodische Gestaltung der Ausbildung
- 3.2.1 Organisationsaufbau der Ausbildung
- 3.2.2 Methodik der Ausbildung
- 4 Umsetzung des Ausbildungskonzeptes anhand der Basisausbildung I
- 5 Diskussion, Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit zielt darauf ab, ein Ausbildungskonzept für seilunterstütztes Retten im Bergbau zu entwickeln. Das Konzept soll die Ausbildung entsprechend den Anforderungen aus dem seilunterstützten Retten methodisch gestalten und in einem Ausbildungskonzept umsetzen, welches differenzierte Ausbildungskriterien beinhaltet. Die Ausbildung der Hauptstelle für Grubenrettungswesen (HGRW) in Leipzig soll dabei als Grundlage dienen.
- Entwicklung einer Methodik für die Ausbildung im seilunterstützten Retten
- Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes mit differenzierten Ausbildungskriterien
- Untersuchung der Ausbildung der HGRW in Leipzig nach Ausbildungskriterien, -methoden und zeitlicher Gestaltung
- Erfassung der Anforderungen an Retter bezüglich organisatorischer und technologischer Abläufe sowie sicherheitstechnischer Anforderungen
- Umsetzung spezifischer Anforderungen an Rettungspersonal in Mindestforderungen für die Ausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemlage, die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit darlegt. Im zweiten Kapitel erfolgt eine umfassende Darstellung des Standes der Forschung, wobei empirische, hermeneutische und theoretische Befunde beleuchtet werden. Die rechtlichen Grundlagen werden in diesem Zusammenhang ebenfalls berücksichtigt. Anschließend werden theoretische Konzepte zur Regulation von Handlungen und Ansätzen des Lernens und Lehrens sowie zur Ausbildungsgestaltung und -organisation präsentiert.
Kapitel 3 widmet sich der Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes. Es werden die Inhalte der Ausbildung, wie Grundkenntnisse für seiltechnische Rettungen, Geräte und Verfahren sowie Anschlagpunkte, Knoten, Theorie und Dokumentation, behandelt. Des Weiteren werden die organisatorischen und methodischen Aspekte der Ausbildung, einschließlich des Organisationsaufbaus und der Methodik, beleuchtet.
Im vierten Kapitel wird die Umsetzung des entwickelten Ausbildungskonzeptes anhand der Basisausbildung I gezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit seilunterstütztem Retten, Ausbildungskonzept, Bergbau, Grubenrettungswesen, Sicherheitstechnik, Technologie, Mensch, Ausbildungskriterien, -methoden, didaktische Aufbereitung, zeitliche Gestaltung, arbeits-, erziehungs- und sportwissenschaftliche Methoden und Verfahren, Mindestforderungen, Trainingszyklen, organisatorische und technologische Abläufe.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist ein spezielles Ausbildungskonzept für Retter im Bergbau nötig?
Aufgrund der extremen Höhen und Tiefen (Schächte, Silos, Masten) sind spezifische seiltechnische Kenntnisse und Sicherheitsanforderungen im Bergbau essenziell.
Was sind die Kerninhalte der Basisausbildung I?
Dazu gehören Grundkenntnisse der Seiltechnik, Gerätekunde, Knotenkunde, Anschlagpunkte sowie theoretische Dokumentation und Rettungsverfahren.
Welche Rolle spielt die Hauptstelle für Grubenrettungswesen (HGRW)?
Die HGRW in Leipzig dient als Grundlage für die Entwicklung der Ausbildungskriterien und methodischen Standards im seilunterstützten Retten.
Welche rechtlichen Grundlagen müssen beachtet werden?
Die Arbeit beleuchtet die hermeneutischen Befunde und rechtlichen Vorschriften, die den Einsatz von Seiltechnik zur Rettung im Bergbau regeln.
Was bedeutet "Regulation von Handlungen" in der Ausbildung?
Es bezieht sich auf theoretische Konzepte des Lehrens und Lernens, um Retter dazu zu befähigen, auch unter Stress sicher und methodisch korrekt zu handeln.
- Quote paper
- Harald Dippe (Author), 2005, Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes für seilunterstütztes Retten im Bergbau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78874