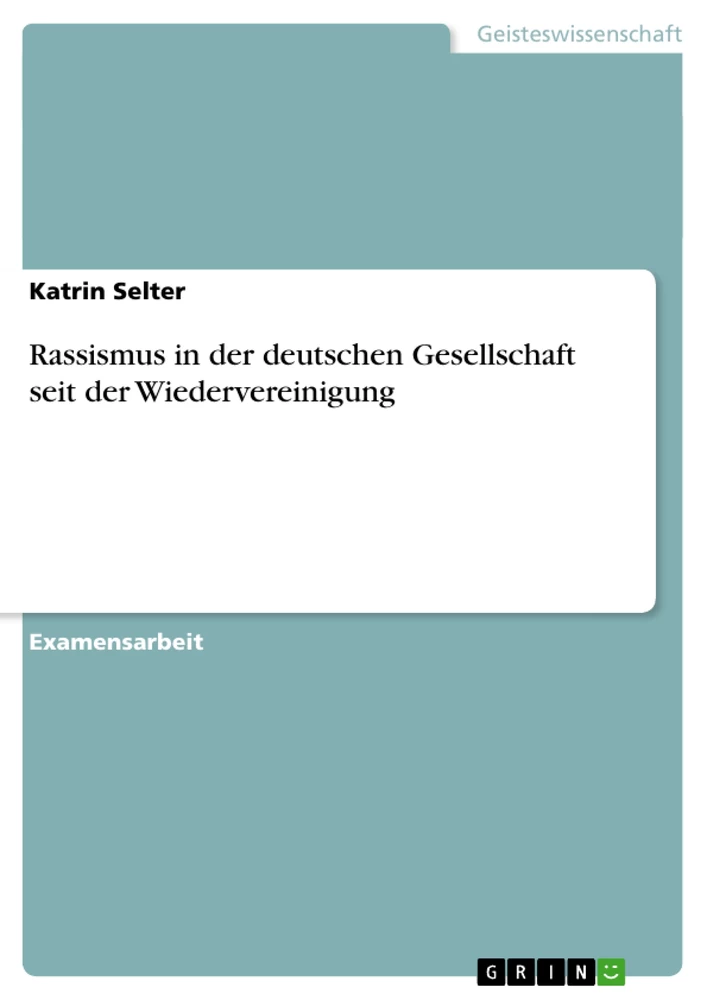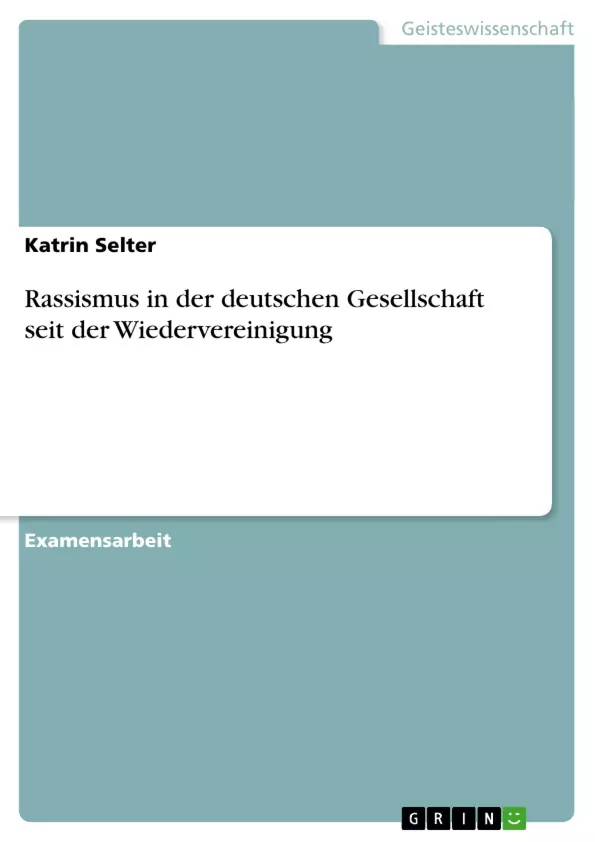Rassismus war nicht nur ein Problem vergangener Tage, sondern ist auch in
der heutigen Zeit noch aktuell. Er wurde in den letzten Jahren in der
Öffentlichkeit häufig tabuisiert, wenn nicht sogar geleugnet. Politiker und
Medien vermieden es bei Gewalttaten gegen Migranten von rassistischen
Angriffen zu sprechen, sie zogen die Begriffe „Ausländerfeindlichkeit“ oder
„Fremdenfeindlichkeit“ vor.
Der Begriff „Rassismus“ weckt in den Köpfen der Menschen noch immer
Assoziationen zum Dritten Reich und der damaligen Rassenideologie der
Nationalsozialisten, die möglichst nicht mehr thematisiert werden soll.
Seit der Wiedervereinigung Deutschlands kam es immer häufiger zu
rassistischen Straftaten, wodurch der „Rassismus-Begriff“ wieder in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit rückte. Zu nennen sind hier besonders die vielen
Brandanschläge gegen Ausländer (z.B. in Mölln, Hoyerswerda, Rostock-
Lichtenhagen und Solingen) zu Beginn der 90er Jahre, die bis heute
unvergessen sind und im weiteren Verlauf der Examensarbeit unter anderem
thematisiert werden.
Ich habe für meine Arbeit zwei Themenschwerpunkte gewählt, die ich
ausführlich bearbeiten möchte. Zunächst jedoch stelle ich die Situation in
Westdeutschland und der DDR bezogen auf den Rassismus vor der
Wiedervereinigung vor. Den Mittelpunkt meiner Examensarbeit bildet die
verstärkte Ausbreitung des Rassismus nach der Wiedervereinigung und ihre
Ursachen, die ich näher erläutern werde. Dass es seit dem Mauerfall vermehrt
zu Rassismus kam ist bekannt, allerdings stellt sich die Frage nach den
Gründen. Einen weiteren Themenschwerpunkt bildet der Rassismus in der
Schule, wobei ich hier besonders Präventivmaßnahmen vorstellen möchte.
Ich hoffe, dass ich mit meiner Examenarbeit einen guten und ausführlichen
Einblick in die Thematik des neueren Rassismus geben kann und auch Ansätze
8 und Möglichkeiten zur Prävention vorstelle, die gegebenenfalls zu einem
Rückgang rassistischer Straftaten führen könnten.
Rassismus richtet sich gegen eine Vielzahl von menschlichen Gruppen, u.a.
gegen Ausländer, Behinderte, Homosexuelle, ältere Menschen und
Religionsgruppen. Im Laufe dieser Arbeit bezieht sich der „Rassismus-
Begriff“, wenn nicht anders erwähnt, ausschließlich auf Ausländer.
Ich weise darauf hin, dass die grundsätzlich benutzte maskuline Form in
meiner Examensarbeit auch die weibliche Form umfasst und der
Vereinfachung dient.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Erläuterungen und Definitionen der Kernbegriffe
- 1.1 Die Geschichte des Begriffs „Rasse“
- 1.2 Die Definition des Begriffs „Rasse“
- 1.3 Die Geschichte des Begriffs „Rassismus“
- 1.4 Was ist „Rassismus“?
- 1.5 Abgrenzung des Begriffs „Rassismus“ zu anderen Phänomenen
- 1.5.1 Ethnozentrismus
- 1.5.2 Xenophobie
- 1.5.3 Fremdenfeindlichkeit
- 1.5.4 Ausländerfeindlichkeit
- 1.5.5 Rechtsradikalismus/ Rechtsextremismus
- 1.5.6 Sexismus
- 1.5.7 Antisemitismus
- 2 Rassismus vor der Wiedervereinigung
- 2.1 Rassismus in der DDR
- 2.2 Rassismus in Westdeutschland
- 3 Rassismus in Deutschland nach der Wiedervereinigung
- 3.1 Die Situation in Deutschland kurz nach der Wiedervereinigung
- 3.2 Die Arbeitsmarktsituation und ihre Auswirkungen auf den Rassismus
- 3.3 Zusammenhänge von Bildungsstand und Rassismus
- 3.4 Die Wohnsituation und ihre Auswirkungen auf den Rassismus
- 3.5 Die Verbreitung rechtsradikaler Parteien in Deutschland
- 3.5.1 Die REP
- 3.5.2 Die DVU
- 3.5.3 Die NPD
- 3.5.4 „Ich wähle rechts!“
- 3.6 Das Täterprofil rassistischer Gewalt
- 3.7 Politische Ansätze zur Minderung des Rassismus
- 3.8 Die heutige Situation in Deutschland
- 3.9 Fallbeispiel: Der Brandanschlag von Solingen
- 3.9.1 Die Stadt Solingen
- 3.9.2 Der Tathergang
- 3.9.3 Der Tag danach
- 3.9.4 Die Täter
- 3.9.5 Die Opfer
- 3.9.6 Der Prozess
- 3.9.7 Solingen heute, 14 Jahre nach dem Brandanschlag
- 4 Rassismus in der Schule
- 4.1 Rassismus bei Schülern
- 4.1.1 Persönlichkeitsstruktur rassistischer Jugendlicher
- 4.1.2 Mädchen
- 4.1.3 Jungen
- 4.2 Rassistische Lehrer
- 4.3 Einflussnahme der Schule auf rassistische Tendenzen bei Schülern
- 4.3.1 Möglichkeiten und Probleme der Rassismusbekämpfung in der Schule
- 4.3.2 Konkrete Unterrichtskonzepte zur Prävention und Minderung von Rassismus
- 4.3.2.1 Der Geschichtsunterricht
- 4.3.2.2 Der Politikunterricht
- 4.3.2.3 Die sozial-ethische Bildung
- 4.3.2.4 Der Wirtschafts- und Geographieunterricht
- 4.3.2.5 Die interkulturelle Bildung
- 4.4 Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
- 4.4.1 Was ist „SOR - SMC“?
- 4.4.2 Wie wird man eine „SOR – SMC“?
- 4.4.2.1 Rechte der Schüler
- 4.4.2.2 Die Kooperation mit Lehrern
- 4.4.2.3 Patenschaften
- 4.4.3 Projekte und Aktionen von „SOR – SMC“
- 4.4.3.1 „Q-rage“: Die Zeitung des größten deutschen Schulnetzwerks
- 4.4.3.2 Das Projekt „Unsere Stadt ohne Rassismus“
- 4.4.4 „Schule ohne Rassismus“ in anderen Ländern Europas
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
- Anhang
- Anhangverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Rassismus in der deutschen Gesellschaft seit der Wiedervereinigung. Im Vordergrund steht die Untersuchung der Ausbreitung von Rassismus in den neuen Bundesländern und in der Schule.
- Ursachen und Auswirkungen von Rassismus nach der Wiedervereinigung
- Rolle der Arbeitslosigkeit, des Bildungsstandes und der Wohnsituation
- Verbreitung rechtsradikaler Parteien in Deutschland
- Rassismus in der Schule: Ursachen, Prävention und Unterrichtskonzepte
- Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung und einer Definition der Kernbegriffe „Rasse“ und „Rassismus“. Im Anschluss werden die Unterschiede zwischen Rassismus und ähnlichen Phänomenen wie Ethnozentrismus, Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus erläutert.
In Kapitel 2 wird ein Überblick über die Situation des Rassismus in Westdeutschland und der DDR vor der Wiedervereinigung gegeben. Es wird deutlich, dass Rassismus in beiden deutschen Staaten vorhanden war, jedoch in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen.
Kapitel 3 fokussiert sich auf den Rassismus in Deutschland nach der Wiedervereinigung. Hier werden die Ursachen des massiven Anstiegs rassistischer Gewalt untersucht, wobei die Rolle der Arbeitslosigkeit, des Bildungsstandes und der Wohnsituation herausgestellt werden. Außerdem wird die Verbreitung rechtsradikaler Parteien und die Rolle der Politik bei der Rassismusbekämpfung beleuchtet. Ein ausführliches Fallbeispiel des Brandanschlags von Solingen im Jahr 1993 verdeutlicht die Tragweite des Rassismus in Deutschland.
In Kapitel 4 wird der Rassismus in der Schule thematisiert. Die Arbeit untersucht, wie sich Rassismus bei Schülern und Lehrern äußert und welche Faktoren eine Rolle dabei spielen. Es werden verschiedene Unterrichtskonzepte zur Prävention und Minderung von Rassismus vorgestellt und das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausführlich analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Rassismus, Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Arbeitslosigkeit, Bildungsstand, Wohnsituation, Schule, Unterrichtskonzepte, Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, und dem Fallbeispiel des Brandanschlags von Solingen.
Häufig gestellte Fragen
Warum nahm rassistische Gewalt nach der Wiedervereinigung zu?
Die Arbeit nennt Ursachen wie die schwierige Arbeitsmarktsituation, soziale Verunsicherung und die verstärkte Ausbreitung rechtsradikaler Ideologien in den neuen Bundesländern.
Was geschah beim Brandanschlag von Solingen 1993?
Es war einer der schwersten rassistischen Anschläge der Nachkriegsgeschichte, bei dem fünf Menschen türkischer Abstammung starben. Die Arbeit analysiert Tathergang, Opfer und den Prozess.
Gibt es Unterschiede zwischen Rassismus in der DDR und Westdeutschland?
Ja, die Arbeit beleuchtet die spezifischen Formen des Rassismus in beiden deutschen Staaten vor 1990 und wie diese nach der Wende zusammenwirkten.
Wie äußert sich Rassismus in der Schule?
Rassismus tritt sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern auf. Faktoren wie Persönlichkeitsstruktur und das soziale Umfeld spielen eine entscheidende Rolle.
Was ist das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“?
Es ist ein Schulnetzwerk, bei dem sich Schüler und Lehrer aktiv gegen Diskriminierung verpflichten. Die Arbeit erklärt, wie man Teil des Projekts wird und welche Aktionen es gibt.
Welche Unterrichtskonzepte helfen gegen Rassismus?
Vorgestellt werden Ansätze für den Geschichts-, Politik- und Wirtschaftsunterricht sowie Konzepte zur interkulturellen und sozial-ethischen Bildung.
- 4.1 Rassismus bei Schülern
- Arbeit zitieren
- Katrin Selter (Autor:in), 2007, Rassismus in der deutschen Gesellschaft seit der Wiedervereinigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78910