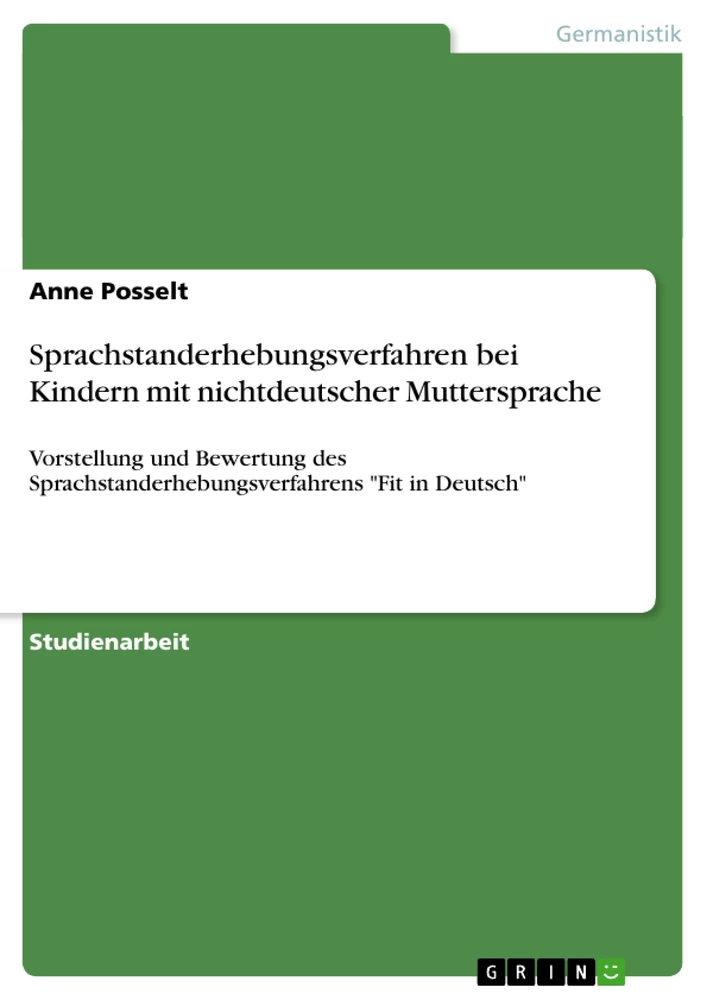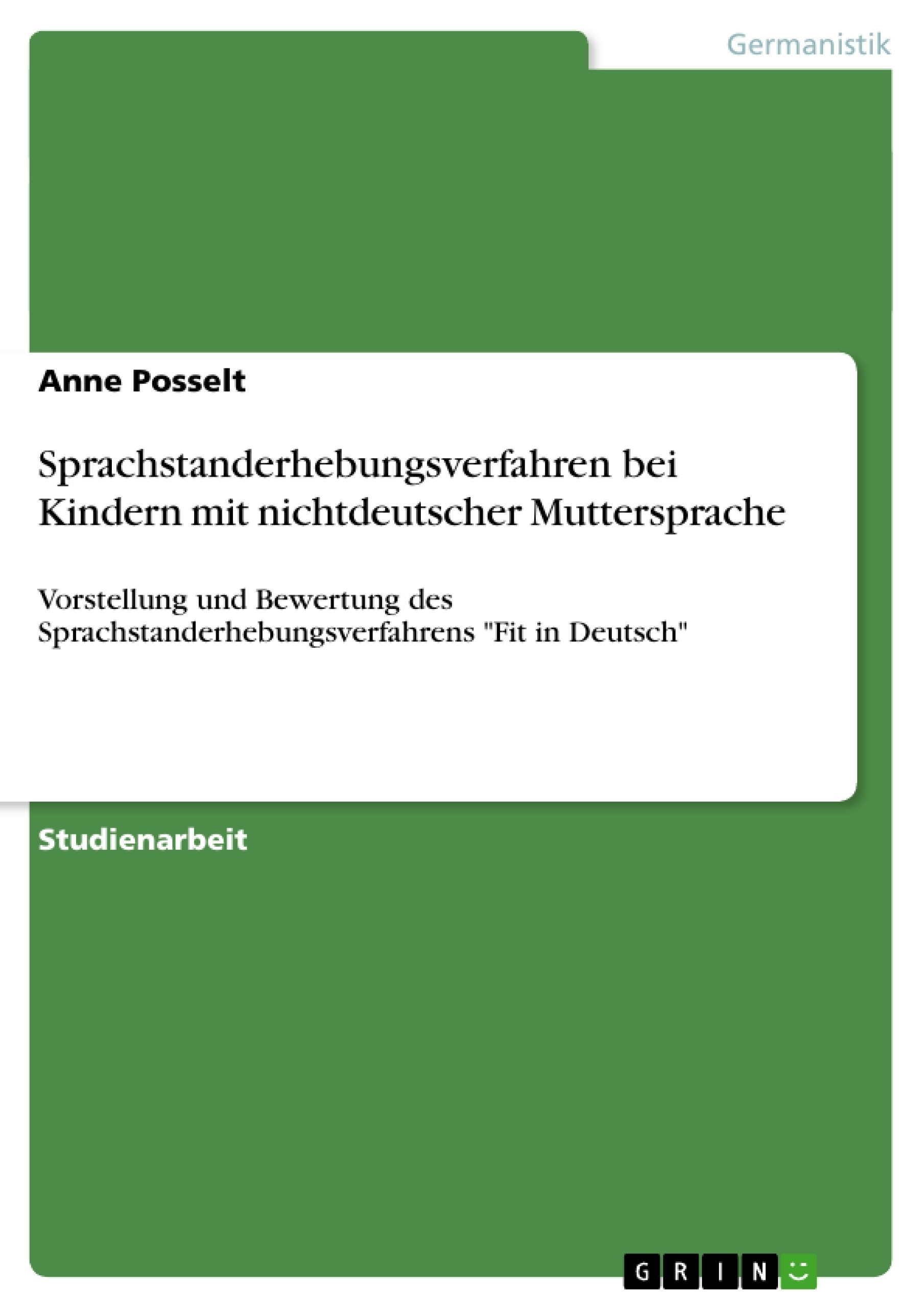Um vom ersten Schuljahr an erfolgreich in der Schule mitarbeiten zu können, sind gute Sprach- und Sprechfertigkeiten in Deutsch eine der wichtigsten Voraussetzungen. Sie können entscheidend für die weitere Schullaufbahn und den sich anschließenden beruflichen Weg eines Kindes sein. Mögliche Defizite in der Sprachentwicklung sollten daher bereits vor Schuleintritt, am sinnvollsten schon in den Kindergärten und Kindertagesstätten, erkannt und durch Fördermaßnahmen verringert werden. Dies gilt für Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist, aber vor allem für Kinder aus Familien mit nichtdeutscher Muttersprache. Besonders Kinder von Migranten werden überproportional zu den sprachlichen „Problemfällen“ gezählt und im Vergleich zu deutschen Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen häufiger an Sonder- bzw. Förderschulen verwiesen. ( Vgl. Ehlich, 2005, S.28) Gerade für diese Kinder ist daher eine individuelle und qualifizierte Vorschulförderung nötig. Voraussetzung ist eine möglichst genaue Sprachstanddiagnose. Mit Hilfe von objektivierten Test- und Überprüfungsverfahren sollten u.a. die Aussprache, der altersgemäße Wortschatz, das Sprachverständnis und Sprachstrukturen nach einheitlichen Kriterien überprüft werden. Aus diesem Grund werden in einigen Bundesländern bereits vor der Einschulung Sprachstandüberprüfungen bei künftigen Schulanfängern vorgenommen, um herauszufinden, welche von ihnen an einer Förderung teilnehmen sollen.
In dieser Arbeit werde ich zunächst die Entwicklung von Sprachstanderhebungsverfahren in Deutschland aufzeigen und die besondere Problematik einzelner Verfahren darstellen. Im Anschluss daran geht es um Testgütekriterien für Sprachstanddiagnoseverfahren, die verschiedene Sprachwissenschaftler empfehlen und die im Hauptseminar Sprachförderung bei Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache bei Prof. Dr. Petra Schulz im Wintersemester 2006/07 von den Teilnehmern bearbeitet wurden. Am Beispiel des Verfahrens „Fit in Deutsch“, das im Bundesland Niedersachsen seit einigen Jahren vor der Einschulung verbindlich mit jedem Kind durchgeführt wird, werde ich danach mit Hilfe dieser Kriterien eine Bewertung vornehmen. Das Fazit am Schluss der Arbeit enthält zusammenfassende Bemerkungen zum Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung von Sprachstanderhebungsverfahren für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache
- Testgütekriterien für Sprachstanderhebungsverfahren für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache
- Problematik der Maßstäbe
- Anforderungen an Sprachstanderhebungsverfahren
- Kriterien für die Entwicklung von Tests zur Sprachstanddiagnose
- Aussagekraft
- Ziel
- Zweck
- Zielgruppe
- Berücksichtigung der Sprachbiografie
- Einsatzmöglichkeit
- Durchführung
- Erhebungsmethode
- Sprachtheoretische Basis
- Design
- Unterscheidung sprachliches und nichtsprachliches Wissen
- Auswertung
- Testtheoretische Güte
- Ökonomie
- Beurteilung des Sprachstanderhebungsverfahrens Fit in Deutsch anhand der Evaluationskriterien
- Allgemeines zum Sprachstanderhebungsverfahren „Fit in Deutsch“
- Untersuchung des Verfahrens Fit in Deutsch anhand der Gütekriterien für Sprachstanderhebungsverfahren
- Auswertung der Untersuchung: Ist Fit in Deutsch ein geeignetes Sprachstanderhebungsverfahren?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und Bewertung von Sprachstanderhebungsverfahren für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache. Das Ziel ist es, die Besonderheiten dieser Verfahren im Kontext der sprachlichen Förderung von Kindern aus Migrantenfamilien aufzuzeigen und anhand von relevanten Kriterien ein geeignetes Verfahren, „Fit in Deutsch“, zu beurteilen.
- Entwicklung von Sprachstanderhebungsverfahren für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache
- Testgütekriterien für Sprachstanddiagnosen
- Bewertung des Verfahrens "Fit in Deutsch" anhand der Gütekriterien
- Sprachliche Förderung von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache
- Individuelle Sprachstanddiagnosen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung von Sprach- und Sprechfertigkeiten für den Schulerfolg und die Notwendigkeit frühzeitiger Sprachstanddiagnosen insbesondere für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung von Sprachstanderhebungsverfahren, die Herausforderungen durch die Einwanderung von Kindern mit geringen Deutschkenntnissen und die Problematik bisheriger Verfahren. Im dritten Kapitel werden wichtige Testgütekriterien für Sprachstanddiagnosen diskutiert, die auf die Besonderheiten von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache zugeschnitten sind. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Sprachstanderhebungsverfahren "Fit in Deutsch", welches anhand der zuvor beschriebenen Kriterien bewertet wird. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Eignung des Verfahrens für die Sprachstanddiagnostik bei Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache.
Schlüsselwörter
Sprachstanderhebungsverfahren, Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache, Sprachstanddiagnose, Testgütekriterien, Sprachförderung, Sprachentwicklung, "Fit in Deutsch", Bilingualität, Sprachbiografie.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Sprachstanderhebung vor der Einschulung so wichtig?
Gute Deutschkenntnisse sind die Basis für den Schulerfolg; Defizite müssen frühzeitig erkannt werden, um gezielte Fördermaßnahmen einzuleiten.
Welche Kriterien sollte ein Sprachstandstest erfüllen?
Ein Test sollte eine hohe Aussagekraft haben, die Sprachbiografie berücksichtigen, objektiv auswertbar sein und zwischen sprachlichem und nichtsprachlichem Wissen unterscheiden.
Was ist das Verfahren „Fit in Deutsch“?
Es ist ein in Niedersachsen verbindliches Verfahren zur Überprüfung des Sprachstandes bei künftigen Schulanfängern.
Warum werden Migrantenkinder oft als „Problemfälle“ eingestuft?
Ohne qualifizierte Diagnose werden Sprachschwierigkeiten oft fälschlicherweise als generelle Lernschwäche interpretiert, was zu unnötigen Überweisungen an Förderschulen führen kann.
Was bedeutet „Berücksichtigung der Sprachbiografie“?
Es bedeutet, bei der Bewertung der Deutschkenntnisse auch den Hintergrund des Kindes (Muttersprache, Dauer des Kindergartenbesuchs) miteinzubeziehen.
- Quote paper
- Anne Posselt (Author), 2007, Sprachstanderhebungsverfahren bei Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79042