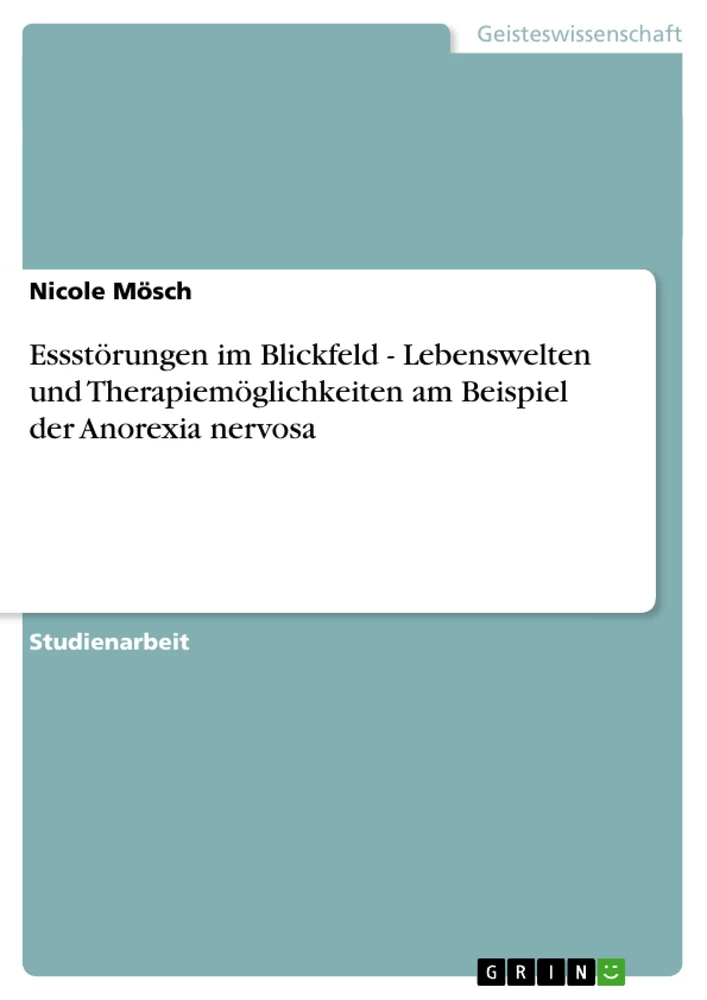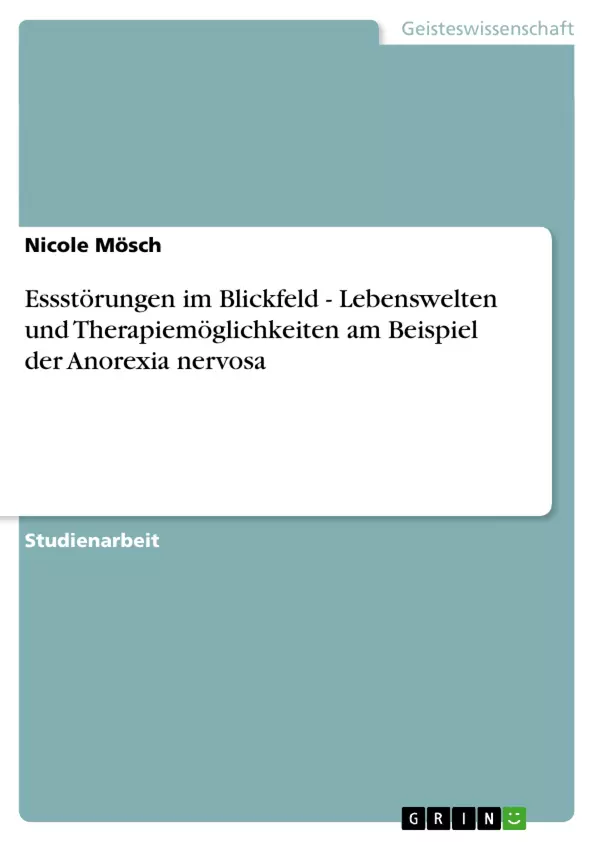Im Gesundheitsbericht für Deutschland von 1998 wurde dargestellt, dass Anfang der 90er-Jahre im Westen Deutschlands 19,5 % der Frauen und 17,3 % der Männer als übergewichtig galten. Dieser Trend ist weltweit in allen Industrienationen erkennbar. Schon seit Jahren warnen Ernährungswissenschaftler davor, unsere Ernährungsweise enthält zu viel Fett, zu viel Zucker und zu viel Energie, aber zu wenig Ballaststoffe. Trotz dieser Tatsachen sind viele Menschen keineswegs mit ihrem Körpergewicht zufrieden. Ganz im Gegenteil, das Schlankheitsideal diktiert zu mindest in den westlichen Industrienationen die Essgewohnheiten in großem Maße.1
In Modemagazinen und Zeitungen werden Frauen präsentiert, deren Gewicht teilweise weit unter dem Normalbereich liegt. Es wird sugeriert, dass Glück, vollkommene Zufriedenheit, Erfolg und Coolness mit den idealen Körpermaßen verbunden seien. Das Frankfurter Zentrum für Essstörungen hat in einer repräsentativen Befragung herausgefunden, dass bereits rund 75 % der Frauen im Laufe ihres Lebens mindestens eine Diät gemacht haben. Andererseits bringen 95 % der Diäten nicht den gewünschten Erfolg. Bringen wiederholte Abmagerungskuren und Diäten nicht den gewünschten Erfolg, werden weitere Maßnahmen ergriffen, um eine Gewichtsregulierung zu erzielen. Dazu gehören Abführmittel (Laxanthien), Entwässerungs-Medikamente (Diuretika), willentliches Erbrechen und exzessive sportliche Betätigung. Als Auslöser für die Entstehung von Essstörungen werden neben den bisher genannten soziokulturellen Faktoren auch biologische, individuelle und familienbezogene Faktoren benannt.1 Es stellt sich also die Frage, wie man der Entwicklung einer Essstörung entgegenwirken kann; wie man erkennt, dass eine Person unter einer Essstörung leidet und welche Hilfsmöglichkeiten es für Betroffene gibt. Dazu sind natürlich weitreichende Kenntnisse über Erscheinungsformen, Symptome, Einflussfaktoren und Behandlungsmöglichkeiten erforderlich.
Bei manifesten Essstörungen dreht sich der gesamte Alltag der Betroffenen nur ums Essen. Die Nahrungsaufnahme dient der Befriedigung von Bedürfnissen und hat nichts mehr mit Ernährung zu tun.
Erscheinungsformen von Essstörungen sind häufig nicht klar voneinander abzugrenzen. Zum Beispiel können sowohl Mager- als auch Esssüchtige ihr Essen erbrechen und aus Magersüchtigen können Esssüchtige werden und umgekehrt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erscheinungsformen der Essstörungen
- 2.1 Allgemeine Betrachtungen
- 2.2 Anorexia nervosa (AN)
- 2.2.1 Diagnosekriterien der AN nach ICD-10/DSM-IV
- 2.2.2 Prävalenz der AN
- 2.2.3 Erkrankungsgipfel der AN
- 2.2.4 Ätiologie der AN
- 2.2.5 Weitere mit der AN verbundene Störungen
- 2.2.6 Medizinische Folgen der AN
- 2.2.7 Prognose der AN
- 2.3 Bulimia nervosa (BN)
- 2.3.1 Diagnosekriterien der BN nach ICD-10/DSM-IV
- 2.3.2 Prävalenz der BN
- 2.3.3 Erkrankungsgipfel der BN
- 2.3.4 Ätiologie der BN
- 2.3.5 Verlauf und Prognose der BN
- 2.3.6 Medizinische Begleiterscheinungen und Folgeprobleme der BN
- 2.4 Binge-Eating-Disorder (Ess-Sucht)
- 2.4.1 Diagnosekriterien der Ess-Sucht nach DSM-IV
- 2.4.2 Prävalenz der Ess-Sucht
- 2.4.3 Erkrankungsgipfel der Ess-Sucht
- 2.4.4 Folgeerscheinungen der Ess-Sucht
- 2.5 EDNOS (atypische, nicht näher klassifizierte Essstörungen)
- 2.5.1 Diagnosekriterien der EDNOS nach DSM-IV
- 2.5.2 Prävalenz der EDNOS
- 3. Detailierte Betrachtungen am Beispiel der Anorexia nervosa
- 3.1 Welche Zusammenhänge gibt es zwischen verschiedenen Einflussfaktoren und der Anorexia nervosa?
- 3.1.1 Die Familiestruktur
- 3.1.2 Gesellschaftliche Einflüsse
- 3.2 Lebenswelten von Magersüchtigen
- 3.3 Auslösende Ereignisse
- 3.4 Therapiemöglichkeiten
- 3.4.1 Nahrungszufuhr
- 3.4.2 Pharmakotherapie
- 3.4.3 Methoden der Psychotherapie
- 3.5 Klinisches Therapiekonzept der Kinder- und Jugendpsychiatrie Aachen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Essstörungen, insbesondere Anorexia nervosa, im Kontext gesellschaftlicher Einflüsse und verfügbarer Therapiemöglichkeiten. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Erscheinungsformen von Essstörungen und deren Auswirkungen auf die Betroffenen.
- Definition und Klassifizierung verschiedener Essstörungen (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge-Eating-Disorder, EDNOS)
- Analyse der gesellschaftlichen und familiären Faktoren, die zur Entstehung von Essstörungen beitragen können
- Beschreibung der Lebenswelten von Menschen mit Essstörungen
- Übersicht und Bewertung verschiedener Therapieansätze
- Vorstellung eines klinischen Therapiekonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, beginnend mit Statistiken zu Übergewicht in den 1990er Jahren und dem damit verbundenen gesellschaftlichen Druck, schlank zu sein. Sie führt das Thema Essstörungen ein und begründet die Notwendigkeit, Erscheinungsformen, Symptome, Einflussfaktoren und Behandlungsmöglichkeiten zu untersuchen. Der Fokus liegt auf dem Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Schlankheitsideal und den daraus resultierenden Problemen, inklusive der Entwicklung von Essstörungen.
2. Erscheinungsformen der Essstörungen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Essstörungen, einschließlich Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge-Eating-Disorder und EDNOS. Für jede Störung werden Diagnosekriterien, Prävalenz, Erkrankungsgipfel, Ätiologie, Verlauf, Prognose und medizinische Folgen detailliert beschrieben. Die Überschneidungen und die Komplexität der Diagnostik werden hervorgehoben. Das Kapitel betont die Vielschichtigkeit der Problematik und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
3. Detailierte Betrachtungen am Beispiel der Anorexia nervosa: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Anorexia nervosa. Es untersucht die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Einflussfaktoren wie Familiensituation und gesellschaftlichen Erwartungen und der Entwicklung der Erkrankung. Die Lebenswelten von Magersüchtigen werden beleuchtet, auslösende Ereignisse diskutiert und verschiedene Therapiemöglichkeiten, einschließlich Ernährungsumstellung, Pharmakotherapie und Psychotherapie, vorgestellt. Abschließend wird ein konkretes klinisches Therapiekonzept präsentiert. Der Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Betrachtung der Erkrankung und deren komplexen Ursachen und Behandlungsansätzen.
Schlüsselwörter
Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge-Eating-Disorder, EDNOS, Ätiologie, Prävalenz, Therapiemöglichkeiten, Psychotherapie, Gesellschaftliche Einflüsse, Familiäre Faktoren, Körperbild, Schlankheitsideal.
Häufig gestellte Fragen zu: Essstörungen - Eine umfassende Betrachtung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Essstörungen. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf Anorexia nervosa, aber auch Bulimia nervosa, Binge-Eating-Disorder und EDNOS werden behandelt.
Welche Essstörungen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge-Eating-Disorder (Ess-Sucht) und EDNOS (atypische, nicht näher klassifizierte Essstörungen). Für jede Störung werden Diagnosekriterien, Prävalenz, Erkrankungsgipfel, Ätiologie, Verlauf, Prognose und medizinische Folgen erläutert.
Welche Aspekte der Anorexia nervosa werden detailliert betrachtet?
Das Kapitel über Anorexia nervosa untersucht die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Einflussfaktoren (Familiensituation, gesellschaftliche Erwartungen) und der Entstehung der Erkrankung. Es beleuchtet die Lebenswelten von Betroffenen, diskutiert auslösende Ereignisse und stellt verschiedene Therapiemöglichkeiten (Ernährungsumstellung, Pharmakotherapie, Psychotherapie) vor. Ein klinisches Therapiekonzept wird ebenfalls vorgestellt.
Welche gesellschaftlichen und familiären Faktoren werden untersucht?
Die Arbeit analysiert gesellschaftliche Einflüsse, wie das Schlankheitsideal, und familiäre Faktoren, die zur Entstehung von Essstörungen beitragen können. Der Einfluss der Familiensituation auf die Entwicklung von Anorexia nervosa wird speziell untersucht.
Welche Therapiemöglichkeiten werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Therapiemöglichkeiten für Essstörungen, darunter Ernährungsumstellung, Pharmakotherapie und verschiedene Methoden der Psychotherapie. Ein konkretes klinisches Therapiekonzept wird am Beispiel der Kinder- und Jugendpsychiatrie Aachen vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge-Eating-Disorder, EDNOS, Ätiologie, Prävalenz, Therapiemöglichkeiten, Psychotherapie, Gesellschaftliche Einflüsse, Familiäre Faktoren, Körperbild, Schlankheitsideal.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptkapitel gegliedert: Einleitung, Erscheinungsformen der Essstörungen und Detailierte Betrachtungen am Beispiel der Anorexia nervosa. Jedes Kapitel wird detailliert zusammengefasst.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit Essstörungen. Sie ist gedacht für Personen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen wollen.
- Arbeit zitieren
- Nicole Mösch (Autor:in), 2004, Essstörungen im Blickfeld - Lebenswelten und Therapiemöglichkeiten am Beispiel der Anorexia nervosa, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79081