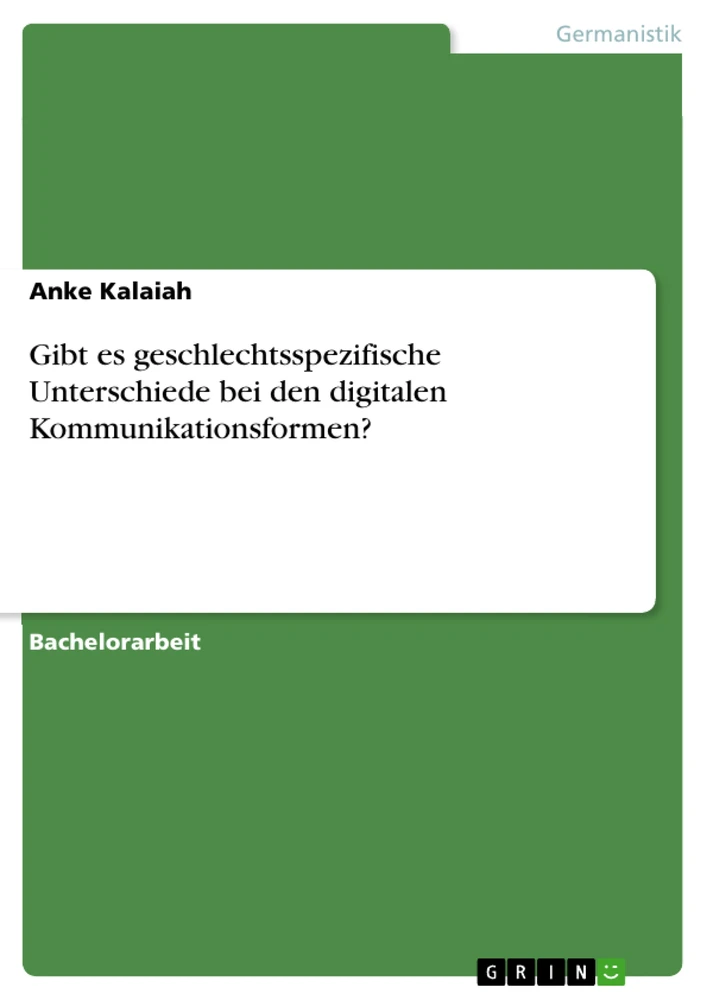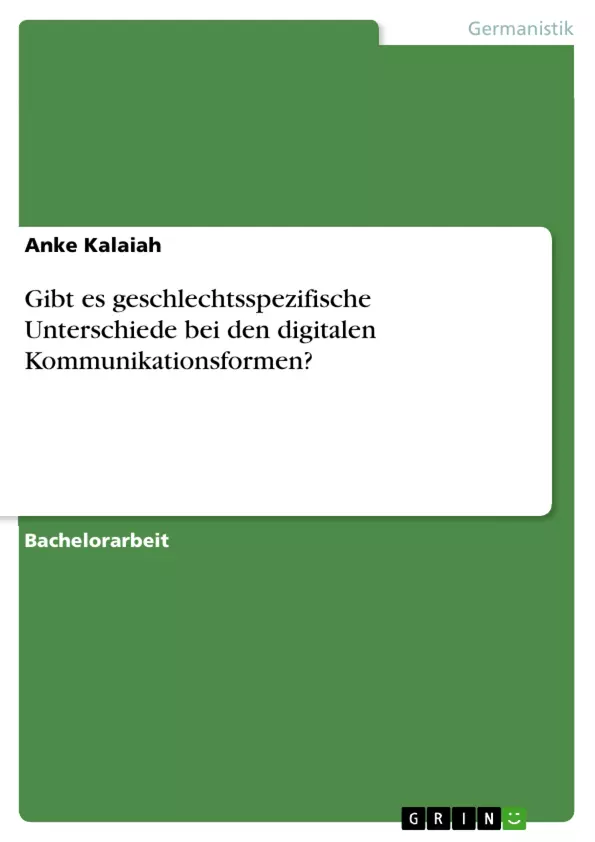Nur wenige technische Errungenschaften der letzten Jahrzehnte haben unser Leben in praktisch allen Aspekten so grundlegend verändert, wie die Erfindung des Internets und damit verbunden die der neuen digitalen Kommunikationsmittel. Nahezu alles ist möglich: länderübergreifend neue Kontakte knüpfen, mit alten Bekannten kommunizieren, Nachrichten verschicken innerhalb weniger Sekunden; es gibt keine zeitlichen oder räumlichen Grenzen und die Welt scheint nur einen Mausklick von uns entfernt. Trotzdem bleibt die digitale Kommunikation immer nur eine virtuelle Kommunikation. Der Kontakt, den man während dessen ausübt, und das sinnliche Erleben des Gesprächs sind auf das Medium des Computers beschränkt und der Gesprächspartner in seiner Gesamtheit bleibt im Hintergrund.
Darüber, welche Art von Konsequenzen sich aus diesen völlig neuen Kommunikationsbedingungen für unser soziales Miteinander ergeben, existieren viele unterschiedliche Ansichten. Es gibt die Optimisten, welche die große Freiheit propagieren und die aus den kommunikativen Defiziten heraus entstandenen sprachlichen Mittel - wie Emoticons als Ersatz für Nonverbales - als Zugewinn an neuen Gesprächsstrategien feiern. Gleichzeitig gibt es die Skeptiker und Pessimisten, die bereits den Verfall der Sprache und Kultur durch Yahoo, MSN & Co eingeläutet sehen. Die einen hängen der Egalitätshypothese nach und sehen ihr Ideal der absoluten Gleichheit durch Anonymität verwirklicht und die anderen weisen darauf hin, dass etablierte soziale und gesellschaftliche Grenzen auch vor dem Internet nicht halt machen. Welcher Meinung auch immer man sich anschließen möchte, muss man auf jeden Fall zugeben, dass die Internet-Sprache ein wichtiger Gegenstand der linguistischen Forschung geworden ist – heute vielleicht wichtiger denn je.
Inhalt der vorliegenden Arbeit sind die genderspezifischen Aspekte der Kommunikation im Chat. Sie liefert zunächst einen Gesamtüberblick über relevante Vertreter der feministischen Gesprächsforschung und deren theoretische Ansätze. Dabei soll geklärt werden, was sich hinter dem Begriff „Frauensprache“ verbirgt und inwieweit Strategien der bisher hauptsächlich auf mündliche Gespräche beschränkten linguistischen Gesprächsanalyse überhaupt auf die Chat-Kommunikation übertragbar sind. Im weiteren Verlauf wird eine empirische Studie vorgestellt, die die Chat-Sequenzen von Männern und Frauen anhand bestimmter chat-typischer Stilmerkmale sowohl quantitativ als auch qualitativ untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 0. EINLEITUNG
- 1. GESCHLECHTERSOZIALISATION
- 1.1 Geschlechtsrollen
- 1.2 Geschlechtsrollenstereotype
- 2. GESCHLECHTSSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE IM SPRACHLICHEN VERHALTEN
- 2.1 Gibt es eine „Frauensprache\" und welchen Stellenwert hat sie?
- 2.1.1 Verschiedene Untersuchungen und Positionen
- 2.1.2 Hypothesen zum weiblichen Sprachverhalten
- 2.2 Merkmale des weiblichen Gesprächsstils
- 2.2.1 Mittel der Gesprächsarbeit
- 2.2.2 Abschwächungen
- 2.2.3 Wortschatz
- 2.3 Merkmale des männlichen Gesprächsstils
- 2.3.1 Mittel der Gesprächskontrolle
- 3. DIE KOMMUNIKATION IM CHAT
- 3.1 Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit
- 3.2 Gender und Chat
- 3.3 Sprachliche Konventionen bei der Chat-Kommunikation
- 3.3.1 Emoticons
- 3.3.2 Akronyme
- 3.3.3 ASCII-Kunst
- 3.3.4 Soundwörter
- 3.3.5 Aktionswörter
- 3.3.6 Emoting- Äußerungen in der dritten Person
- 3.3.7 Disclaimer
- 4. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ZUR CHAT-KOMMUNIKATION
- 4.1 Methoden
- 4.1.1 Beschreibung des Materials
- 4.1.2 Die Gesprächsanalyse
- 4.2 Arbeitshypothesen
- 4.3 Empirische Ergebnisse
- 4.3.1 Quantitativer Teil
- 4.3.2 Qualitativer Teil
- 4.4 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
- 4.5 Schlusswort und Anregungen für neue Untersuchungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob sich die Anonymität der digitalen Kommunikation auf das sprachliche Verhalten von Männern und Frauen auswirkt und ob es trotz der Anonymität geschlechtsspezifische Unterschiede in Chat-Gesprächen gibt.
- Geschlechtersozialisation und Geschlechtsrollen
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im mündlichen Sprachverhalten
- Sprachliche Konventionen in Chat-Kommunikation
- Empirische Untersuchung von Chat-Kommunikation
- Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der digitalen Kommunikation im heutigen Alltag und die unterschiedlichen Perspektiven auf ihre Auswirkungen beleuchtet. Anschließend wird die Geschlechtersozialisation und ihre Rolle bei der Entwicklung von Geschlechtsrollen und Stereotypen erläutert. Im zweiten Kapitel werden geschlechtsspezifische Unterschiede im mündlichen Sprachverhalten von Frauen und Männern untersucht, wobei verschiedene Thesen zur „Frauensprache“ und die Merkmale des weiblichen und männlichen Gesprächsstils im Vordergrund stehen. Kapitel 3 widmet sich dem Medium des Chats und erklärt die Besonderheiten der Chat-Kommunikation im Vergleich zur mündlichen Face-to-Face-Kommunikation. Das vierte Kapitel präsentiert eine empirische Studie, die das Verhalten von Usern im Chat anhand eines Chat-Korpus der Universität Dortmund untersucht. Die Arbeit endet mit einer Diskussion und Interpretation der empirischen Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen und Anregungen für weitere Untersuchungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Geschlechterunterschiede, digitale Kommunikation, Chat, Sprachverhalten, Geschlechtersozialisation, Gesprächsstyles, Emoticons, Akronyme, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen zu Geschlechterunterschieden in der digitalen Kommunikation
Gibt es sprachliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Chat?
Ja, Studien zeigen, dass trotz der Anonymität des Internets geschlechtsspezifische Stilmerkmale und Gesprächsstrategien aus der mündlichen Kommunikation in den Chat übertragen werden.
Was versteht man unter dem Begriff "Frauensprache"?
In der feministischen Linguistik werden damit Merkmale wie häufigere Abschwächungen, ein spezifischer Wortschatz und ein kooperativerer Gesprächsstil assoziiert.
Wie nutzen die Geschlechter Emoticons im Chat?
Emoticons dienen oft als Ersatz für nonverbale Signale. Untersuchungen analysieren, ob Frauen diese häufiger zur Beziehungsarbeit einsetzen als Männer.
Was kennzeichnet den männlichen Gesprächsstil?
Der männliche Stil wird oft als kompetitiver beschrieben, mit einem stärkeren Fokus auf Mittel der Gesprächskontrolle und Informationsvermittlung.
Führt die Anonymität im Internet zu mehr Gleichheit (Egalitätshypothese)?
Während Optimisten glauben, dass Anonymität soziale Grenzen auflöst, weisen Skeptiker darauf hin, dass etablierte Geschlechtsrollen auch im virtuellen Raum bestehen bleiben.
Was sind typische Chat-Konventionen?
Dazu gehören Akronyme (z.B. LOL), Soundwörter, Aktionswörter (Inflektive) und Emoting-Äußerungen in der dritten Person.
- Quote paper
- Anke Kalaiah (Author), 2007, Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei den digitalen Kommunikationsformen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79085