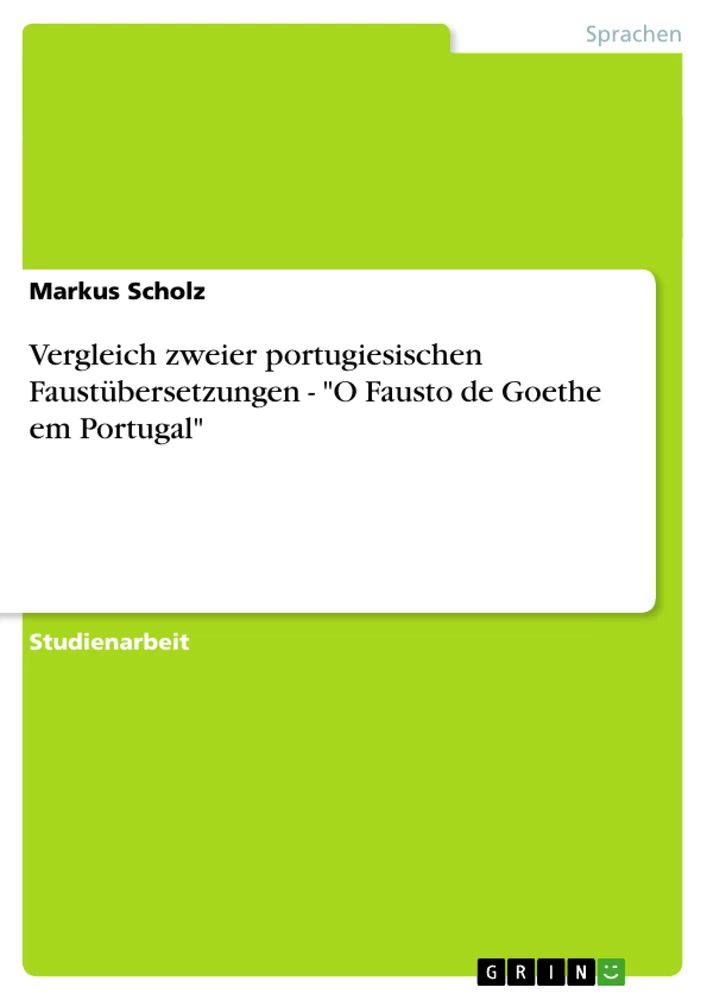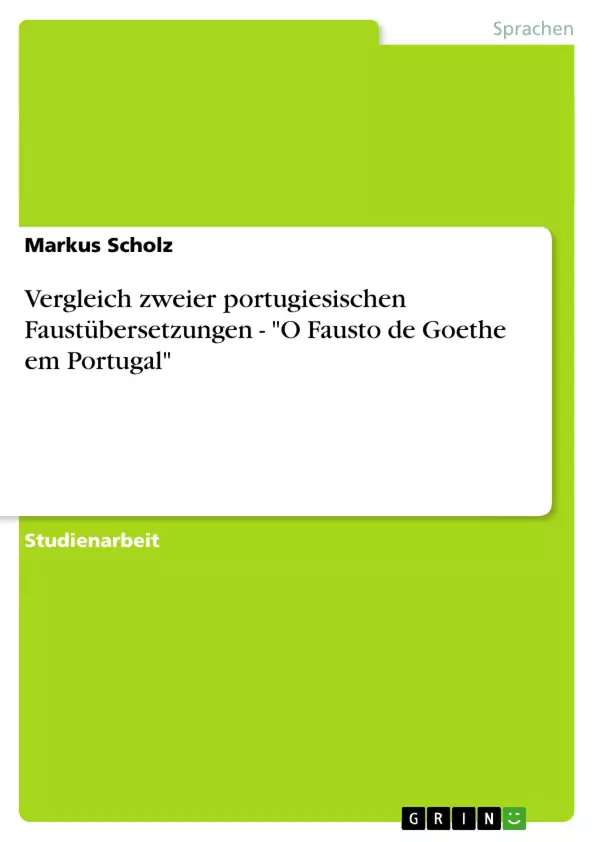In dieser Arbeit werden zwei portugiesische Übersetzungen von Goethes Faust miteinander verglichen –eine aus dem Jahr 1867, die andere von 1999. Die aus dem Bereich der historisch-deskriptiven Übersetzungsforschung stammende Polysystemtheorie dient hierzu als theoretische Grundlage. In einem ersten Analyseschritt werden die Charakteristika der portugiesischen Literatur in der zweiten Hälfte des 19. Jh. und gegen Ende des 20. Jh. erörtert, wobei auch die Frage nach der Rolle von Übersetzungen aus anderen Sprachen allgemein behandelt wird. Im zweiten großen Schritt der Analyse werden die beiden Übersetzer, das, was sie selbst zu ihren Übersetzungen sagten, und die Aufnahme ihrer Arbeiten durch die portugiesische Öffentlichkeit besprochen. Der dritte Analyseschritt betrifft die Übersetzungen als konkrete Texte: die Umsetzung von Goethes vielfältiger Verssprache und der Umgang mit Namen, Anredeformen und Personenbezeichnungen. Dabei geht es allgemein um die Frage, wie beide Übersetzer mit Form und Inhalt und wie sie mit der kulturellen Fremdheit des Originals in ihren jeweiligen Übersetzungen umgegangen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie und Methodik
- Theoretischer Rahmen
- Methodik
- Das literarische Polysystem Portugals in der zweiten Hälfte des 19. Jh. und gegen Ende des 20. Jh.
- Portugiesische Literatur
- Die Rolle von Übersetzungen
- Frage nach der Rezeption deutscher Literatur in Portugal
- Die Übersetzer und ihre Übersetzungen
- Die Übersetzer
- Aussagen der Übersetzer über ihre Übersetzungen
- Die Übersetzungen in der Zielliteratur 1867/1999
- Analyse der Textbeispiele
- Verse und Übersetzung
- Namen, Anredeformen Personenbezeichnungen und Übersetzung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert zwei Übersetzungen von Goethes Faust ins Portugiesische, um Übersetzungskonzeptionen zu vergleichen und kulturspezifische Erkenntnisse über Portugal zu gewinnen. Sie konzentriert sich auf die Übersetzungen von Agostinho d'Ornellas (1867/1873) und João Barrento (1999), analysiert die portugiesische Literatur und die Rezeption deutscher Literatur in Portugal während der Entstehung der Übersetzungen und untersucht die Übersetzer sowie ihre Werke. Die Arbeit befasst sich außerdem mit der Umsetzung von Verssprache und Namen sowie Anredeformen in den Übersetzungen.
- Übersetzungskonzeptionen im Vergleich
- Kulturspezifische Erkenntnisse über Portugal
- Rezeption deutscher Literatur in Portugal
- Analyse der Übersetzungen im Kontext der portugiesischen Literatur
- Untersuchung der Übersetzungsstrategie von Verssprache, Namen und Anredeformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Arbeit vor und erläutert die Forschungsmethode. Kapitel 2 beschreibt den theoretischen Rahmen, der auf der Polysystemtheorie basiert. Kapitel 3 analysiert das literarische Polysystem Portugals im 19. und 20. Jahrhundert und die Rezeption deutscher Literatur in Portugal. Kapitel 4 befasst sich mit den Übersetzern, ihren Aussagen zu ihren Übersetzungen und der Aufnahme ihrer Werke in der portugiesischen Öffentlichkeit. Kapitel 5 untersucht die Übersetzungen selbst, speziell die Umsetzung der Verssprache und der Namen, Anredeformen und Personenbezeichnungen. Abschließend fasst die Arbeit die Ergebnisse zusammen und interpretiert sie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich von zwei Übersetzungen von Goethes Faust ins Portugiesische, der Polysystemtheorie, der portugiesischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert, der Rezeption deutscher Literatur in Portugal, Übersetzungsstrategien, Verssprache, Namen, Anredeformen und Personenbezeichnungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Faust-Übersetzungen werden in der Arbeit verglichen?
Verglichen werden die portugiesischen Übersetzungen von Agostinho d'Ornellas (1867) und João Barrento (1999).
Was ist die Polysystemtheorie in der Übersetzungsforschung?
Es ist ein theoretischer Rahmen, der Literatur als System betrachtet und untersucht, welche Rolle Übersetzungen innerhalb der Zielkultur spielen.
Wie unterschieden sich die Übersetzungsstrategien von 1867 und 1999?
Die Arbeit analysiert, wie unterschiedlich mit Goethes Verssprache, kultureller Fremdheit und Personennamen umgegangen wurde.
Welche Rolle spielte deutsche Literatur im Portugal des 19. Jahrhunderts?
Die Arbeit untersucht die Rezeption und den Einfluss deutscher Werke auf das literarische Polysystem Portugals in dieser Epoche.
Wie werden Namen und Anreden in den Übersetzungen behandelt?
Es wird analysiert, ob die Übersetzer die Namen beibehalten oder an portugiesische Konventionen angepasst haben, um die kulturelle Distanz zu überbrücken.
Wer sind die Autoren der untersuchten Übersetzungen?
Agostinho d'Ornellas vertritt die klassische Rezeption des 19. Jahrhunderts, während João Barrento ein bedeutender moderner Übersetzer deutscher Literatur ist.
- Arbeit zitieren
- Markus Scholz (Autor:in), 2006, Vergleich zweier portugiesischen Faustübersetzungen - "O Fausto de Goethe em Portugal" , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79086