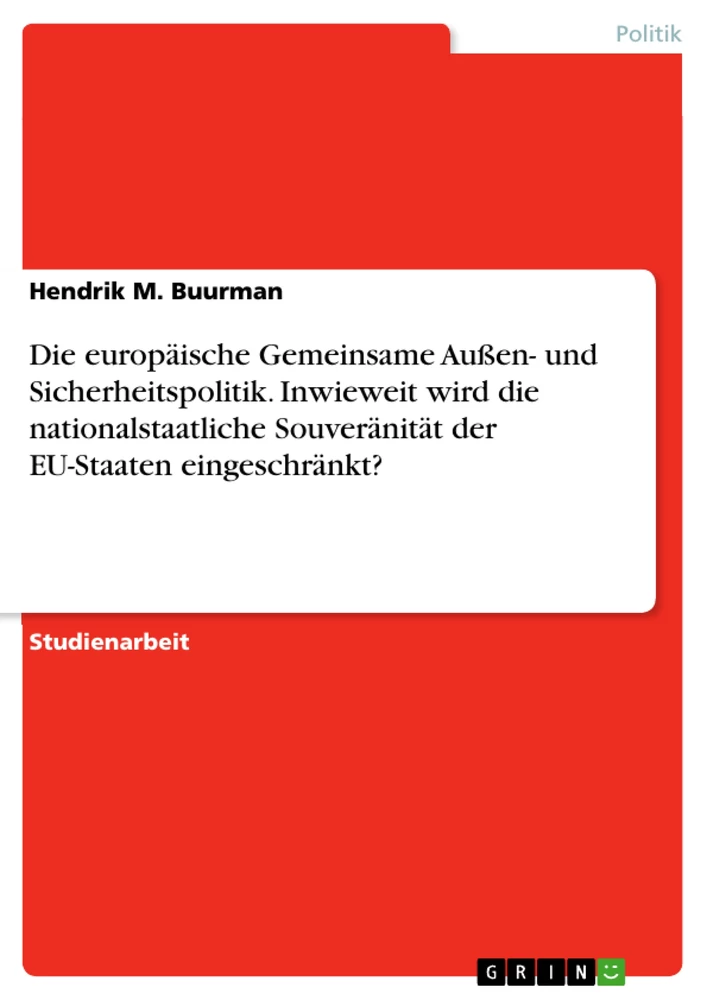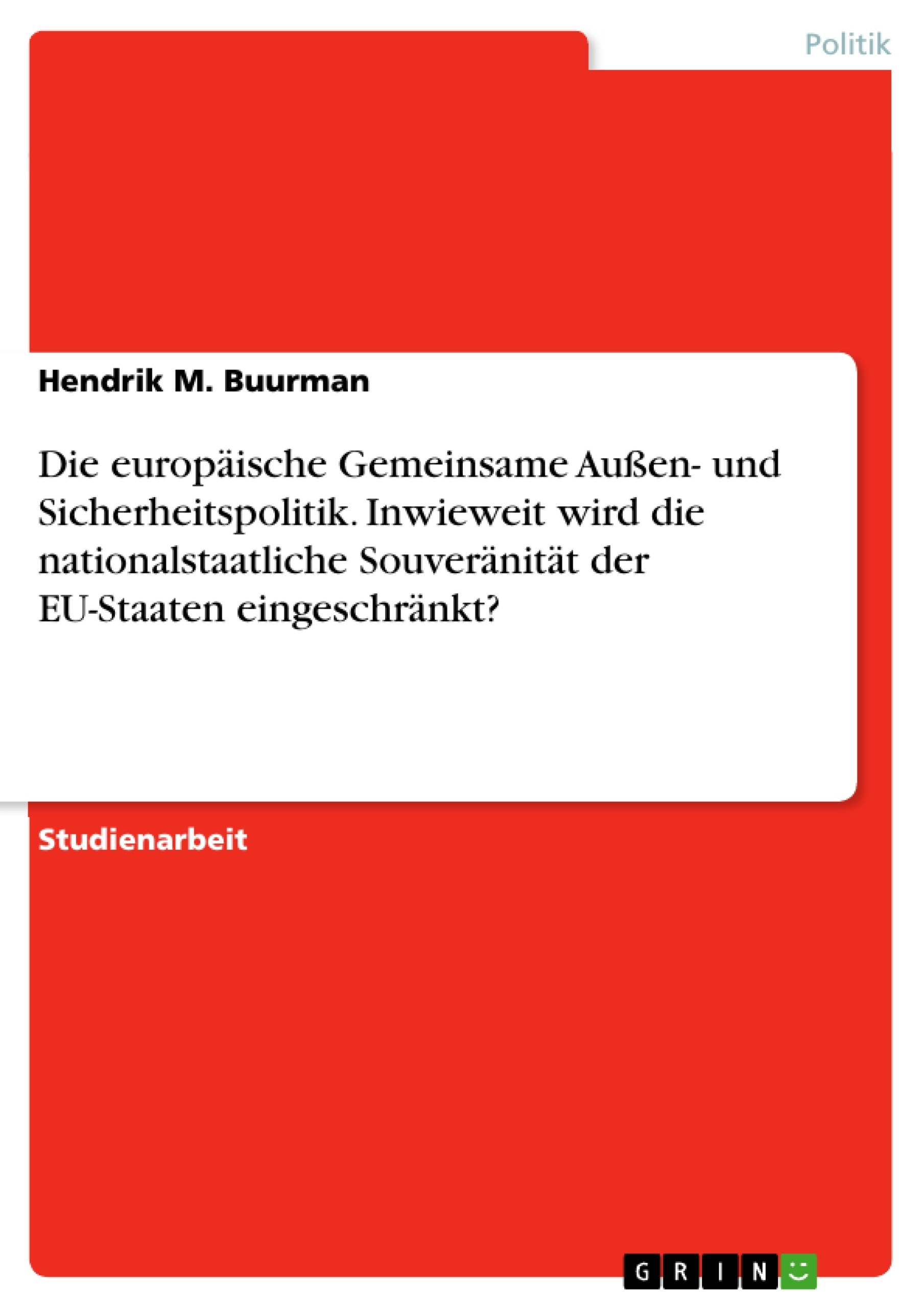Nach Abschluß der Verhandlungen von Maastricht stand mit Beginn des Jahres 1992 Europa an der Schwelle zu einer neuen Qualität der Beziehungen der Staaten untereinander. Das sollte auch seinen Niederschlag in einer intensivierten Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik finden, die fortan als „zweite Säule“ zwischen der bisherigen Europäischen Gemeinschaft (bestehend aus EGKS-Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EAG-Europäischer Atomgemeinschaft und EWG-Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) und der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, die zur Europäischen Union erweiterte Gemeinschaft mittragen soll.
Darüber hinaus sind Sicherheits- und Außenpolitik nahezu die schwierigsten Felder für eine Kooperation unter eigenständigen Nationen. Denn sie berühren direkt und unübersehbar die nationale Souveränität. Hier müssen spezielle historische Traditionen, länderspezifische Befindlichkeiten sowie die öffentliche Meinung in den Teilnehmerstaaten berücksichtigt werden.
Das größte Manko in der GASP besteht somit bis zum heutigen Tage in der fehlenden Bereitschaft der Staaten, nationale Hoheitsrechte an eine supranationale Institution innerhalb der EU abzugeben. Doch ist diese Diagnose augenscheinlich abhängig vom Standpunkt des jeweiligen Betrachters - die Nationalstaaten beispielsweise, die durch ihre Stimme im Rat die GASP in letzter Instanz dominieren, sind für eine weitergehende Abtretung von Souveränitätsrechten an die EU-Ebene nur schwer zu gewinnen.
Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick der institutionellen Ausformungen der GASP bieten sowie deren Stärken und Schwächen benennen. Es wird die Frage behandelt, ob, und wenn ja, welche Einschränkungen ihrer Souveränität die Nationalstaaten trotz des weitgehend intergouvernementalen Charakters der GASP durch die Partizipation erfahren, und wie mit diesen umgegangen wird.
Einleitend wird ein historischer Rückblick über die Motive und die Entwicklung eines europäisch koordinierten Außenhandelns gegeben. Im Anschluß werden die wichtigsten Instrumente der GASP kurz erläutert und entscheidende Innovationen nach Maastricht und Amsterdam dargestellt. Im Hauptteil wird anhand des Beispiels der Gemeinsamen Aktion die völkerrechtliche Wirkungslosigkeit von Teilbereichen der GASP aufgezeigt und auf das europäische Mehrebenensystem, ein „System geteilter Souveränitäten“, eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vorgeschichte der GASP als EPZ
- Die außenpolitischen Strukturen nach den Verträgen Maastricht und Amsterdam
- Der Gemeinsame Standpunkt
- Die Gemeinsame Aktion
- Die Gemeinsame Strategie
- Die Erklärungen
- Fazit zu den außenpolitischen Strukturen
- Einschränkungen nationaler Souveränität durch die GASP?
- Die Gemeinsame Aktion als völkerrechtliches Instrument
- Die Mehrdimensionalität der europäischen Außenpolitik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europäischen Union (EU) und analysiert, inwieweit die Partizipation an der GASP zu Einschränkungen der nationalen Souveränität der EU-Staaten führt. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob und in welchem Umfang die EU-Staaten bereit sind, nationale Hoheitsrechte an eine supranationale Institution abzugeben.
- Historische Entwicklung der GASP
- Institutionelle Strukturen der GASP
- Einschränkungen nationaler Souveränität durch die GASP
- Die Mehrdimensionalität der europäischen Außenpolitik
- Das europäische Mehrebenensystem und die „geteilten Souveränitäten“
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung erläutert die Bedeutung der GASP vor dem Hintergrund der europäischen Integration und stellt die Forschungsfrage der Arbeit dar.
- Die Vorgeschichte der GASP als EPZ: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) als Vorläufer der GASP. Es werden die Motive, die Ziele und die wichtigsten Schritte der EPZ-Entwicklung dargestellt.
- Die außenpolitischen Strukturen nach den Verträgen Maastricht und Amsterdam: Hier werden die wichtigsten Instrumente der GASP, wie der Gemeinsame Standpunkt, die Gemeinsame Aktion und die Gemeinsame Strategie, im Detail vorgestellt. Besonderes Augenmerk liegt auf den Veränderungen der Strukturen im Zuge der europäischen Integration.
- Einschränkungen nationaler Souveränität durch die GASP?: Dieses Kapitel widmet sich der Frage nach den Auswirkungen der GASP auf die nationale Souveränität der EU-Staaten. Anhand des Beispiels der Gemeinsamen Aktion werden die völkerrechtlichen Aspekte der GASP beleuchtet.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ), nationale Souveränität, Gemeinsame Aktion, völkerrechtliches Instrument, europäisches Mehrebenensystem, „System geteilter Souveränitäten“, Maastricht-Vertrag, Amsterdam-Vertrag.
- Citation du texte
- Hendrik M. Buurman (Auteur), 2002, Die europäische Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Inwieweit wird die nationalstaatliche Souveränität der EU-Staaten eingeschränkt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79092