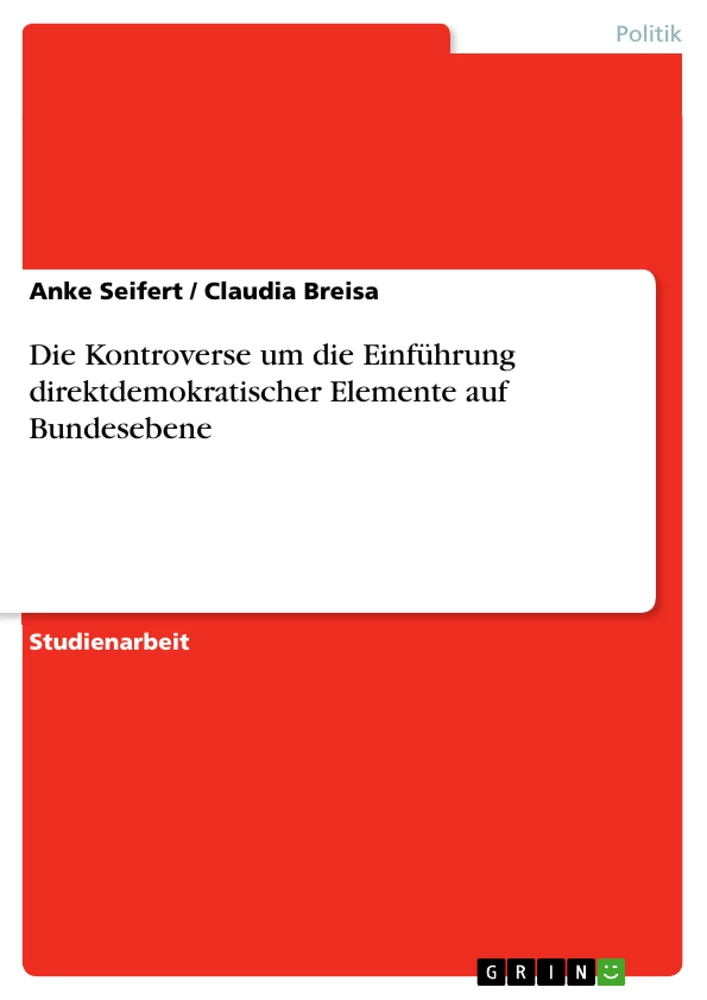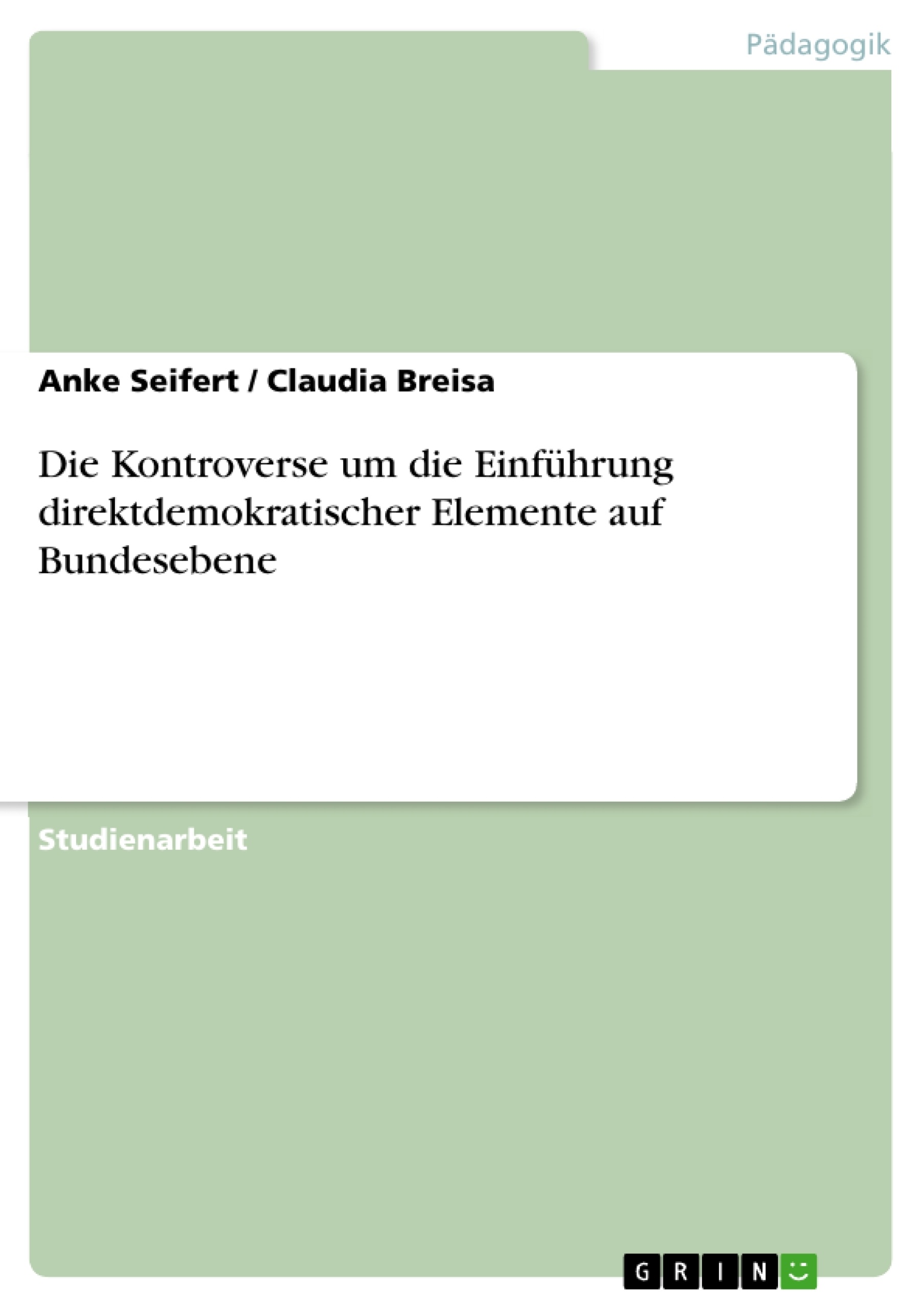Die Form der repräsentativen Demokratie „liegt als verfassungspolitische Maxime den meisten politischen Systemen der westlichen Demokratie zugrunde.“
Gerade in Deutschland nimmt die Politikverdrossenheit der Bevölkerung immer weiter zu. Eine Möglichkeit, dem entgegen zu wirken, scheint die Einführung direktdemokratischer Instrumente auf Bundesebene zu sein. „Da direktdemokratische Verfahren die Entscheidungsbefugnis in die Stimmbürgerarena verlagern“ , werden die wahlberechtigten Bürger motiviert, sich aktiv am politischen Entscheidungsprozess zu beteiligen und so die Blockadetendenzen des Parteiensystems aufzulockern. Dieses tendiert erfahrungsgemäß dazu, sich wenige Machtbeschränkungen aufzuerlegen.
In Deutschland existiert eine grundsätzliche Kontroverse über den Wert von direkter Demokratie, „über ihre demokratietheoretische Begründung, ihre Wünschbarkeit, Möglichkeit und ihre institutionelle Leistungsfähigkeit.“
In der wissenschaftlichen Diskussion beziehen die Befürworter der direkten Demokratie den Standpunkt, dass die Qualität des parlamentarischen Systems durch Volksentscheide erheblich verbessert werden könnte. Ihre Gegner argumentieren hauptsächlich dagegen, dass das deutsche Mehrebenensystem dafür zu komplex sei.
Obwohl plebiszitäre Elemente in die Verfassungen der Bundesländer Einzug fanden, wird auf Bundesebene das Grundgesetz als wichtiger Hinderungsgrund von den Gegnern der direkten Demokratie angeführt. Sie stützen sich dabei auf verschiedene Artikel des deutschen Grundgesetzes.
Daher wollen wir im nächsten Teil dieser Arbeit der Frage nachgehen, ob Plebiszite auf Bundesebene eindeutig am Grundgesetz scheitern oder nicht.
Als maßgebliche politische Akteure spielen die deutschen Parteien eine entscheidende Rolle. Anhand ihrer Parteiprogramme soll hier vorgestellt werden, wie sie Plebisziten auf Bundesebene gegenüberstehen.
Exemplarisch für diese Diskussion innerhalb Deutschlands und das Verhalten der Parteien wird in Teil III der letzte Reformversuch der rot-grünen Koalition (1998 - 2002) auf diesem Gebiet dargestellt. Dem vorangestellt ist eine kurze Übersicht über die möglichen direktdemokratischen Instrumente.
Anschließend werden wir die wichtigsten Argumente für und gegen die Einführung direktdemokratischer Elemente auf Bundesebene aufführen (Teile IV und V).
Dem folgt eine abschließende Zusammenfassung, in der wir auch unsere Erkenntnisse, die wir während unserer Auseinandersetzung mit diesem Thema gewonnen haben, beschreiben werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Grundgesetz und Parteien
- 1. Das Grundgesetz - Interpretation und Diskussion
- 2. Die deutschen Parteien und die direkte Demokratie
- III. Einführung der Volksgesetzgebung auf Bundesebene
- 1. Die Instrumente der direkten Demokratie
- 2. Ablauf des Reformversuchs 1998 - 2002
- IV. Argumente gegen den Volksentscheid auf Bundesebene
- V. Argumente für den Volksentscheid auf Bundesebene
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Kontroverse um die Einführung direktdemokratischer Elemente auf Bundesebene in Deutschland. Ziel ist es, die Argumente für und gegen die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene zu analysieren und zu bewerten, wobei die Rolle des Grundgesetzes, die Positionen der deutschen Parteien und der Verlauf des letzten Reformversuchs der rot-grünen Koalition (1998 - 2002) im Fokus stehen.
- Das Grundgesetz und die direkte Demokratie: Analyse der relevanten Artikel und deren Interpretation im Hinblick auf die Einführung von Volksentscheiden.
- Die Rolle der deutschen Parteien: Analyse ihrer Positionen und Programme im Hinblick auf die direkte Demokratie auf Bundesebene.
- Der Reformversuch 1998 - 2002: Darstellung des Abläufe und der Argumente für und gegen die Einführung von Volksgesetzgebung auf Bundesebene.
- Argumente gegen den Volksentscheid: Analyse der Kritikpunkte an der Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene.
- Argumente für den Volksentscheid: Analyse der Argumente, die für die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene sprechen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Kontroverse um die Einführung direktdemokratischer Elemente auf Bundesebene in Deutschland dar. Sie erläutert die zunehmende Politikverdrossenheit der Bevölkerung und die möglichen Vorteile von Volksentscheiden, um die politische Beteiligung zu fördern.
Kapitel II analysiert die Rolle des Grundgesetzes und der deutschen Parteien im Hinblick auf die direkte Demokratie. Es befasst sich mit der Interpretation des Grundgesetzes, insbesondere hinsichtlich der Artikel, die mit der Einführung von Volksentscheiden in Konflikt stehen könnten. Weiterhin wird die Position der deutschen Parteien im Hinblick auf die direkte Demokratie auf Bundesebene dargestellt.
Kapitel III geht auf die Einführung der Volksgesetzgebung auf Bundesebene ein. Es beschreibt die verschiedenen Instrumente der direkten Demokratie und erläutert den Ablauf des letzten Reformversuchs der rot-grünen Koalition (1998 - 2002) in diesem Bereich.
Kapitel IV und V präsentieren die Argumente gegen und für die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene. Die Argumente gegen den Volksentscheid konzentrieren sich vor allem auf die Komplexität des deutschen Mehrebenensystems und die potentiellen Risiken der direkten Demokratie. Die Argumente für den Volksentscheid betonen die Vorteile der direkten Demokratie in Bezug auf die politische Beteiligung und die Stärkung der Demokratie.
Schlüsselwörter
Direkte Demokratie, Volksentscheid, Grundgesetz, Parteien, Bundesebene, Reformversuch, Politikverdrossenheit, Repräsentative Demokratie, Mehrebenensystem, Argumente für und gegen den Volksentscheid, politische Beteiligung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird über direkte Demokratie auf Bundesebene gestritten?
Befürworter sehen darin ein Mittel gegen Politikverdrossenheit, während Gegner die Komplexität des parlamentarischen Systems und die Gefahr von Populismus anführen.
Steht das Grundgesetz Volksentscheiden auf Bundesebene im Weg?
Die Arbeit untersucht verschiedene Artikel des Grundgesetzes und zeigt auf, dass eine Einführung auf Bundesebene eine Verfassungsänderung erfordern würde.
Welche Parteien befürworten direktdemokratische Elemente?
Anhand von Parteiprogrammen wird analysiert, wie unterschiedlich Parteien wie die Grünen, die SPD oder die Union zu bundesweiten Volksentscheiden stehen.
Was war der Reformversuch der rot-grünen Koalition (1998-2002)?
Es war ein konkreter politischer Anlauf zur Einführung der Volksgesetzgebung auf Bundesebene, der jedoch letztlich an den erforderlichen Mehrheiten scheiterte.
Welche Instrumente der direkten Demokratie gibt es?
Dazu gehören die Volksinitiative, das Volksbegehren und schließlich der Volksentscheid.
- Quote paper
- Anke Seifert (Author), Claudia Breisa (Author), 2006, Die Kontroverse um die Einführung direktdemokratischer Elemente auf Bundesebene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79107