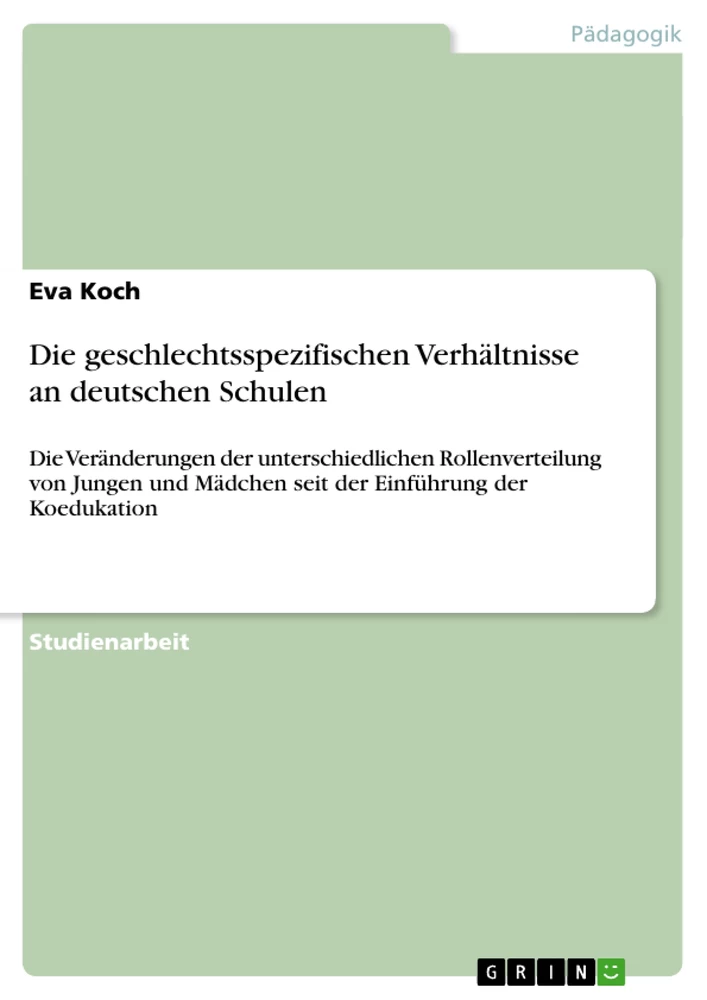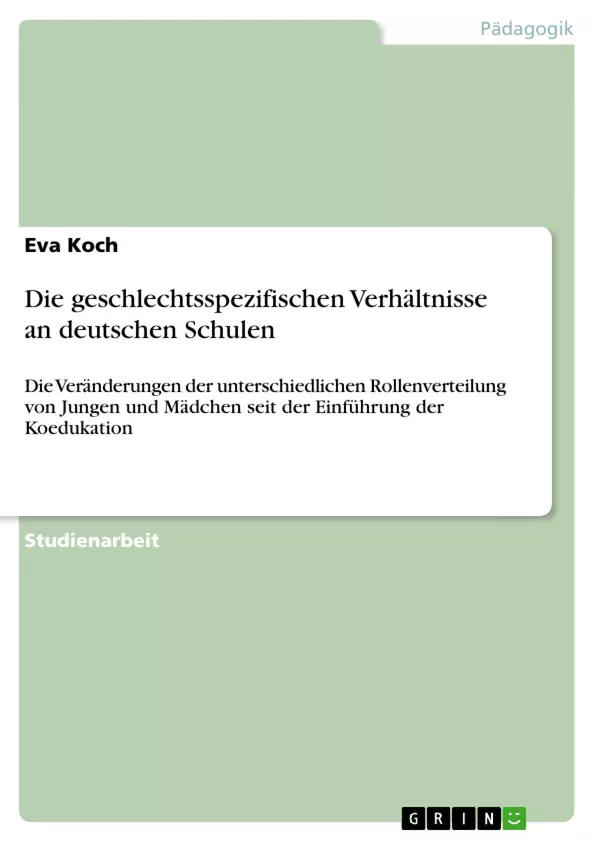Seit der Einführung der Mädchenbildung gab es vermehrt Diskussionen über Benachteiligungen der Geschlechter. Auch die preußischen Reformen 1908, die Frauen erstmals den Abitursabschluss ohne jegliche Hindernisse ermöglichte, veranlassten weitere Debatten. Einige Frauenrechtlerinnen beschwerten sich über die differenzierte Zusammenstellung des Lehrplans an Jungen- und Mädchenschulen. Für Frauen standen hauswirtschaftliche Fächer auf dem Lehrplan, wobei man naturwissenschaftliche oder mathematische Bereiche ausschloss. Ganz im Gegenteil zum „männlichen“ Lehrplan, bei dem naturwissenschaftliche Fächer als Schwerpunkte angelegt wurden. Dies war einer der Gründe für die Koedukation: Das Recht auf gleichberechtigte Bildung.
Jedoch bemühte man sich Mitte der 60er Jahre nicht um die Förderung der Geschlechter. Im Gegenteil: Die Einführung der Koedukation sollte den Bildungsnotstand beheben.
In dieser Hinsicht war die gemeinsame Unterrichtung der Geschlechter ein voller Erfolg, denn seitdem erreichen mehr Mädchen den Abitursabschluss oder schreiben im Durchschnitt bessere Noren. Der Erfolg der Frauen ist deutlich.
Doch warum gibt es seit den 80er Jahren einen erneuten Streit um die Koedukation? Weswegen beschließen sich die meisten Frauen nach dem Abitur nicht zu einem Hochschulstudium und weshalb interessieren sich die wenigsten Mädchen für eine berufliche Zukunft im naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich?
Welche negativen Folgen brachte die Koedukation, die vielleicht kaum beachtet wurden?
Mit dieser Arbeit möchte ich die geschlechtsspezifischen Verhältnisse in der Schule darstellen. Dazu ist es wichtig, einige Hintergründe der Mädchenbildung bis zur Zeit der Koedukationseinführung und der Debatte in den 80er Jahren, zu erläutern. Anschließend gehe ich näher auf die einzelnen Merkmale der Schule ein: Die unterschiedliche Rollenverteilung hängt mit dem Verhalten der Lehrer zusammen. Ebenfalls spielen die Schulbücher, der heimliche Lehrplan und die Gesellschaft dabei eine wichtige Rolle. Diese ganzen Einflüsse wirken sich auf das Denken und die Interessen der Kinder aus. Im darauffolgenden Kapitel beschreibe ich die Veränderungen und Ursachen der Schulleistungen seit der Einführung der Koedukation. Um dies zu vertiefen gehe ich auf die Ergebnisse der im Jahr 2000 durchgeführten PISA- Studie ein. Abschließend stelle ich kurz einen Praxisversuch vor, der erfolgreich auf die Stärken und Bedürfnisse der Geschlechter eingehen konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Die geschlechtsspezifischen Verhältnisse an deutschen Schulen
- Die Geschichte der Mädchenerziehung
- Der Beginn der Mädchenbildung
- Die Geschlechterverhältnisse an deutschen Schulen
- Die unterschiedliche Rollenverteilung
- Das Interesse der Schüler und Schülerinnen
- Der Einfluss der Schule und Lehrer auf die Geschlechter
- Der heimliche Lehrplan
- Die Darstellung der Geschlechter in Schulbüchern
- Lösungsvorschläge
- Geschlechterspezifische Schulleistungen
- Der Schulerfolg von Jungen und Mädchen
- Die PISA-Studie, eine Untersuchung der Schülerkompetenzen
- Untersuchungen aus der Praxis
- Das Beispiel der Hamburger Gesamtschule Bergedorf
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Die Entwicklung der Mädchenerziehung bis zur Einführung der Koedukation
- Die Auswirkungen der Koedukation auf die Rollenverteilung von Jungen und Mädchen
- Die Unterschiede im Lernverhalten und den Schulleistungen von Jungen und Mädchen
- Der Einfluss des Lehrplans und der Lehrkräfte auf die Geschlechterrollen in der Schule
- Beispiele aus der Praxis, die die geschlechtsspezifische Situation in der Schule beleuchten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die geschlechtsspezifischen Verhältnisse an deutschen Schulen und befasst sich mit den Veränderungen in der Rollenverteilung von Jungen und Mädchen seit der Einführung der Koedukation. Sie untersucht die Geschichte der Mädchenerziehung, die Auswirkungen der Koedukation auf das Lernverhalten und die Schulleistung beider Geschlechter und beleuchtet die Rolle von Schule und Lehrer dabei.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Geschichte der Mädchenerziehung in Deutschland und zeigt die Veränderungen im Laufe der Zeit auf, besonders im Hinblick auf die Einführung der Koedukation. Es werden die unterschiedlichen Lehrpläne für Jungen und Mädchen sowie die Debatten um die Gleichberechtigung in der Bildung behandelt.
Das zweite Kapitel widmet sich den geschlechtsspezifischen Verhältnissen an deutschen Schulen im Kontext der Koedukation. Es werden die unterschiedlichen Rollenverteilungen, die Interessen von Schülern und Schülerinnen, der Einfluss von Lehrern und Schule sowie der heimliche Lehrplan und die Darstellung von Geschlechtern in Schulbüchern analysiert.
Das dritte Kapitel behandelt die geschlechterspezifischen Schulleistungen und untersucht den Schulerfolg von Jungen und Mädchen im Kontext der Koedukation. Es werden die Ergebnisse der PISA-Studie herangezogen, um die Kompetenzen der Schüler zu analysieren.
Das vierte Kapitel stellt ein Praxisbeispiel vor, die Hamburger Gesamtschule Bergedorf, die erfolgreich auf die Stärken und Bedürfnisse der Geschlechter eingegangen ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert die geschlechtsspezifische Verhältnisse an deutschen Schulen, die Koedukation, die Mädchenerziehung, die Rollenverteilung von Jungen und Mädchen, die Schulleistung, der Einfluss von Schule und Lehrern, der heimliche Lehrplan, die PISA-Studie und Praxisbeispiele.
Häufig gestellte Fragen
Was war das ursprüngliche Ziel der Koedukation in Deutschland?
In den 60er Jahren diente die Einführung der Koedukation primär der Behebung des Bildungsnotstands und der Gewährleistung des Rechts auf gleichberechtigte Bildung.
Wie unterscheiden sich die Schulleistungen von Jungen und Mädchen heute?
Mädchen erreichen heute häufiger das Abitur und erzielen im Durchschnitt oft bessere Noten als Jungen.
Was versteht man unter dem „heimlichen Lehrplan“?
Damit sind unbewusste Botschaften und Rollenerwartungen gemeint, die durch das Verhalten von Lehrern, Schulbücher und die Schulorganisation vermittelt werden.
Warum wählen Mädchen seltener naturwissenschaftliche Berufe?
Dies wird oft auf traditionelle Rollenverteilungen, Einflüsse der Lehrer und die Darstellung der Geschlechter in Schulbüchern zurückgeführt.
Was zeigt das Beispiel der Hamburger Gesamtschule Bergedorf?
Es ist ein Praxisversuch, der zeigt, wie Schulen erfolgreich auf die spezifischen Stärken und Bedürfnisse beider Geschlechter eingehen können.
- Quote paper
- Eva Koch (Author), 2005, Die geschlechtsspezifischen Verhältnisse an deutschen Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79155