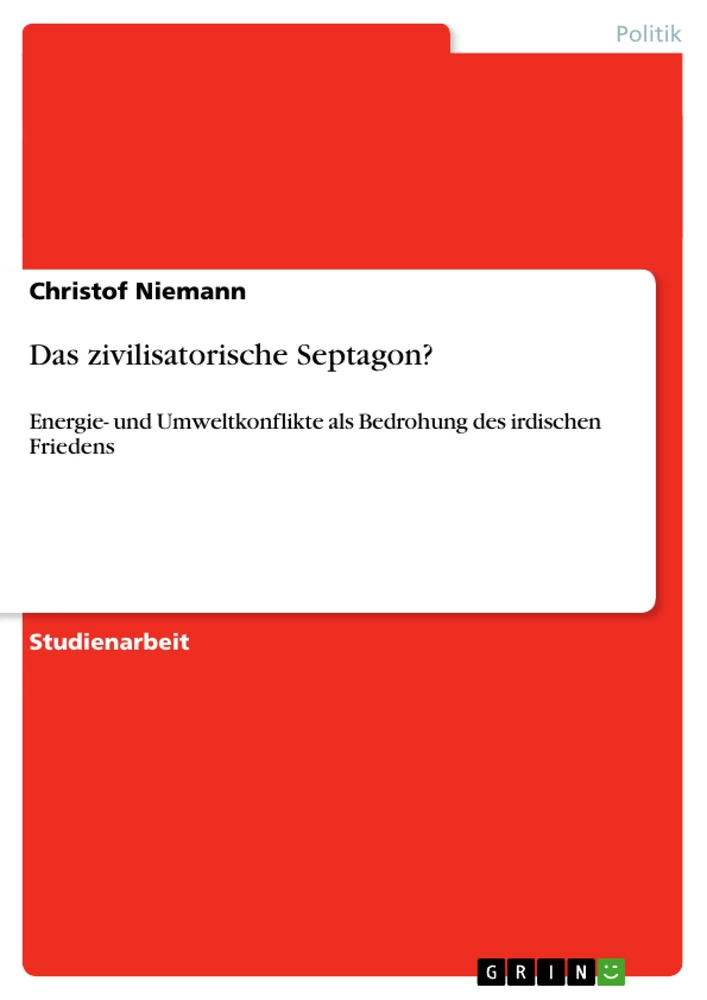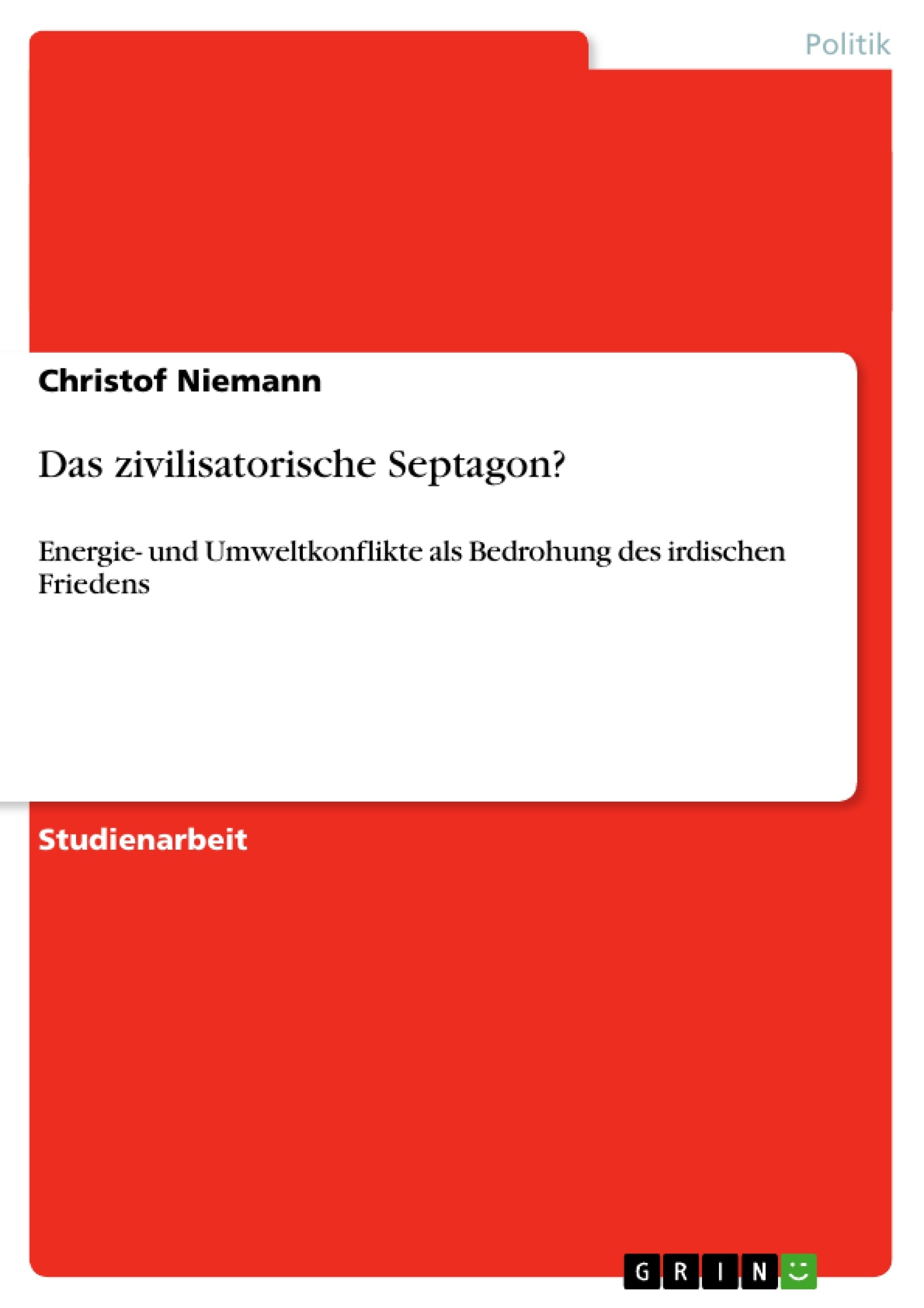Die Bewusstseinsänderung der Industriestaaten stellte sich im Jahre 1973/74 ein: mit beispielloser Macht hatte sich in den Jahrzehnten zuvor eine ehemals als nutzlos und übel riechend verfemte Substanz in einen bequem zu handhabenden und geradezu unerschöpflichen Energieträger verwandelt. Er ermöglichte einen Wohlstand, wie ihn die Welt nie zuvor gesehen hatte, er wurde zum „schwarzen Gold“ und er fand sich im Überfluss – allerdings nur in bestimmten Regionen der Welt. Dieser letzte kleine „Schönheitsfehler“ wurde Anfang der Siebziger unter dem Eindruck der weltweiten Ölkrise auf dramatische Weise offenbar. Schlagartig setzte sich die Erkenntnis einseitiger Abhängigkeit von Ölimporten aus der Golfregion durch, schlagartig löste dessen Macht über die industrialisierten Volkswirtschaften heftige Diskussionen aus. Seitdem ist eine zentrale Aufgabe jeder Regierung jeden Staates die Sicherstellung der Energieversorgung, wobei nicht selten der Zweck die Mittel heiligt. Solange es Reserven genug gibt, erfreuen sich jene Länder, die im Besitz des schwarzen Goldes sind, an guten Geschäften und an interventionsarmer Politik seitens der Abhängigen.
Der Meeresspiegel, dies ist eine historische Beobachtung, steigt um 6 Meter bei einer Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um 2°. Sturm und Flutkatastrophen, Verminderung der Trinkwasservorräte und das Schrumpfen des Lebensraums sind einige der Folgen. Der so genannte Treibhauseffekt, wesentlich hervorgerufen durch energiebedingte CO2-Emissionen, führt zur globalen Erwärmung. Ein US-Amerikaner verursacht pro Kopf und Jahr das 25-fache der CO2-Emissionen eines Inders. Obwohl der Norden in besonderer Weise den Treibhauseffekt hervorruft, treffen die Folgen den Süden weit stärker, zudem ist er verwundbarer und hat weit weniger Mittel, die Folgen zu begrenzen oder zu beseitigen. Solange die Folgen sich in einem bestimmten Rahmen bewegen, wird dies kaum Anlass für Verwerfungen zwischen den Staaten sein.
Energie- und Umweltkonflikte gewinnen immer mehr an Brisanz und Aufmerksamkeit. Bisher sind die Probleme allerdings noch nicht derart akut, dass sie in großem Umfang den Frieden in der Welt gefährden würden, auch weil ihre Folgen nur sehr indirekt dem eigenen Verhalten zugeschrieben werden. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, inwieweit diese Probleme in absehbarer Zeit zu einem Problem für den Frieden in der Welt werden können und auf welche Weise einer solchen Gefährdung entgegenzutreten wäre. Dabei dient Norbert Elias „Über den Prozess der Zivilisation“ dem Verständnisgewinn der menschlichen Anpassung an neue Gegebenheiten insgesamt. Als zentrale Theorie liefert Dieter Senghaas „zivilisatorisches Hexagon“ das Grundverständnis für die Bedingungen des Friedens, wobei auch der Frage nachgegangen werden soll, ob selbiges nicht auch eine energetische und damit gleichzeitig ökologische Dimension beinhalten sollte. Im Anschluss an die Darstellung der genannten Theorien sollen unter Einbeziehung aktueller Entwicklungen Antworten auf diese Fragen gefunden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über den Konfliktbegriff
- Norbert Elias: Über den Prozess der Zivilisation
- Dieter Senghaas: Zum irdischen Frieden - Das zivilisatorische Hexagon
- Das zivilisatorische Hexagon
- Der Weg zum irdischen Frieden
- „Psychologie“ des Staates
- Das Hexagon als vorläufige Theorie
- Energiekonflikte als Bedrohung des Friedens
- Das Energieproblem
- Die Zuspitzung des Energieproblems – Konfliktpotenziale
- Abschließende Betrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit Energie- und Umweltkonflikte den Weltfrieden gefährden könnten und welche Maßnahmen zur Abwehr solcher Gefahren ergriffen werden sollten. Sie nutzt die Theorien von Norbert Elias ("Über den Prozess der Zivilisation") und Dieter Senghaas ("Das zivilisatorische Hexagon") als analytische Grundlagen.
- Der Einfluss von Energiekonflikten auf den Weltfrieden
- Analyse des Konfliktsbegriffs und seiner Eskalationsdynamik
- Anwendung der Theorie des zivilisatorischen Prozesses nach Elias
- Bewertung des zivilisatorischen Hexagons von Senghaas im Kontext von Energie und Umwelt
- Entwicklung möglicher Lösungsansätze zur Vermeidung von Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel des Erdöls von einer nutzlosen Substanz zu einem essentiellen Energieträger und die daraus resultierende Abhängigkeit der Industrienationen. Sie hebt die weltweite Ölkrise der 1970er Jahre als Wendepunkt hervor und thematisiert die wachsende Brisanz von Energie- und Umweltkonflikten, deren indirekte Folgen bisher den Weltfrieden nur wenig gefährden. Die Arbeit untersucht die potenzielle zukünftige Eskalation dieser Konflikte und mögliche Gegenmaßnahmen, wobei die Theorien von Elias und Senghaas als analytische Werkzeuge dienen.
Über den Konfliktbegriff: Dieses Kapitel definiert den Konfliktbegriff als Spannungsgefälle zwischen Ist- und Soll-Zustand. Es beschreibt die Eskalationsdynamik von Konflikten, beginnend mit Kommunikation bis hin zu Gewalt, abhängig von der Kompromissbereitschaft der Akteure und der Bedeutung des jeweiligen Bedürfnisses (existentiell oder nicht). Es betont, dass Konflikte ein wesentliches Merkmal sozialer Bewegungen sind und ihre Qualität durch das Verhältnis von destruktiven und konstruktiven Verhaltensweisen bestimmt wird.
Norbert Elias: Über den Prozess der Zivilisation: Dieses Kapitel fasst Elias' umfassende Arbeit zusammen. Elias analysiert den Prozess der Zivilisation von den feudalen Strukturen des frühen Mittelalters bis zum Absolutismus, wobei Bevölkerungswachstum, der Druck auf Ressourcen, Wanderungsbewegungen und die Entwicklung von Abhängigkeitsketten zentrale Rollen spielen. Die Auswanderung und die Erschließung neuer Landstriche werden als Folgen des sozialen Drucks dargestellt, der auch die Kreuzzüge mit beeinflusst haben könnte. Die zunehmende Bedeutung von Geld und der Wettbewerb zwischen territorialen Herren mit ihren privaten "Staaten" werden als weitere wichtige Aspekte dieses Prozesses hervorgehoben.
Dieter Senghaas: Zum irdischen Frieden - Das zivilisatorische Hexagon: (Diese Zusammenfassung ist aufgrund der begrenzten Textauszüge nur oberflächlich möglich und müsste durch den vollständigen Text ergänzt werden). Dieses Kapitel stellt Senghaas' Theorie des zivilisatorischen Hexagons vor, eine Theorie über die Bedingungen des Friedens. Es wird die Frage erörtert, ob dieses Hexagon um eine energetische und ökologische Dimension erweitert werden sollte. Der Text deutet an, dass dies eine zentrale Frage für die Arbeit darstellt.
Energiekonflikte als Bedrohung des Friedens: (Diese Zusammenfassung ist aufgrund der begrenzten Textauszüge nur oberflächlich möglich und müsste durch den vollständigen Text ergänzt werden). Dieses Kapitel behandelt die Zuspitzung des Energieproblems und das damit verbundene Konfliktpotenzial. Es wird wahrscheinlich die Verbindung zwischen Energieverbrauch, Klimawandel und den daraus resultierenden internationalen Spannungen beleuchten.
Schlüsselwörter
Energiekonflikte, Umweltkonflikte, Weltfrieden, Zivilisationsprozess, Norbert Elias, Dieter Senghaas, zivilisatorisches Hexagon, Konfliktpotential, Ressourcenknappheit, globale Erwärmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Energie- und Umweltkonflikten im Kontext des Weltfriedens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Energie- und Umweltkonflikte den Weltfrieden gefährden und welche Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahren ergriffen werden sollten. Sie analysiert dies anhand der Theorien von Norbert Elias ("Über den Prozess der Zivilisation") und Dieter Senghaas ("Das zivilisatorische Hexagon").
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Norbert Elias (Prozess der Zivilisation) und Dieter Senghaas (Zivilisatorisches Hexagon) zur Analyse der Zusammenhänge zwischen Energie-/Umweltkonflikten und dem Weltfrieden.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den Konfliktbegriff, die Eskalationsdynamik von Konflikten, den Einfluss von Energiekonflikten auf den Weltfrieden, die Anwendung der Theorie des zivilisatorischen Prozesses nach Elias und die Bewertung des zivilisatorischen Hexagons von Senghaas im Kontext von Energie und Umwelt. Zusätzlich werden mögliche Lösungsansätze zur Konfliktvermeidung entwickelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel über den Konfliktbegriff, Elias' Zivilisationsprozess, Senghaas' zivilisatorisches Hexagon, Energiekonflikte als Friedensbedrohung und abschließende Betrachtungen. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Was ist die Kernaussage zum Konfliktbegriff?
Der Konfliktbegriff wird als Spannungsgefälle zwischen Ist- und Soll-Zustand definiert. Die Eskalation hängt von Kompromissbereitschaft und der Bedeutung des Bedürfnisses ab. Konflikte sind ein Merkmal sozialer Bewegungen und ihre Qualität wird durch das Verhältnis von destruktiven und konstruktiven Verhaltensweisen bestimmt.
Wie wird Elias' Theorie des Zivilisationsprozesses angewendet?
Elias' Analyse des Zivilisationsprozesses, von feudalen Strukturen bis zum Absolutismus, mit Bevölkerungswachstum, Ressourcenknappheit und Abhängigkeitsketten, wird auf die aktuelle Situation mit Energie- und Umweltkonflikten angewendet. Auswanderung, Erschließung neuer Landstriche und der Einfluss von Geld und Wettbewerb werden im Kontext betrachtet.
Welche Rolle spielt Senghaas' zivilisatorisches Hexagon?
Senghaas' zivilisatorisches Hexagon, eine Theorie über die Bedingungen des Friedens, wird auf seine Anwendbarkeit im Kontext von Energie und Umwelt untersucht. Es wird diskutiert, ob das Hexagon um eine energetische und ökologische Dimension erweitert werden sollte.
Wie werden Energiekonflikte als Friedensbedrohung behandelt?
Das Kapitel zu Energiekonflikten beleuchtet die Zuspitzung des Energieproblems und das damit verbundene Konfliktpotenzial, wahrscheinlich unter Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen Energieverbrauch, Klimawandel und internationalen Spannungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Energiekonflikte, Umweltkonflikte, Weltfrieden, Zivilisationsprozess, Norbert Elias, Dieter Senghaas, zivilisatorisches Hexagon, Konfliktpotential, Ressourcenknappheit, globale Erwärmung.
- Citar trabajo
- Christof Niemann (Autor), 2005, Das zivilisatorische Septagon?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79184