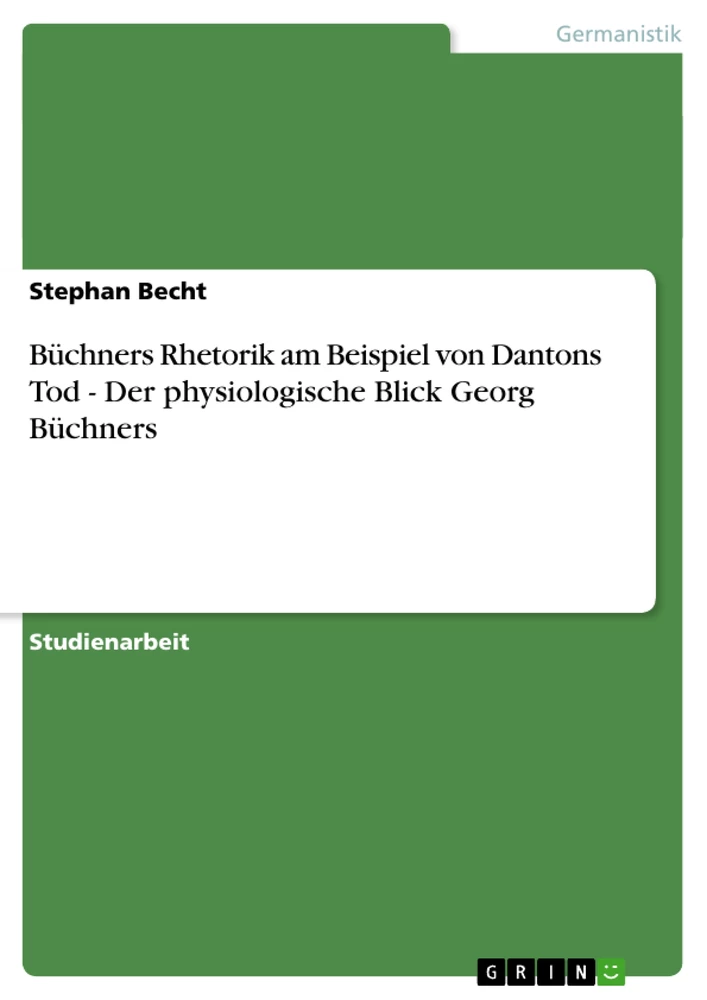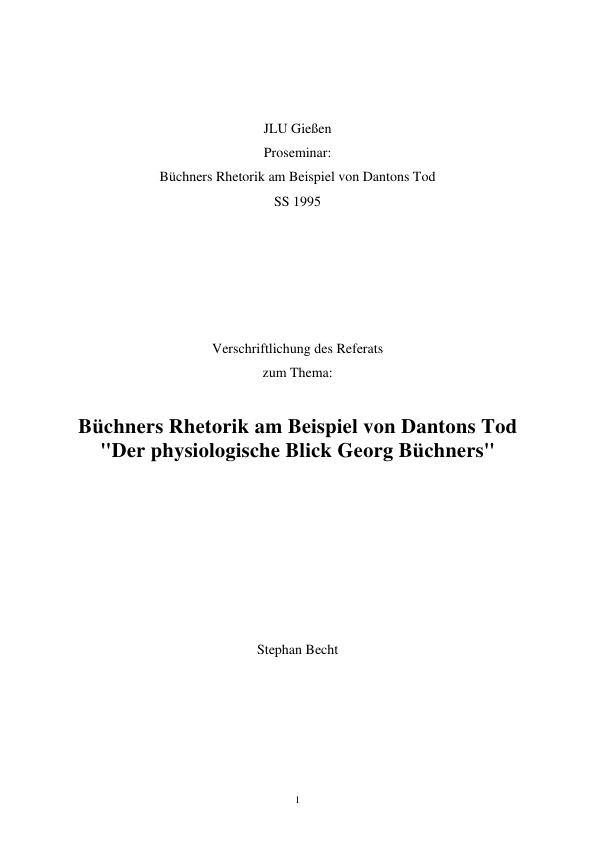Schon zu Lebzeiten Georg Büchners spricht der Journalist Karl Gutzkow vom "Autopsiebedürfnis", das man in den Werken Büchners erkennen könne. Er habe durch das Medizinstudium die Fähigkeit des Selbstschauens entwickelt.
Untersuchungsgegenstand dieses Referates ist die Anwendung des "Autopsiebedürfnisses" Büchners auf das Drama Dantons Tod. Es soll herausgestellt werden, inwieweit Büchners Sprache durch seine biologischen und philosophischen Erkenntnisse beeinflußt wird und welche Rolle die Charaktäre durch die Sprache einnehmen. Die Ausführungen zu dem Thema basieren dabei grundsätzlich auf dem Aufsatz "Autopsie, Bemerkungen zum 'Selbst - Schauen' in Texten Georg Büchners" von Wulf Wülfing. Aufgrund der "Knappheit" eines Referates können die Thesen zu diesem Themenbereich jedoch nur in Ansätzen dargestellt und nicht eingehend erläutert werden. Zudem erwies sich die Verschriftlichung über die Diskursintegration wegen des Versuchs der knappen Darstellung als schwierig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Instrumentalisierung des Sehens
- Vertrauen/ Skepsis in die Zuverlässigkeit des Auges - Diskursintegration
- Vertrauen in das Auge - biologischer Diskurs
- Skepsis an der Zuverlässigkeit des Auges - philosophischer Diskurs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht die Rolle des "Autopsiebedürfnisses" in Georg Büchners Drama "Dantons Tod" und beleuchtet, wie Büchners Sprache durch biologische und philosophische Erkenntnisse geprägt ist. Dabei wird der Fokus auf die Charaktere und deren Rolle in der Inszenierung des Sehens gelegt.
- Die Instrumentalisierung des Sehens als Mittel der Macht und Kontrolle im Drama
- Das Vertrauen des Volkes in das "Auge" und die Rolle des Auges als Symbol des Staates
- Die Verbindung zwischen dem medizinischen Blick und der politischen Ideologie Robespierres
- Die Verwendung von medizinischen Begriffen und Bildern als Metapher für die Gewalt des Systems
- Die Bedeutung der Selbstschau und die Möglichkeiten der Selbstreflexion im Drama
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Konzept des "Autopsiebedürfnisses" in Büchners Werk ein und stellt den Fokus auf das Drama "Dantons Tod" und dessen sprachliche Besonderheiten. Im zweiten Kapitel wird die Instrumentalisierung des Sehens in Dantons Tod analysiert. Es werden Textstellen aufgezeigt, die die Bedeutung des Sehens für die Figuren und das Volk verdeutlichen. Der dritte Abschnitt befasst sich mit dem Vertrauen und der Skepsis gegenüber der Zuverlässigkeit des Auges. Hier wird die Verbindung zwischen dem biologischen und philosophischen Diskurs im Drama beleuchtet.
Schlüsselwörter
Georg Büchner, Dantons Tod, Autopsie, Selbstschau, Sehen, Instrumentalisierung, Vertrauen, Skepsis, Diskursintegration, biologischer Diskurs, philosophischer Diskurs, Robbespierre, Volk, Gewalt, Ideologie, Medizin, Metapher.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Büchners „Autopsiebedürfnis“?
Es bezeichnet die durch sein Medizinstudium geprägte Fähigkeit des „Selbst-Schauens“ und die klinisch-analytische Betrachtung der Realität in seinen literarischen Werken.
Wie zeigt sich der „physiologische Blick“ in „Dantons Tod“?
Büchner nutzt medizinische Begriffe und Metaphern der Gewalt, um politische Prozesse und die Destruktivität des Systems darzustellen.
Welche Rolle spielt das „Auge“ als Symbol im Drama?
Das Sehen wird als Mittel der Macht und Kontrolle instrumentalisiert, wobei das Auge sowohl für die staatliche Überwachung als auch für das Vertrauen des Volkes steht.
Gibt es eine Skepsis gegenüber der Wahrnehmung in Büchners Werk?
Ja, das Referat thematisiert den Konflikt zwischen dem Vertrauen in den biologischen Blick und der philosophischen Skepsis an der Zuverlässigkeit der Sinne.
Wie beeinflussen biologische Erkenntnisse Büchners Sprache?
Seine Sprache ist oft materiell und körperbetont, was die Charaktere eher als Getriebene ihrer Natur denn als rein geistige Wesen erscheinen lässt.
- Citar trabajo
- Stephan Becht (Autor), 1995, Büchners Rhetorik am Beispiel von Dantons Tod - Der physiologische Blick Georg Büchners, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79204