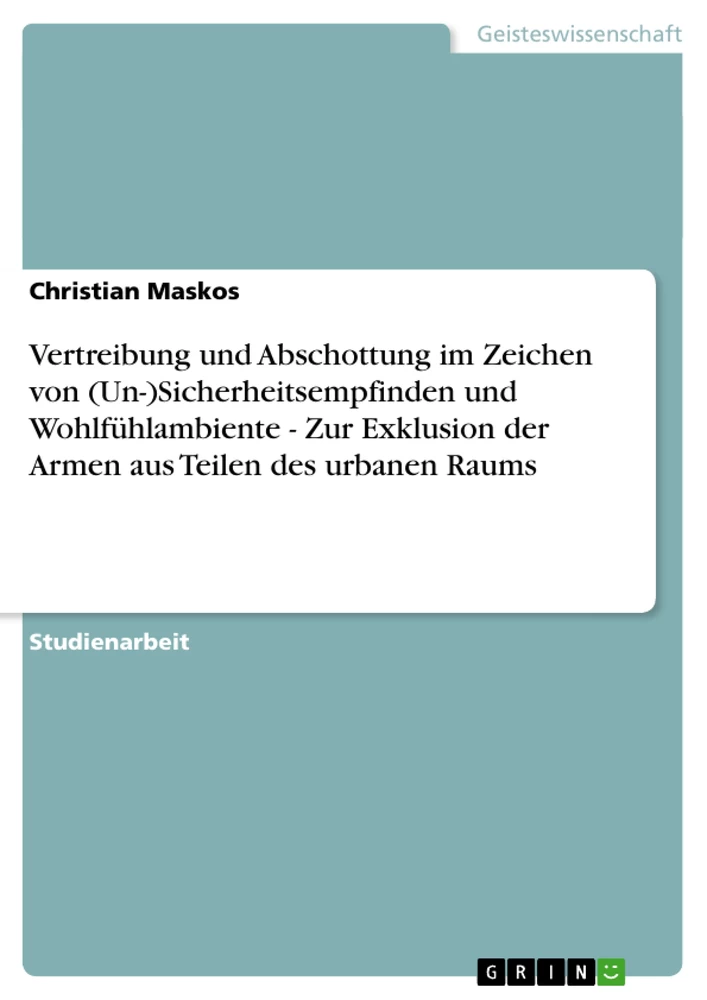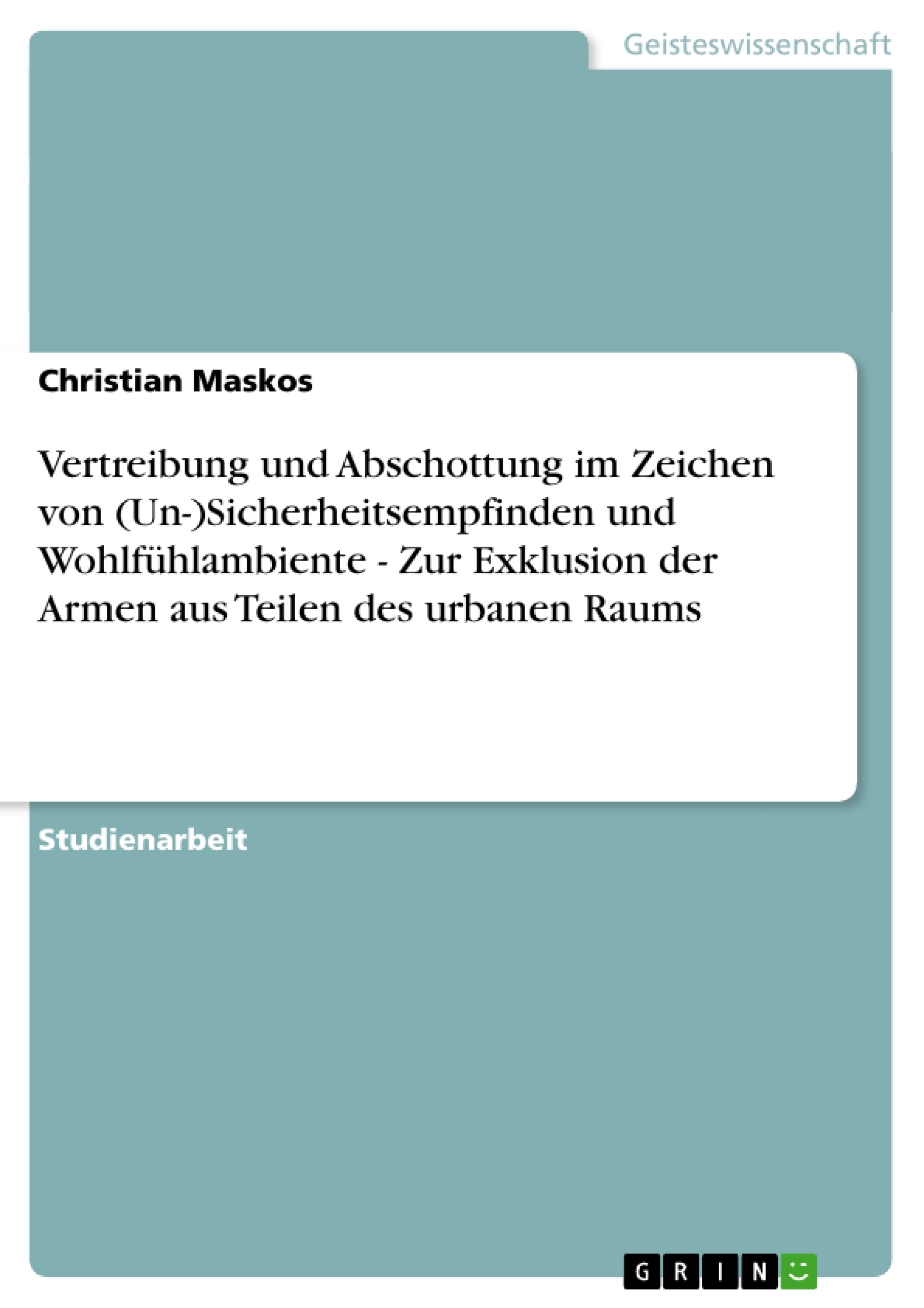Seit Beginn der 1980er Jahre lässt sich sowohl in den USA als auch in der Bundesrepublik Deutschland eine zunehmende Präsenz von Diskursen beobachten, die Erscheinungsformen städtischer Armut, wie bspw. Bettler und Obdachlose und ihre Anwesenheit in Teilen des urbanen Raums als eine Bedrohung definieren und zu beseitigen bzw. unterbinden suchen. Die Begründung exkludierender Interventionen im urbanen Raum rekurriert dabei auf Begriffe wie Wohlfühlambiente und (Un-)Sicherheitsempfinden. Es ist die Gewähr- leistung optimaler Reproduktionsbedingungen im Kontext der Aufwertung der Standortqualitäten der Stadt im interkommunalen Wettbewerb, die Schaffung von Konkurenzfähigkeit öffentlicher Einkaufsstraßen gegen- über privaten Urban Entertainment Centers, die Kreation einer angenehmen Konsumatmosphäre, die (Wieder-)Herstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und die Rücksichtnahme auf die Sorgen und Ängste der Bevölkerung mit der kommunale Politik und Wirtschaft die räumliche Ausschließung der Außen- seiter legitimieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Komponenten des den Armen zugeschriebenen Bedrohungspotentials und ihre Hintergründe
- Das unbekannte Andere: Die Fremdheit der Armen
- Das Stigma der kriminellen Armen
- Die Gefahr der Armen für den mehrheitsgesellschaftlichen Werte- und Normen-mainstream: Culture of Poverty
- Die Armen als Ursache von Kriminalität: Hintergründe und Folgerungen der Broken Windows Theorie
- Fear of falling: Die Armen als Mahnmal der Möglichkeit des eigenen sozialen Abstiegs
- Die Armen als Störpotential für das positive Reproduktions- und Konsumklima
- Ursachen der zunehmenden Hypersensibilität gegenüber physischer (Un-)Sicherheit
- Die Verschiebung von sozialer zu physischer Sicherheit auf individueller und politischer Ebene
- Die mediale (Re-)Produktion von Ängsten vor Gewalt und Kriminalität
- Kommerzialisierung von (Un-)Sicherheit
- Erhöhte Vulnerabilität aufgrund demographischer Entwicklungen
- Die Armen als Bezugspunkt wachsender Hypersensibilität gegenüber physischer (Un-)Sicherheit
- Maßnahmen der räumlichen Exklusion und Separation
- Die ,,soziale Säuberung“ des öffentlichen Raums: Mit Zero Tolerance und Community Policing gegen die Unwirtlichkeit der Stadt
- Das Prinzip Shopping Mall: Positives Konsumklima durch Aussperrung der Armen
- Sicherheit durch schwarze Sheriffs
- Gated Communities: Wohnen hinter Zäunen
- Elektronische Überwachung und Kontrolle des Raums
- Materielle und symbolische Gestaltung des Raums
- Ausschluss durch Einschluss: Gefängnis und containment
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die zunehmende Exklusion der Armen aus Teilen des urbanen Raums in Deutschland und den USA zu analysieren und zu verstehen. Sie untersucht, wie die Armen als Bedrohung wahrgenommen werden und welche Maßnahmen der räumlichen Exklusion und Separation ergriffen werden. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe dieser Entwicklungen und zeigt, wie die Armen als Störfaktor für das "Wohlfühlambiente" der Mehrheitsgesellschaft und die angestrebte "Sicherheit" angesehen werden.
- Wahrnehmung der Armen als Bedrohungspotential
- Ursachen der zunehmenden Angst vor und Ablehnung gegenüber den Armen
- Maßnahmen der räumlichen Exklusion und Separation
- Konzepte der "Culture of Poverty" und die Stigmatisierung der Armen
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Angst und Kriminalität
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel der Arbeit beleuchtet die Komponenten des den Armen zugeschriebenen Bedrohungspotentials und ihre Hintergründe. Es analysiert die Wahrnehmung der Armen als "fremd" und die damit verbundene Angst vor dem "Unbekannten". Weiterhin wird die Rolle der Medien in der (Re-)Produktion des Stigmas der kriminellen Armen sowie die Entstehung der "Culture of Poverty" als Erklärungsmodell für deviantes Verhalten untersucht.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Ursachen der zunehmenden Hypersensibilität gegenüber physischer (Un-)Sicherheit. Es zeigt, wie die Verschiebung von sozialer zu physischer Sicherheit auf individueller und politischer Ebene die Angst vor Gewalt und Kriminalität verstärkt. Die mediale Inszenierung von Kriminalität, die Kommerzialisierung von (Un-)Sicherheit und demographische Entwicklungen tragen ebenfalls zur Steigerung der Angst beitragen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit Maßnahmen der räumlichen Exklusion und Separation. Es analysiert die "soziale Säuberung" des öffentlichen Raums durch Zero Tolerance und Community Policing sowie die Entwicklung von Shopping Malls, Gated Communities und elektronischer Überwachung als Strategien der räumlichen Abgrenzung von den Armen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Exklusion, Separation, Armut, Sicherheitsempfinden, Wohlfühlambiente, städtischer Raum, "Culture of Poverty", Stigmatisierung, Medien, Zero Tolerance, Community Policing, Shopping Mall, Gated Community, elektronische Überwachung.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Arme aus dem urbanen Raum verdrängt?
Um ein „Wohlfühlambiente“ für Konsumenten zu schaffen und die Standortqualität im interkommunalen Wettbewerb zu erhöhen.
Was besagt die „Broken Windows Theorie“?
Dass sichtbare Zeichen von Verwahrlosung (wie kaputte Fenster oder Obdachlosigkeit) zu mehr Kriminalität und Unsicherheit führen.
Was sind „Gated Communities“?
Geschlossene Wohnkomplexe, die durch Zäune und Sicherheitsdienste den öffentlichen Raum privatisieren und Außenstehende ausschließen.
Welche Rolle spielen Medien bei der Angst vor Kriminalität?
Medien (re-)produzieren oft Ängste, indem sie Armut mit Gefahr und Kriminalität gleichsetzen, was die Akzeptanz für Exklusionsmaßnahmen erhöht.
Was bedeutet „Zero Tolerance“ in der Stadtpolitik?
Eine Strategie der harten Hand gegen geringfügige Verstöße, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit (scheinbar) wiederherzustellen.
- Quote paper
- Christian Maskos (Author), 2007, Vertreibung und Abschottung im Zeichen von (Un-)Sicherheitsempfinden und Wohlfühlambiente - Zur Exklusion der Armen aus Teilen des urbanen Raums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79412