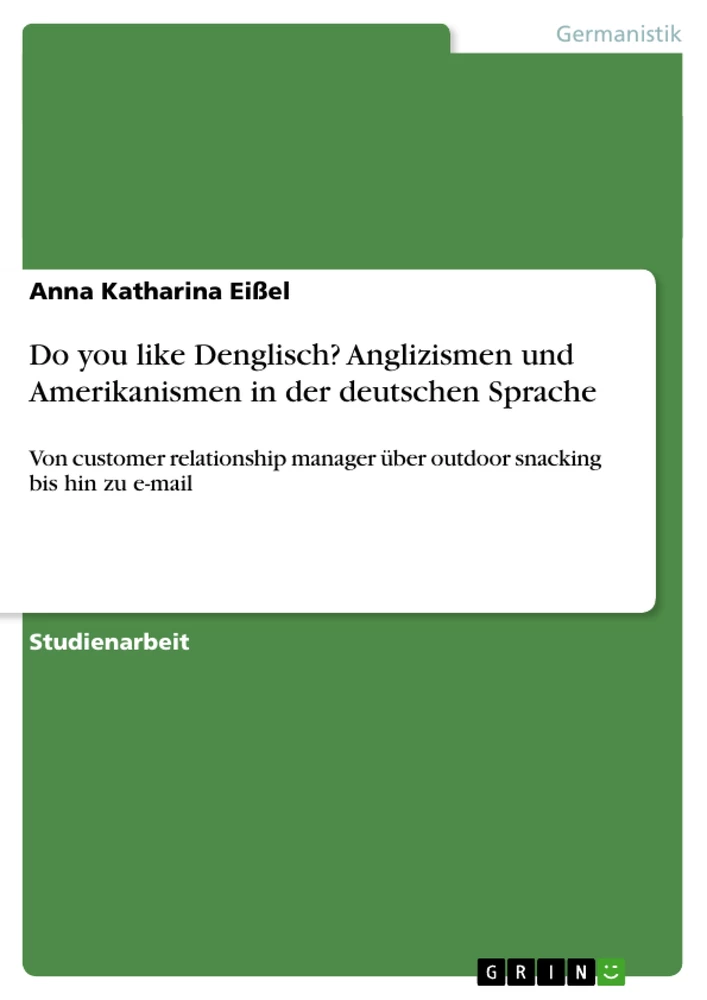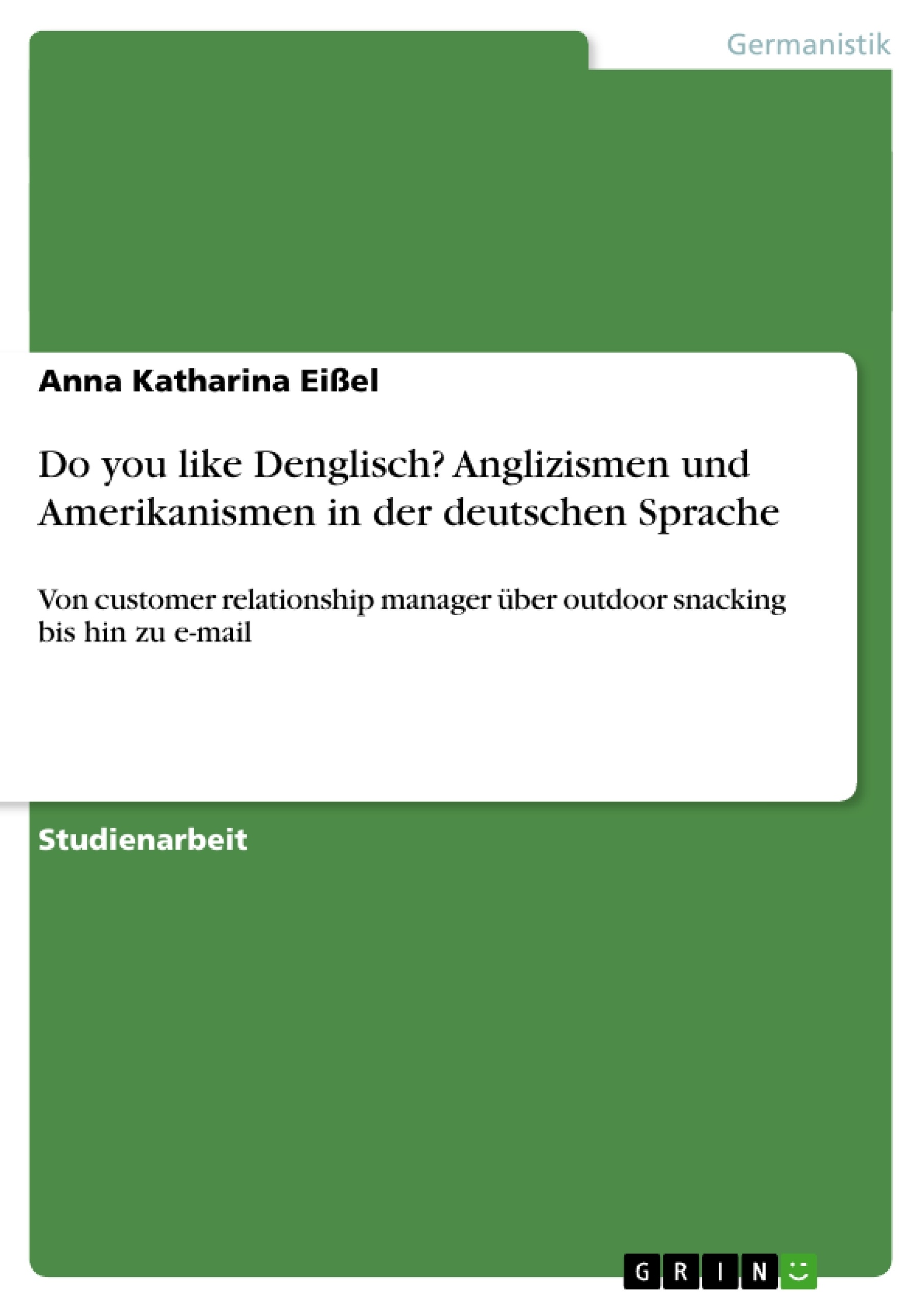Diese Arbeit bietet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Einfluss der Amerikanismen auf das Gegenwartsdeutsch – inklusive eines geschichtlichen Abrisses der fremdsprachlichen Einflüsse auf das Deutsche bis in die Römerzeit, einem Exkurs über die Kategorien Erb-, Lehn- und Fremdwort / Lehnbildung, einer kritischen Darstellung der tätigen Sprachvereine und einem Vergleich zur französischen Sprachpolitik.
Wie viele Anglizismen im gegenwärtigen Deutsch gebräuchlich sind, ist schwer zu ermitteln, ständig kommen neue hinzu, und manche ältere – beispielsweise veraltetes Modewortgut – oder flüchtige fallen weg. Entsprechende Lexika können aus diesen Gründen zwar nie die korrekte Anzahl der im wirklich Sprachgebrauch benutzten Wörter auflisten, dennoch möchte ich hier ein Zahlenbeispiel anführen: Das „Anglizismen-Wörterbuch“ listet ca. 3.500 Anglizismen auf (unter Verwendung von rund 100.000 Belegen aus deutschen Zeitungen, Zeitschriften und deutscher Literatur). Diese Zahl mutet noch verhältnismäßig klein an, angesichts der wahrnehmbaren Allgegenwärtigkeit an Wörtern englischen Ursprungs in unserem allgemeinen Sprachgebrauch. In verschiedenen Bereichen der Sprachpraxis scheinen sie allerdings häufiger verwendet zu werden: zum Beispiel in der Jugendsprache, in der Sprache der Werbung, in den Bezeichnungen neuer Technologien, in Berufsbezeichnungen, vor allem der Medienbranche.
Was überhaupt ist „Denglisch“ im Unterschied zum „Anglizismus“?
Im „Wörterbuch überflüssiger Anglizismen“ findet man folgende Definition: „Der Begriff „Denglisch“ umschreibt Wörter, die deutsche Erfindungen (Handy, Wellness etc.) oder ein Gemisch beider Sprachen (abtörnen, versnobt etc.) sind.“
Der Terminus „Anglizismus“ umfasst ein breiteres Feld an Wörtern, so beschreibt ihn ein herkömmliches Lexikon knapp als „Englische Ausdrucksweise in einer anderen Sprache.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Geschichte der fremdsprachlichen Einflüsse auf das Deutsche
- 2.2. Exkurs: Die Kategorien Erb-, Lehn- und Fremdwort / Lehnbildung
- 2.3. Der Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache
- 2.4. Sprachvereine
- 2.5. Anglizismen und Amerikanismen in Frankreich / Französische Sprachpolitik
- 3. Schlussbetrachtung: Für und Wider
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Englischen, insbesondere Amerikanismen, auf die deutsche Sprache. Das Hauptziel ist es, die Geschichte dieser Entwicklung zu beleuchten, verschiedene Perspektiven auf die Problematik zu präsentieren und die Diskussion um Sprachpurismus und die Akzeptanz von Anglizismen zu erörtern.
- Historische Entwicklung des Fremdworteinflusses auf die deutsche Sprache
- Definition und Kategorisierung von Erb-, Lehn- und Fremdwörtern
- Analyse des Einflusses des Englischen auf verschiedene Sprachbereiche (Jugendsprache, Werbung, Fachsprachen)
- Die Rolle von Sprachvereinen und Sprachpolitik in der Auseinandersetzung mit Anglizismen
- Vergleich der deutschen und französischen Sprachpolitik bezüglich des Umgangs mit Anglizismen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Schwierigkeit, die genaue Anzahl von Anglizismen im Deutschen zu bestimmen. Sie vergleicht die Begriffe "Denglisch" und "Anglizismus" anhand verschiedener Lexika und skizziert den Aufbau der Arbeit, der einen historischen Überblick über fremdsprachliche Einflüsse auf das Deutsche, einen Exkurs zu linguistischen Kategorien und eine detaillierte Analyse des Einflusses des Englischen umfasst, gefolgt von einer Betrachtung der Sprachvereine und der französischen Sprachpolitik, um schliesslich mit einer kritischen Schlussbetrachtung zu enden.
2.1. Geschichte der fremdsprachlichen Einflüsse auf das Deutsche: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung fremdsprachlicher Einflüsse auf das Deutsche. Es werden verschiedene Epochen wie die Römerzeit, die Christianisierung, die höfische Zeit, der Humanismus, der 30-jährige Krieg und die Ära der industriellen Revolution und des Zweiten Weltkriegs untersucht, um die jeweiligen Einflüsse von Sprachen wie Latein, Französisch und Englisch auf den deutschen Wortschatz zu beleuchten. Es werden die kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründe dieser Einflüsse ausführlich erläutert, und die Autorin betont, dass die aktuelle "Überschwemmung" durch Anglizismen kein neues Phänomen darstellt, sondern ein fortlaufender Prozess ist.
2.2. Exkurs: Die Kategorien Erb-, Lehn- und Fremdwort / Lehnbildung: Dieses Kapitel definiert und unterscheidet die Kategorien Erb-, Lehn- und Fremdwörter sowie Lehnbildung. Es erläutert die verschiedenen Arten der Lehnbildung (Lehnübersetzung, Lehnübertragung, Lehnschöpfung) und die Kategorie der Lehnbedeutung. Die Autorin nutzt verschiedene Beispiele, um die jeweiligen Kategorien zu illustrieren und verdeutlicht die Schwierigkeit, immer klare Grenzen zwischen diesen Kategorien zu ziehen.
2.3. Der Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss des Englischen, genauer des Amerikanischen Englisch, auf die deutsche Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg. Es werden verschiedene wissenschaftliche Texte und Meinungen zitiert, die die Problematik aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Die Autorin stellt die konträren Positionen von Sprachpuristen und Verfechtern einer offenen Sprachentwicklung gegenüber und diskutiert die Argumente für und gegen die Übernahme von Anglizismen. Sie beleuchtet die Rolle der Medien, der Werbung und der Jugendsprache bei der Verbreitung von Amerikanismen und analysiert die Auswirkungen auf die Verständlichkeit und den kulturellen Status der deutschen Sprache.
2.4. Sprachvereine: Dieses Kapitel befasst sich mit der Geschichte und den Aktivitäten von Sprachvereinen in Deutschland, die sich mit dem Schutz der deutschen Sprache vor Fremdworteinflüssen beschäftigt haben. Es werden die Aktivitäten von Vereinen wie der "Fruchtbringenden Gesellschaft" und dem "Allgemeinen Deutschen Sprachverein" im historischen Kontext untersucht und ihre Erfolge und Misserfolge bei der Eindeutschung von Fremdwörtern erörtert. Das Kapitel zeigt die Veränderungen im Ansatz der Sprachvereine auf, von nationalistisch geprägten Positionen hin zu einem differenzierteren und reflektierteren Umgang mit der Thematik.
2.5. Anglizismen und Amerikanismen in Frankreich / Französische Sprachpolitik: Dieses Kapitel vergleicht den deutschen Umgang mit Anglizismen mit dem der französischen Sprachpolitik. Es beschreibt die gesetzlichen Maßnahmen in Frankreich zur Regulierung des Gebrauchs von Anglizismen und die damit verbundenen Diskussionen. Die Autorin erläutert die Gründe für die strengere französische Sprachpolitik und hebt die kulturelle Bedeutung der Sprache für die nationale Identität hervor. Der Vergleich verdeutlicht den Unterschied zwischen der staatlich gelenkten Sprachplanung Frankreichs und der eher liberaleren Entwicklung in Deutschland.
Schlüsselwörter
Anglizismen, Amerikanismen, Denglisch, Sprachwandel, Sprachpolitik, Sprachpurismus, Fremdwörter, Lehnwörter, Lehnbildung, Sprachvereine, Frankreich, Deutsch als Fremdsprache, Mediensprache, Werbung, Jugendsprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Der Text untersucht umfassend den Einfluss des Englischen, insbesondere Amerikanismen, auf die deutsche Sprache. Er beleuchtet die historische Entwicklung, verschiedene Perspektiven auf die Problematik (Sprachpurismus vs. offene Sprachentwicklung), und erörtert die Rolle von Sprachvereinen und Sprachpolitik.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die historische Entwicklung des Fremdworteinflusses auf Deutsch (von der Römerzeit bis zur Gegenwart), die Definition und Kategorisierung von Erb-, Lehn- und Fremdwörtern, die Analyse des englischen Einflusses auf verschiedene Sprachbereiche (Jugendsprache, Werbung, Fachsprachen), die Rolle von Sprachvereinen (z.B. die Fruchtbringende Gesellschaft), einen Vergleich der deutschen und französischen Sprachpolitik im Umgang mit Anglizismen und eine kritische Schlussbetrachtung der Vor- und Nachteile der Anglizismen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit den Unterkapiteln: "Geschichte der fremdsprachlichen Einflüsse auf das Deutsche", "Exkurs: Die Kategorien Erb-, Lehn- und Fremdwort / Lehnbildung", "Der Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache", "Sprachvereine", und "Anglizismen und Amerikanismen in Frankreich / Französische Sprachpolitik", sowie eine Schlussbetrachtung.
Wie wird der Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache analysiert?
Die Analyse betrachtet den Einfluss des Englischen nach dem Zweiten Weltkrieg, zitiert wissenschaftliche Texte und Meinungen zu der Problematik, stellt gegensätzliche Positionen von Sprachpuristen und Befürwortern einer offenen Sprachentwicklung gegenüber, beleuchtet die Rolle der Medien, Werbung und Jugendsprache bei der Verbreitung von Amerikanismen und untersucht die Auswirkungen auf die Verständlichkeit und den kulturellen Status der deutschen Sprache.
Welche Rolle spielen Sprachvereine im Text?
Der Text untersucht die Geschichte und Aktivitäten deutscher Sprachvereine, die sich mit dem Schutz der deutschen Sprache vor Fremdworteinflüssen beschäftigt haben. Er analysiert deren historische Entwicklung, Erfolge und Misserfolge und zeigt die Veränderungen im Ansatz von nationalistischen Positionen hin zu einem differenzierteren Umgang mit der Thematik.
Wie wird der deutsche Umgang mit Anglizismen mit dem französischen verglichen?
Der Text vergleicht die deutsche und französische Sprachpolitik im Umgang mit Anglizismen. Er beschreibt die gesetzlichen Maßnahmen in Frankreich zur Regulierung des Gebrauchs von Anglizismen und die damit verbundenen Diskussionen. Der Vergleich verdeutlicht den Unterschied zwischen der staatlich gelenkten Sprachplanung Frankreichs und der eher liberaleren Entwicklung in Deutschland.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Anglizismen, Amerikanismen, Denglisch, Sprachwandel, Sprachpolitik, Sprachpurismus, Fremdwörter, Lehnwörter, Lehnbildung, Sprachvereine, Frankreich, Deutsch als Fremdsprache, Mediensprache, Werbung, Jugendsprache.
Welche Schwierigkeit wird in der Einleitung angesprochen?
Die Einleitung thematisiert die Schwierigkeit, die genaue Anzahl von Anglizismen im Deutschen zu bestimmen und vergleicht die Begriffe "Denglisch" und "Anglizismus" anhand verschiedener Lexika.
Was ist das Ziel des Textes?
Das Hauptziel ist es, die Geschichte des englischen Einflusses auf die deutsche Sprache zu beleuchten, verschiedene Perspektiven auf die Problematik zu präsentieren und die Diskussion um Sprachpurismus und die Akzeptanz von Anglizismen zu erörtern.
- Quote paper
- Anna Katharina Eißel (Author), 2004, Do you like Denglisch? Anglizismen und Amerikanismen in der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79418