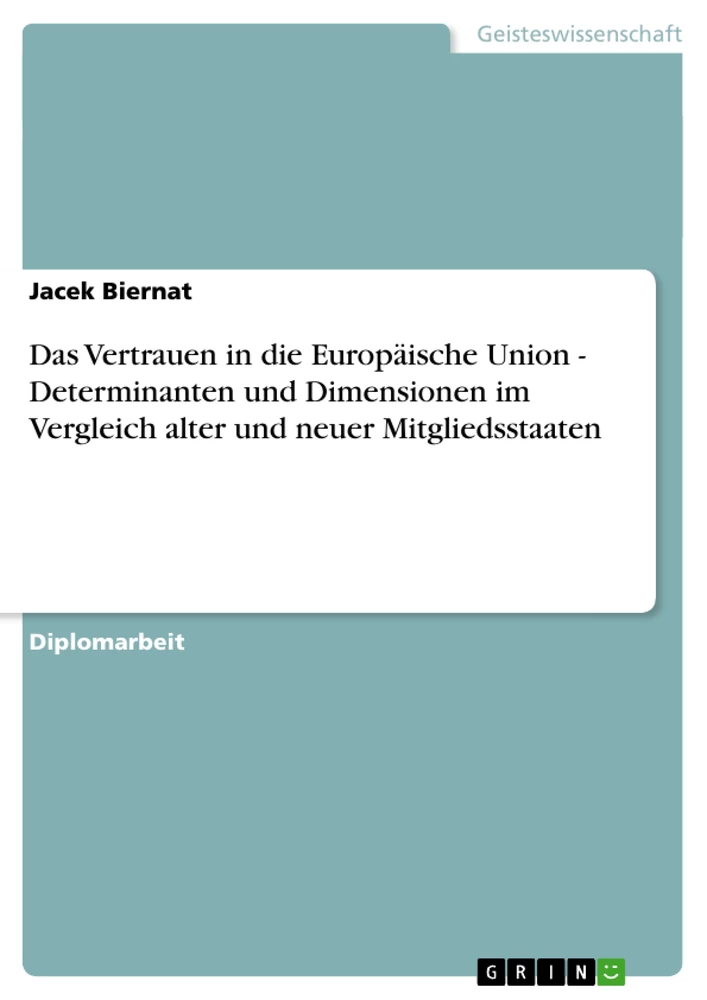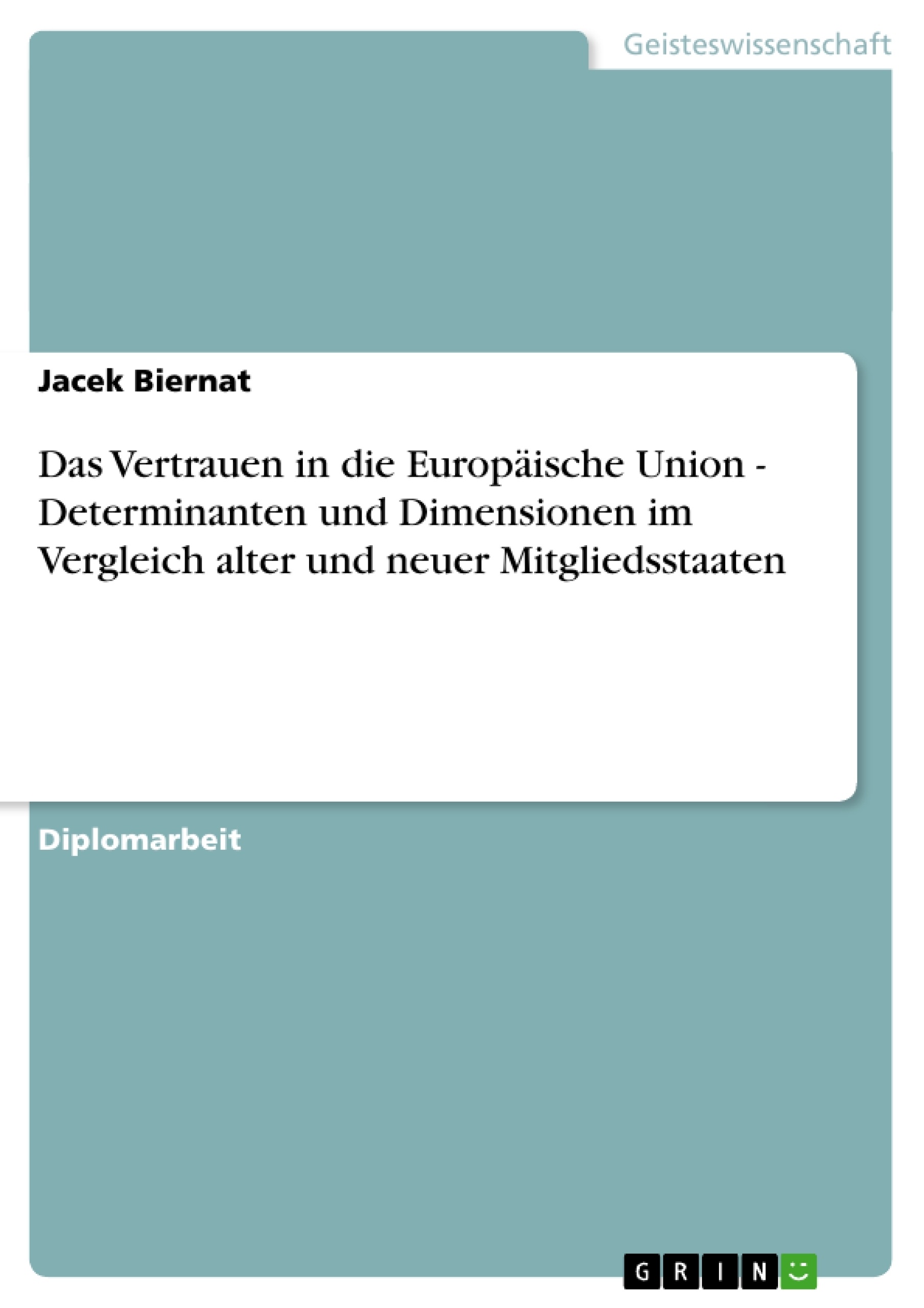Popular opinion of the European Union is becoming increasingly important for its legitimacy. This is due to the transfer of competencies from the member state to the European level, resulting in politicization. The purpose of this empirical study is to investigate citizens’ trust in the EU as a political entity. According to the theory of political support originally developed by David Easton, trust is a central orientation toward a political system. While rather diffuse in nature, it simultaneously depends considerably on specific attitudes. As for the research design, the position of trust – diffuse or specific – will first be identified with the instrument of the principal components analysis using the 1999 wave of the European Values Survey and the Eurobarometer 62 (2004). Secondly, twelve hypotheses on possible determinants of attitudes toward integration will be tested in a series of standardized multiple regressions run separately on fourteen countries.
As the results show, trust in the EU is not well internalized. In many countries, it is impossible to clearly attribute it to one of the factors of political support. However, in Western und Southern Europe the EU seems to be perceived as simply another regime institution, hence a part of the „domestic” political system. In contrast, in Britain and Eastern Europe, a „general European factor” emerges showing that respondents separate the national political system from the „foreign” European sphere. Across Europe, the three necessary factors shaping trust in the EU are as follows: trust in national parliament, satisfaction with EU democracy, and trust in the social security system. Support of the nation state and satisfaction with its systemic performance boost the respondents’ trust in the EU. Thus, the EU is not viewed as an alternative to the domestic regime because the later is ineffective. However, the citizens also base their support for the EU depending on their understanding of democracy. Ultimately, few variables other than their political attitudes determine citizens’ trust in the EU. When all plausible economic and political explanations are accounted for, identity and let alone religion have but minor additional influence. The implication is that neither culture, identity, nor religion poses a long term threat to the consolidation of popular support, and the level of trust can be elevated if Europe and the member states deliver.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- Tabellen und Abbildungen
- Abstract
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Legitimität
- 2.2 Das Konzept politischer Unterstützung
- 2.3 Anwendung des Konzepts auf die Europäische Union
- 3. Zum Begriff Vertrauen
- 3.1 Politisches und soziales Vertrauen
- 3.2 Abgrenzung des Vertrauens innerhalb des Konzepts politischer Unterstützung
- 4. Das Unterstützungsobjekt: Die Europäische Union
- 4.1 Das politische System der Europäischen Union
- 4.2 Legitimitätsbedarf
- 4.3 Demokratische politische Kultur in der EU?
- 4.4 Die politische Gemeinschaft der EU und die europäische Identität
- 4.5. Vertrauen in die EU
- 5. Die Entstehung von Einstellungen zur Europäischen Union. Interessen oder Identität?
- 5.1 Zweckrational
- 5.2 Wertrational
- 5.3 National
- 5.4 Europäisch
- 5.5 Schlussbemerkungen
- 5.6 Thesen
- 6. Empirische Fragen, Hypothesen und Vorgehen
- 6.1 Dimensionen
- 6.2 Empirische Hypothesen zu den einzelnen Determinanten
- 6.2.1 ökonomische Determinanten
- 6.2.2 Politische und kulturelle Determinanten
- 6.3 Länderauswahl
- 7. Empirische Umsetzung
- 7.1 Vorgehen
- 7.2 Das Vertrauen in die Europäische Union in Zahlen
- 7.3 Die inhaltliche Bestimmung des Vertrauens. Ergebnisse der Faktoranalyse
- 7.4 Das Regressionsmodell
- 7.4.1 Auswahl der erklärenden Variablen
- 7.4.2 Ergebnisse der Regressionsanalyse: Die Determinanten des Vertrauens
- 8. Länderprofile
- 8.1 Westdeutschland
- 8.1.1 Verteilungen
- 8.1.2 Dimensionen
- 8.1.3 Determinanten
- 8.2 Ostdeutschland
- 8.2.1 Verteilungen
- 8.2.2 Dimensionen
- 8.2.3 Determinanten
- 8.3 Belgien
- 8.3.1 Verteilungen
- 8.3.2 Dimensionen
- 8.3.3 Determinanten
- 8.4 Luxemburg
- 8.4.1 Verteilungen
- 8.4.2 Dimensionen
- 8.4.3 Determinanten
- 8.5 Österreich
- 8.5.1 Verteilungen
- 8.5.2 Dimensionen
- 8.5.3 Determinanten
- 8.6 Frankreich
- 8.6.1 Verteilungen
- 8.6.2 Dimensionen
- 8.6.3 Determinanten
- 8.7 Großbritannien
- 8.7.1 Verteilungen
- 8.7.2 Dimensionen
- 8.7.3 Determinanten
- 8.8 Schweden
- 8.8.1 Verteilungen
- 8.8.2 Dimensionen
- 8.8.3 Determinanten
- 8.9 Griechenland
- 8.9.1 Verteilungen
- 8.9.2 Dimensionen
- 8.9.3 Determinanten
- 8.10 Portugal
- 8.10.1 Verteilungen
- 8.10.2 Dimensionen
- 8.10.3 Determinanten
- 8.11 Tschechien
- 8.11.1 Verteilungen
- 8.11.2 Dimensionen
- 8.11.3 Determinanten
- 8.12 Ungarn
- 8.12.1 Verteilungen
- 8.12.2 Dimensionen
- 8.12.3 Determinanten
- 8.13 Slowakei
- 8.13.1 Verteilungen
- 8.13.2 Dimensionen
- 8.13.2 Determinanten
- 8.14 Polen
- 8.14.1 Verteilungen
- 8.14.2 Dimensionen
- 8.14.3 Determinanten
- 8.1 Westdeutschland
- 9. Beantwortung der Hypothesen
- 10. Quelle des Vertrauens: Werte oder Kalkül?
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert das Vertrauen in die Europäische Union im Vergleich zwischen alten und neuen Mitgliedsstaaten. Die Arbeit untersucht die Determinanten und Dimensionen dieses Vertrauens, um die zugrundeliegenden Faktoren und Mechanismen zu erforschen, die das Vertrauen in die EU beeinflussen.
- Das Konzept der Legitimität und politische Unterstützung
- Die Rolle von Vertrauen in der EU als Unterstützungsobjekt
- Die Entstehung von Einstellungen zur Europäischen Union
- Empirische Analyse des Vertrauens in die EU anhand von Länderspezifischen Daten
- Beantwortung der Forschungsfragen und Interpretation der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Forschungsfrage und den methodischen Rahmen fest. Das zweite Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Arbeit, fokussiert auf die Konzepte von Legitimität und politischer Unterstützung. Kapitel 3 analysiert das Konzept des Vertrauens und seine Abgrenzung innerhalb des Konzepts politischer Unterstützung. Kapitel 4 betrachtet die Europäische Union als Unterstützungsobjekt, analysiert das politische System und die Herausforderungen der Legitimität in der EU. Kapitel 5 untersucht die Entstehung von Einstellungen zur EU, indem es verschiedene Faktoren wie Zweckrationalität, Wertrationalität, Nationalismus und europäische Identität betrachtet. Kapitel 6 beschreibt die empirischen Fragen, Hypothesen und das Vorgehen der Studie. Kapitel 7 behandelt die empirische Umsetzung, die Datenauswertung und die Ergebnisse der Regressionsanalyse.
Schlüsselwörter
Vertrauen in die Europäische Union, politische Unterstützung, Legitimität, EU-Integration, alte und neue Mitgliedsstaaten, Vergleichende Analyse, empirische Forschung, Regressionsanalyse, Faktoranalyse.
Häufig gestellte Fragen zum Vertrauen in die EU
Worauf basiert das Vertrauen der Bürger in die EU?
Das Vertrauen hängt stark von drei Faktoren ab: Vertrauen in das nationale Parlament, Zufriedenheit mit der EU-Demokratie und Vertrauen in das soziale Sicherungssystem.
Gibt es Unterschiede zwischen alten und neuen Mitgliedsstaaten?
Ja, in West- und Südeuropa wird die EU oft als Teil des heimischen Systems gesehen, während in Großbritannien und Osteuropa die EU eher als „fremde“ Sphäre wahrgenommen wird.
Spielen Religion oder Identität eine große Rolle für das EU-Vertrauen?
Laut der Studie haben Identität und Religion nur einen geringen zusätzlichen Einfluss, wenn politische und ökonomische Faktoren bereits berücksichtigt sind.
Was ist das Konzept der „diffusen Unterstützung“ nach David Easton?
Diffuse Unterstützung bezeichnet eine grundlegende Loyalität gegenüber einem politischen System, die nicht unmittelbar von kurzfristigen Erfolgen abhängt.
Welche Länder wurden in der Regressionsanalyse untersucht?
Die Studie umfasst 14 Länder, darunter Deutschland (Ost/West), Frankreich, Großbritannien, Polen, Tschechien und Ungarn.
- Citar trabajo
- Jacek Biernat (Autor), 2007, Das Vertrauen in die Europäische Union - Determinanten und Dimensionen im Vergleich alter und neuer Mitgliedsstaaten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79432