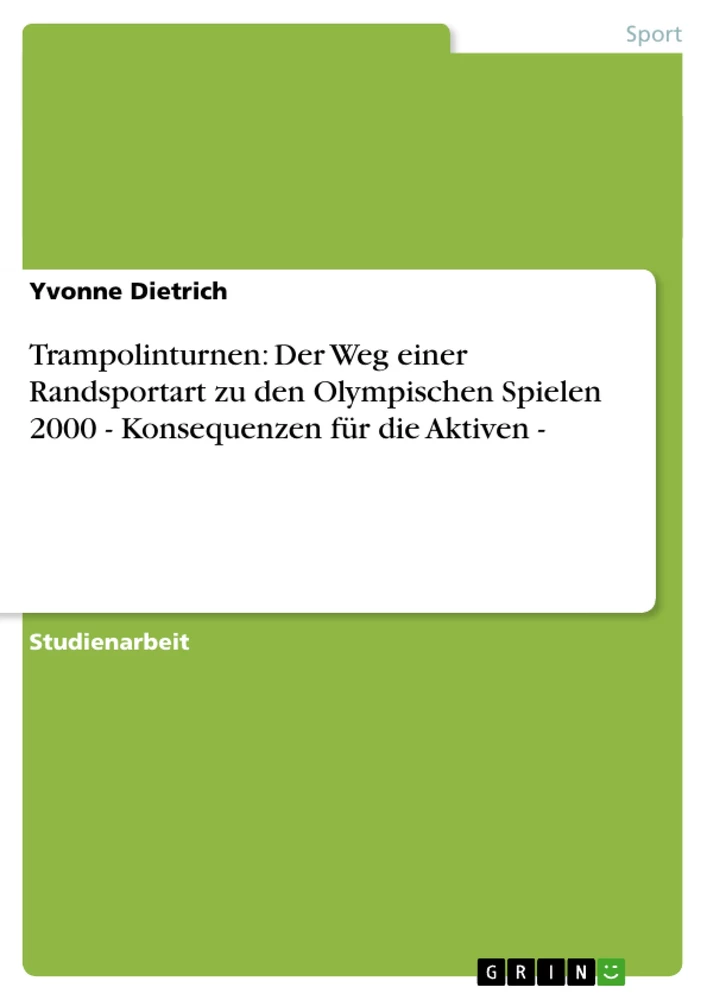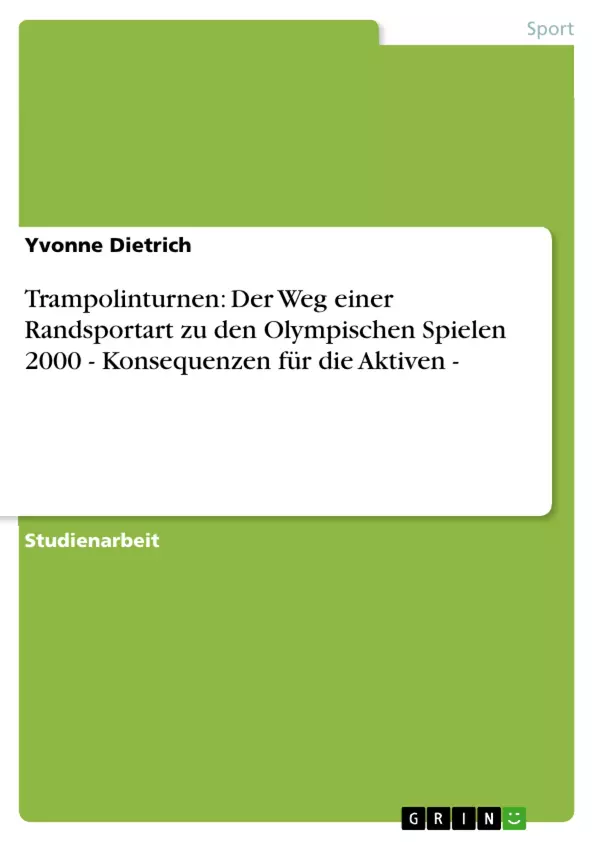In dieser Arbeit werden die neuen Wettkampfbestimmungen erläutert, die mehr oder weniger mit der Aufnahme in das Olympische Programm einhergegangen sind. Insbesondere werden die Konsequenzen für die Aktiven beschrieben, die sich durch die Regeländerungen ergeben haben. Dazu habe ich (selbst ehemalige Trampolinturnerin) einige der national und international erfolgreichen Trampoliner befragt; außerdem habe ich den Bundestrainer und internationale Kampfrichter um Stellungnahmen gebeten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die ersten Schritte auf dem Weg zur Olympischen Anerkennung
- 2.1 Aufwertung der Haltungsnoten
- 2.2 Aufwertung des Schwierigkeitsgrads
- 2.3 Versuchte Einführung eines neuen Systems für die Qualifikation
- 2.4 Der Weg in die Öffentlichkeit
- 3. Die Regeländerungen für Olympia und ihre Auswirkungen
- 3.1 Bewertungssystem
- 3.1.1 Haltungsnoten
- 3.1.2 Schwierigkeitsgrad
- 3.2 Nur acht Teilnehmer im Finale (FIG) bzw. die „2/3-Regelung“ (DTB)
- 3.3 Das Finale beginnt bei Null Punkten
- 3.4 Das KO-System im Finale
- 3.5 Offizielle Änderungen
- 3.1 Bewertungssystem
- 4. Sydney 2000 – die olympische Premiere
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Weg des Trampolinturnens zu den Olympischen Spielen 2000 und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Aktiven. Sie analysiert die verschiedenen Versuche, die Sportart attraktiver zu gestalten, und beleuchtet die Auswirkungen der Regeländerungen auf nationaler und internationaler Ebene.
- Entwicklung des Trampolinturnens zur olympischen Disziplin
- Regeländerungen im Bewertungssystem und deren Auswirkungen
- Änderungen im Wettkampfformat und deren Einfluss auf die Athleten
- Konsequenzen für die Aktiven im professionellen Bereich (Training, Finanzierung)
- Bewertung der olympischen Premiere in Sydney 2000
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit beschreibt den langen Weg des Trampolinturnens zur Anerkennung als olympische Disziplin, beginnend mit den ersten Weltmeisterschaften 1964 bis zur Aufnahme in das olympische Programm im Jahr 2000. Der Fokus liegt auf den Konsequenzen der damit verbundenen Regeländerungen für die Athleten, da diese die Hauptbetroffenen sind. Der Mangel an Fachliteratur wird erwähnt, und die Arbeit basiert auf qualitativen Interviews mit verschiedenen Akteuren der Trampolin-Szene.
2. Die ersten Schritte auf dem Weg zur Olympischen Anerkennung: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Strategien und Maßnahmen, die unternommen wurden, um die Attraktivität des Trampolinturnens zu steigern und die Aufnahme in das olympische Programm zu erreichen. Es werden detailliert die Veränderungen im Bewertungssystem (Aufwertung der Haltungsnoten und des Schwierigkeitsgrades) sowie der Versuch einer neuen Qualifikationsregelung (M19/M20) erläutert. Der Kapitel beschreibt auch die Bemühungen um eine größere Medienpräsenz und den letztendlich erfolgreichen Beitritt zum Internationalen Turnverband (FIG) als Voraussetzung für die olympische Anerkennung.
3. Die Regeländerungen für Olympia und ihre Auswirkungen: Dieses Kapitel analysiert die tiefgreifenden Konsequenzen der Angleichung des Trampolinturnens an den "Code of Points" der FIG. Es werden die Veränderungen im Bewertungssystem, die Reduzierung der Teilnehmerzahl im Finale, das bei Null Punkten beginnende Finale und die Einführung des KO-Systems im Finale detailliert erläutert. Die Auswirkungen dieser Regeländerungen auf die Athleten, Trainer und Offiziellen werden kritisch diskutiert, wobei sowohl die Vor- als auch die Nachteile beleuchtet werden. Die unterschiedliche Umsetzung der Regeln auf nationaler und internationaler Ebene wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Trampolinturnen, Olympische Spiele, Regeländerungen, Bewertungssystem, Schwierigkeitsgrad, Haltungsnoten, Athleten, Trainer, FIG, DTB, Sydney 2000, KO-System, Medienpräsenz, Internationaler Turnverband, Internationale Wettkampfbestimmungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Der Weg des Trampolinturnens zu den Olympischen Spielen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Weg des Trampolinturnens zur Aufnahme in die Olympischen Spiele 2000 und die daraus resultierenden Folgen für die Athleten. Sie analysiert die Strategien zur Steigerung der Attraktivität des Sports und die Auswirkungen der Regeländerungen auf nationaler und internationaler Ebene. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine detaillierte Beschreibung der Entwicklungsschritte zur Olympischen Anerkennung, eine Analyse der Regeländerungen für die Olympischen Spiele und deren Folgen, sowie eine Zusammenfassung der Olympischen Premiere in Sydney 2000. Sie basiert auf qualitativen Interviews und beleuchtet den Mangel an bestehender Fachliteratur zu diesem Thema.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des Trampolinturnens zur olympischen Disziplin, die Regeländerungen im Bewertungssystem und deren Auswirkungen, die Veränderungen im Wettkampfformat und deren Einfluss auf die Athleten, die Konsequenzen für die Aktiven im professionellen Bereich (Training, Finanzierung) und eine Bewertung der olympischen Premiere in Sydney 2000.
Welche konkreten Regeländerungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Veränderungen im Bewertungssystem (Aufwertung von Haltungsnoten und Schwierigkeitsgrad), die Reduzierung der Teilnehmerzahl im Finale (auf acht Teilnehmer nach FIG-Regeln bzw. die „2/3-Regelung“ des DTB), den Start des Finales bei Null Punkten und die Einführung eines KO-Systems im Finale. Die unterschiedliche Umsetzung der Regeln auf nationaler und internationaler Ebene wird ebenfalls beleuchtet.
Wie wurde die Attraktivität des Trampolinturnens gesteigert?
Um die Attraktivität des Trampolinturnens zu steigern und die olympische Anerkennung zu erreichen, wurden verschiedene Strategien verfolgt: Aufwertung der Haltungsnoten und des Schwierigkeitsgrades im Bewertungssystem, Versuche zur Einführung eines neuen Qualifikationssystems (M19/M20) und Bemühungen um eine größere Medienpräsenz. Der Beitritt zum Internationalen Turnverband (FIG) war eine entscheidende Voraussetzung für die olympische Anerkennung.
Welche Konsequenzen hatten die Regeländerungen für die Athleten?
Die Regeländerungen hatten tiefgreifende Konsequenzen für die Athleten, Trainer und Offiziellen. Die Arbeit diskutiert kritisch sowohl die Vor- als auch die Nachteile der Änderungen und beleuchtet deren Auswirkungen auf den professionellen Bereich (Training und Finanzierung).
Welche Rolle spielte der Internationale Turnverband (FIG)?
Der Internationale Turnverband (FIG) spielte eine entscheidende Rolle, da die Aufnahme des Trampolinturnens in das olympische Programm nur durch die Mitgliedschaft im FIG möglich war. Die Angleichung an den "Code of Points" der FIG hatte weitreichende Folgen für das Bewertungssystem und das Wettkampfformat.
Welche Bedeutung hatte die Olympische Premiere in Sydney 2000?
Die Olympische Premiere in Sydney 2000 markierte einen Meilenstein in der Geschichte des Trampolinturnens. Die Arbeit bewertet diese Premiere und analysiert die Erfahrungen und Folgen für alle Beteiligten.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit erwähnt einen Mangel an Fachliteratur und basiert hauptsächlich auf qualitativen Interviews mit verschiedenen Akteuren der Trampolin-Szene.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Trampolinturnen, Olympische Spiele, Regeländerungen, Bewertungssystem, Schwierigkeitsgrad, Haltungsnoten, Athleten, Trainer, FIG, DTB, Sydney 2000, KO-System, Medienpräsenz, Internationaler Turnverband, Internationale Wettkampfbestimmungen.
- Quote paper
- Yvonne Dietrich (Author), 2002, Trampolinturnen: Der Weg einer Randsportart zu den Olympischen Spielen 2000 - Konsequenzen für die Aktiven -, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7944