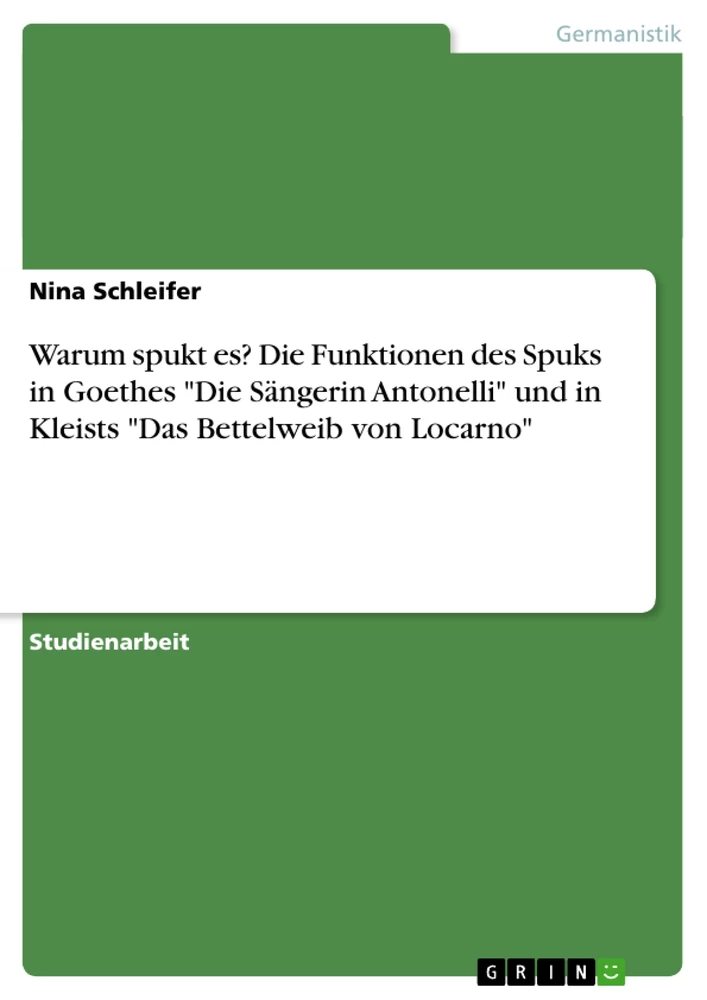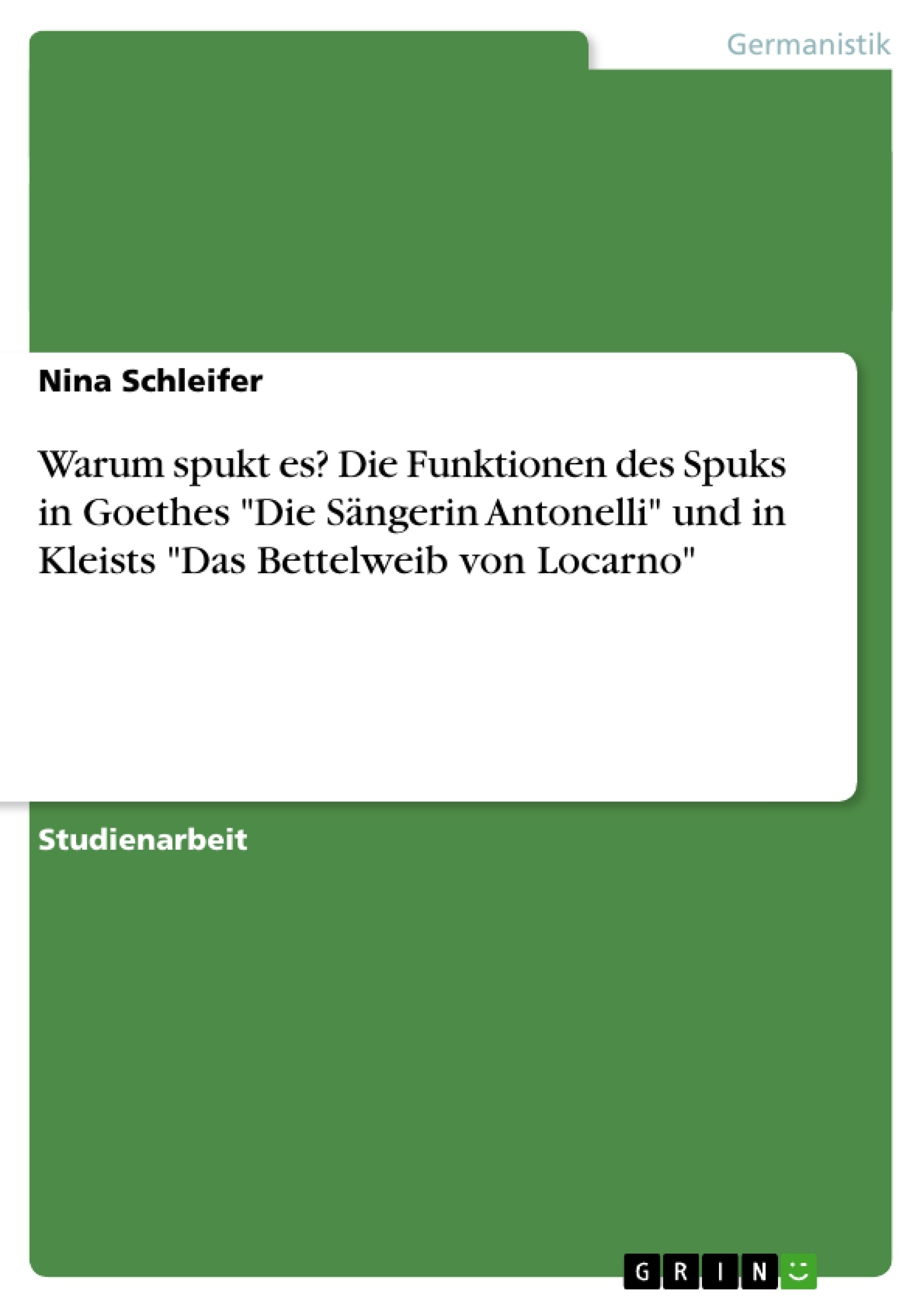Johann Wolfgang von Goethe und Heinrich Kleist sind unbestreitbar zwei der bedeutendsten Autoren der deutschen Literaturgeschichte.
So gilt Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten als erste neuere Novellendichtung, während das Bettelweib „mehr als jede andere deutsche Gespenstergeschichte die spätere Entwicklung der Gattung beeinflusst hat“.
Jedoch wird von Literaturwissenschaftlern Goethes Sängerin Antonelli, die eine Erzählung der Unterhaltungen ist, verurteilt als „geringfügige Erzählung, die wir gern unter seinen Werken gemisst hätten“ und das Bettelweib bekommt die vernichtende Kritik, die Novelle sei „weiter nichts ist als eine Schauermär“. Man kann nicht bestreiten, dass die Erzählhandlungen eher von banaler Natur sind; die Frage ist, was die beiden Literaten an dem Stoff interessierten.
Warum verfassen beide, entgegen ihres sonstigen Erzählwerkes, Gespenstergeschichten, die eigentlich der Trivialliteratur zugeschrieben sind? Was fasziniert die Autoren an dem Spuk und welche Funktionen hat er inne – kurzum: Warum spukt es in den beiden Werken?
Inhaltsverzeichnis
- Warum spukt es?
- Der Spuk als unerhörte Begebenheit
- Die Erzählstruktur im „Bettelweib von Locarno“
- Die Kommunikation zwischen Rahmen- und Binnenhandlung in „Die Sängerin Antonelli“
- Der Spuk in den Werken
- Die Gespenster- und Schauermär
- „Das Bettelweib von Locarno“
- Ironische Metaphysik im kritischen Geisterdiskurs
- (Un)erhört – die Welt des Klangs
- „Die Sängerin Antonelli“
- Der Spuk - das fantastische Phänomen
- Eros und Schauer
- Der Spuk - Ausdruck der politischen Meinung der beiden Autoren
- Kleists Kritik an der Ständegesellschaft
- Versteckte Kritik an der Französischen Revolution in Goethes „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“
- Die Funktion des Spuks – Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion des Spuks in zwei bekannten Gespenstergeschichten: Goethes „Die Sängerin Antonelli“ und Kleists „Das Bettelweib von Locarno“. Durch die Analyse der Erzählstruktur und der darin enthaltenen „unerhörten Begebenheit“ beleuchtet sie, wie der Spuk in beiden Werken sowohl als fantastisches Phänomen als auch als Ausdruck der politischen Meinung der Autoren fungiert.
- Die Funktion des Spuks in der novellenhaften Erzählstruktur
- Die Verbindung zwischen dem Spuk und der Welt des Klangs
- Der Spuk als Ausdruck von Kritik an der Gesellschaft und den bestehenden Machtstrukturen
- Die Verwendung von Metaphern und Symbolen im Kontext des Spuks
- Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Gestaltung des Spuks bei Goethe und Kleist
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die Gemeinsamkeiten der beiden Werke, die sich durch die „unerhörte Begebenheit“ des Spuks auszeichnen.
Kapitel zwei untersucht die spezifischen Erzählstrukturen beider Geschichten: „Das Bettelweib von Locarno“ und „Die Sängerin Antonelli“. Es betrachtet die Bedeutung der Rahmenform in der mündlichen Erzählung, die Unterbrechungen und Andeutungen zur Hervorhebung wichtiger Stellen sowie die Kommunikation zwischen Rahmen- und Binnenhandlung.
Kapitel drei konzentriert sich auf die Gestaltung des Spuks in den beiden Werken, indem es auf die Gespenster- und Schauermär sowie die spezifischen Elemente der Erzählung eingeht. Es analysiert die Rolle des Klangs, die Metaphysik des Spuks und die Darstellung des Eros und Schauers.
Schlüsselwörter
Die Arbeit untersucht die Funktion des Spuks in zwei literarischen Werken, Goethes „Die Sängerin Antonelli“ und Kleists „Das Bettelweib von Locarno“. Die Schlüsselbegriffe umfassen die „unerhörte Begebenheit“, die „mündliche Erzählung“, die „Klangwelt“, die „Kritik an der Gesellschaft“, die „Metaphysik des Spuks“ und die „Schauermär“.
- Quote paper
- Nina Schleifer (Author), 2006, Warum spukt es? Die Funktionen des Spuks in Goethes "Die Sängerin Antonelli" und in Kleists "Das Bettelweib von Locarno", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79566