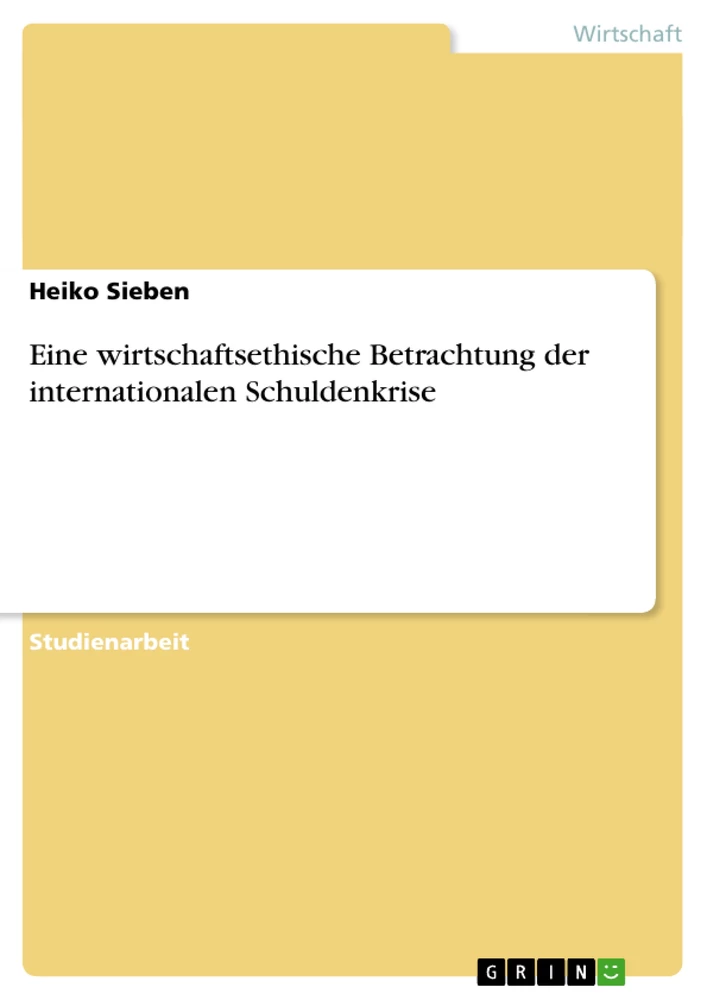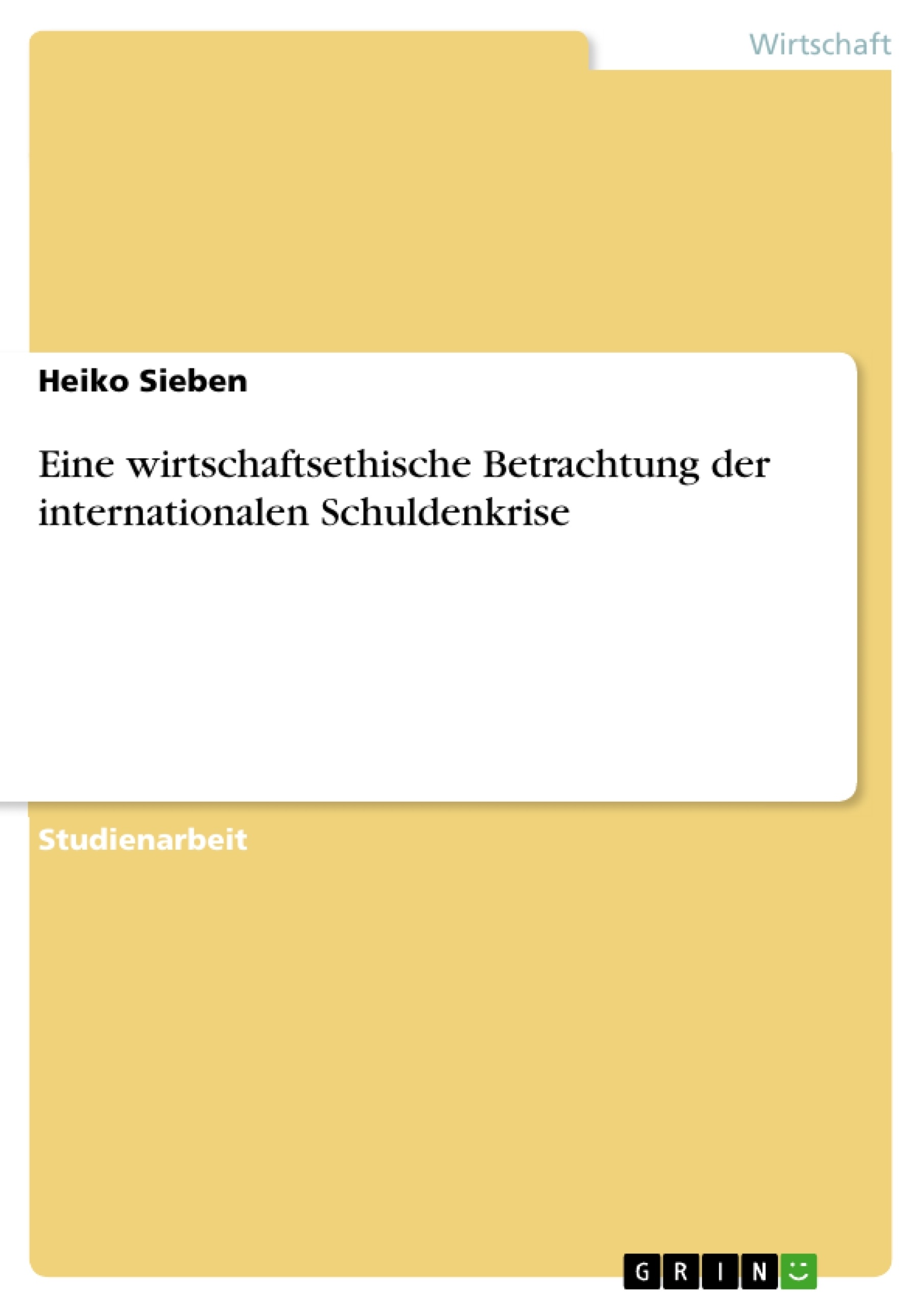Bevor wir eine wirtschaftsethische Betrachtung der internationalen Schuldenkrise vornehmen möchten, ist eine genaue Definition von "Armut" - dem vorherrschenden Zustand in den Schuldnerländern - unerlässlich. Denn bevor auf mögliche Ansätze zur "Bekämpfung" der Armut eingegangen wird, stellt sich die Frage, was überhaupt "bekämpft" werden soll (vgl. SÜDWIND e.V., 2001, S. 6).
In der Fachliteratur wurde häufig das Einkommen der Menschen verschiedener Staaten als Maßstab für Armut genommen. Die Weltbank nannte Menschen arm, die mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen mussten. Das ist der Betrag, der zur Deckung des Mindestbedarfs an Ernährung ausreichen soll. Doch Menschen in den reichen Industrieländern können mit einem Einkommen arm sein, das sie in armen Staaten zu wohlhabenden Menschen machen würde. Daher wurden in weiteren Schritten nationale bzw. regionale Schwellenwerte festgelegt, die zwischen zwei Dollar für Lateinamerika und der Karibik über vier Dollar für Länder in Osteuropa und der GUS bis hin zu 14,40 Dollar für die Industrieländer schwanken (vgl. UNDP , 1997, S. 39).
Neben dem Einkommen ist allerdings eine Vielzahl von weiteren Aspekten zu berücksichtigen. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) unterscheidet zwischen Einkommensarmut und menschlicher Armut. Dies erlaubt eine bessere Annäherung an das Phänomen der Armut in der Welt: "Armut manifestiert sich in den Entbehrungen, die das Leben der Menschen bestimmen. Armut bedeutet häufig nicht nur das Fehlen notwendiger Voraussetzungen für materielles Wohlbefinden, sondern auch die Vorenthaltung von Chancen auf eine erträgliches Leben. [...] Entscheidend sind die Möglichkeiten, ein langes und gesundes Leben zu führen, Bildung zu erwerben und einen angemessenen Lebensstandard zu genießen. Sie werden ergänzt durch politische Freiheiten, garantierte Menschenrechte und verschiedene Elemente der Selbstachtung" (UNDP 1997, S. 17ff).
Armartya Sen, der 1998 den Nobelpreis für Wirtschaft erhielt, hat eine Grundlage geschaffen, um Armut messbar zu machen. In seinem Buch "On Economic Inequality" (1997) fordert er, dass man statt Geld die "capability " vergleichen sollte. Marris (2001, S. 28) versteht darunter - etwas frei ausgelegt - den Begriff "Lebensqualität", d.h., dass die "capability" einer Person daran gemessen werden kann, ob und in welchem Umfang sie in der Lage ist, das Leben zu führen, das sie führen möchte.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Armut – eine Begriffsbestimmung.
- Verschuldung ...
- Ursachen der Verschuldung
- Aktueller Schuldenstand
- Strukturanpassungsprogramme (SAP) ..
- Schuldenerlass
- Begründungsansätze für eine Schuldenreduzierung
- Schuldenerlass für die HIPC-Länder ......
- Internationales Insolvenzrecht – Ein Lösungsansatz?
- Eine wirtschaftsethische Betrachtung...
- Zukunftsethik.
- Verantwortungsbewusstsein
- Ethik der absoluten Verantwortung.
- Utilitarismus ........
- Diskursethik.
- Gerechtigkeitsethik
- Schlussfolgerung.
- Anhang.
- Literatur..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der internationalen Schuldenkrise aus einer wirtschaftsethischen Perspektive und analysiert die Ursachen, Folgen und möglichen Lösungen für die Verschuldung von Entwicklungsländern. Ziel ist es, die ethischen Dimensionen der Krise zu beleuchten und zu bewerten, welche ethischen Prinzipien bei der Suche nach Lösungen berücksichtigt werden sollten.
- Ethische Aspekte der Schuldenkrise
- Ursachen und Folgen der Verschuldung
- Mögliche Lösungsansätze
- Anwendbarkeit ethischer Prinzipien
- Wirtschaftsethik und globale Gerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff „Armut“ und stellt verschiedene Ansätze zur Messung und Beurteilung der Armut in der Welt vor. Der zweite Abschnitt befasst sich mit den Ursachen der Verschuldung von Entwicklungsländern, dem aktuellen Schuldenstand und den Auswirkungen der Strukturanpassungsprogramme auf die betroffenen Länder. Das dritte Kapitel analysiert verschiedene Argumente für einen Schuldenerlass und betrachtet den Schuldenerlass für HIPC-Länder sowie die Möglichkeit eines internationalen Insolvenzrechts.
Schlüsselwörter
Internationale Schuldenkrise, Armut, Verschuldung, Entwicklungsländer, Strukturanpassungsprogramme, Schuldenerlass, HIPC-Länder, Wirtschaftsethik, Zukunftsethik, Utilitarismus, Diskursethik, Gerechtigkeitsethik
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Armut in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Einkommensarmut (weniger als ein bestimmter Dollarbetrag pro Tag) und menschlicher Armut, die auch den Mangel an Bildung, Gesundheit und politischen Freiheiten umfasst.
Was sind die Ursachen der internationalen Schuldenkrise?
Untersucht werden ökonomische Faktoren in den Entwicklungsländern sowie die Auswirkungen von Strukturanpassungsprogrammen (SAP), die oft zu sozialen Härten führen.
Welche ethischen Theorien werden zur Beurteilung herangezogen?
Die Arbeit nutzt Ansätze wie den Utilitarismus, die Diskursethik, die Gerechtigkeitsethik und die Zukunftsethik, um die Schuldenkrise zu bewerten.
Was versteht Amartya Sen unter "Capability"?
Sen schlägt vor, statt reinem Geld die Fähigkeiten einer Person zu vergleichen, also in welchem Umfang sie in der Lage ist, das Leben zu führen, das sie führen möchte (Lebensqualität).
Ist ein Schuldenerlass für HIPC-Länder eine Lösung?
Die Arbeit diskutiert Begründungsansätze für eine Schuldenreduzierung bei hochverschuldeten armen Ländern (Heavily Indebted Poor Countries) und betrachtet auch die Idee eines internationalen Insolvenzrechts.
- Quote paper
- Heiko Sieben (Author), 2002, Eine wirtschaftsethische Betrachtung der internationalen Schuldenkrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7957