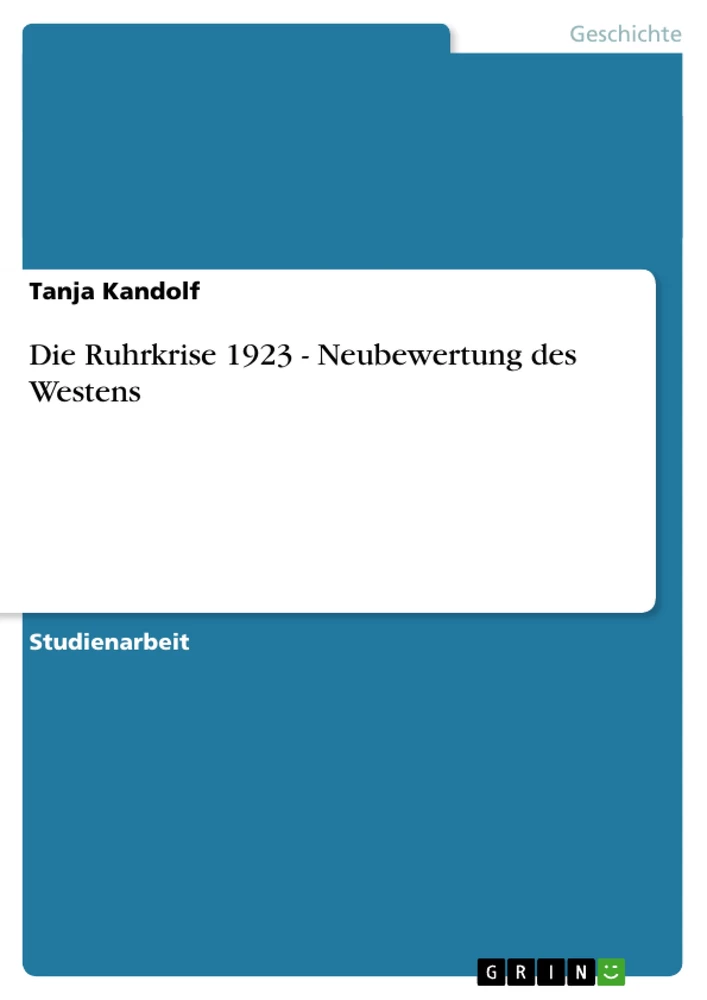Seit der Gründung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalens durch die britische Militärverwaltung im Jahr 1946 existiert im Westen Deutschlands eine Region, welche bis in die Gegenwart ihre Landesidentifikation sowie den mentalen und kulturellen Ursprung zu definieren versucht. Noch heute, im Jahr 2006, sind Klischees und Vorurteile unter den „Rheinländern“ und “Westfalen“ zu konstatieren, welche die Differenzen betonen und eine gemeinsame Landesidentität negieren. Eine Fülle von Literatur zur Geschichte der Landesteile ist veröffentlicht worden, ebenso wie die Geschichte des Landes historisch breit illustriert ist . Die gemeinsame historische Ereignisgeschichte des Rheinlandes und des „Ruhrgebiets“ - welches keine offizielle Verwaltungsbezeichnung ist- während der Ruhrkrise 1923, wird im Folgenden Gegenstand sein. Mögliche Konsequenzen in der Raumfrage sollen an Hand von politisch kontrafaktischen Lösungsalternativen zur Befriedung des Konflikts aufgezeigt werden. Vorangestellt wird die Entwicklung des deutsch- französischen Konflikts an Rhein und Ruhr nach dem Ende des ersten Weltkriegs. Der Umgang mit der Besetzung und die separatistischen Bewegungen sollen erste Belege für das Verhalten der Bevölkerung im Westen liefern.
War der Verlauf der Jahre ab 1923 ein politisches Kalkül, oder lassen sich in diesem Zeitabschnitt eine gemeinsame Identifikationsentwicklung und ein kollektives Bewusstsein der Region erkennen? Kann aus der Geschichte des Ruhrkampfes eine Ideengeschichte des späteren Bundeslandes Nordrhein- Westfalen (NRW) postuliert werden? Antworten auf diese Fragen können nur einen anfänglichen Versuch darstellen, an Hand der chronologischen Fakten, der politischen Entscheidungen und dem zivilen Verhalten soll jedoch hiermit ein Anstoß gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Ruhrbesetzung
- passiver Widerstand
- Aktiver Widerstand
- Separatistische Bewegungen
- Lösungsalternativen
- Luthers Vorschlag
- Die „ultimative Lösung“ des Reichinnenministers Jarres
- Konrad Adenauer
- Der kommunistische Kurs
- Die Visionen Hitlers
- Zeitgenössische Wahrnehmung der Besetzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Ruhrkrise 1923 und ihrer Bedeutung für die Entstehung einer Landesidentität im Westen Deutschlands. Ziel ist es, den Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich sowie die Reaktionen der Bevölkerung im Westen zu analysieren und die möglichen Auswirkungen auf die spätere Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen zu untersuchen.
- Die deutsche Kriegsschuldfrage und die Reparationsforderungen nach dem Ersten Weltkrieg
- Die Ruhrbesetzung durch Frankreich und die Reaktionen der deutschen Bevölkerung
- Die Entstehung und Entwicklung separatistischer Bewegungen im Westen Deutschlands
- Verschiedene Lösungsvorschläge zur Beendigung der Ruhrkrise
- Die Auswirkungen der Ruhrkrise auf die Wahrnehmung und Entwicklung des Westens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den historischen Hintergrund der Ruhrkrise und stellt die Frage nach einer gemeinsamen Identifikationsentwicklung und einem kollektiven Bewusstsein im Westen Deutschlands. Im zweiten Kapitel wird die Ruhrbesetzung im Kontext der Reparationsforderungen nach dem Ersten Weltkrieg dargestellt, wobei der Fokus auf den passiven und aktiven Widerstand der Bevölkerung liegt. Das dritte Kapitel befasst sich mit separatistischen Bewegungen und Lösungsalternativen zur Beendigung des Konflikts. Das vierte Kapitel beleuchtet die zeitgenössische Wahrnehmung der Besetzung. Abschließend werden in einem Fazit die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Ruhrkrise, Reparationen, Besetzung, Widerstand, Separatisten, Landesidentität, Nordrhein-Westfalen, Westfalen, Rheinland, Ruhrgebiet, Deutschland, Frankreich, Geschichte, Politik, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Ursache der Ruhrbesetzung 1923?
Die Besetzung durch französische und belgische Truppen erfolgte aufgrund von Rückständen bei den deutschen Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg.
Was versteht man unter "passivem Widerstand" während der Ruhrkrise?
Die deutsche Regierung rief die Bevölkerung auf, die Zusammenarbeit mit den Besatzern zu verweigern, was zur Einstellung der Arbeit in Bergwerken und Fabriken führte.
Welche Rolle spielten separatistische Bewegungen im Westen?
Während der Krise gab es Bestrebungen, das Rheinland oder das Ruhrgebiet vom Deutschen Reich abzuspalten, oft unterstützt durch französische Interessen.
Hat die Ruhrkrise eine gemeinsame Landesidentität in NRW gefördert?
Die Arbeit untersucht, ob das kollektive Bewusstsein und der gemeinsame Widerstand im Rheinland und in Westfalen als Keimzelle für das spätere Bundesland NRW gelten können.
Welche Lösungsalternativen wurden damals diskutiert?
Es gab verschiedene Vorschläge, von Luthers diplomatischen Ansätzen über Adenauers Positionen bis hin zu radikalen Visionen der Kommunisten oder Hitlers.
- Quote paper
- Tanja Kandolf (Author), 2006, Die Ruhrkrise 1923 - Neubewertung des Westens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79581