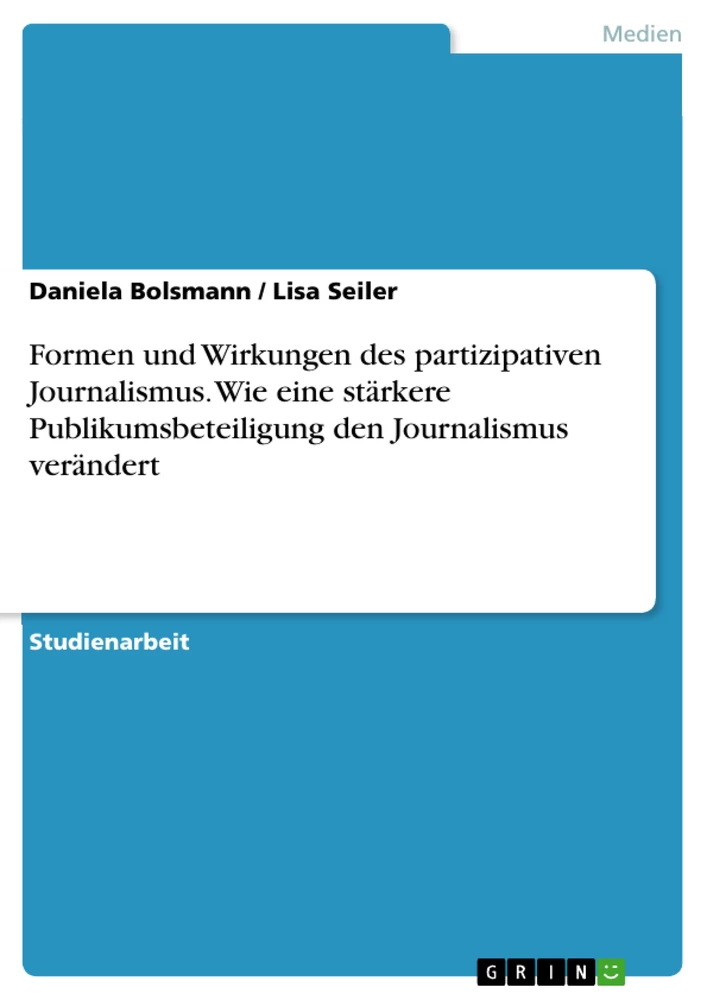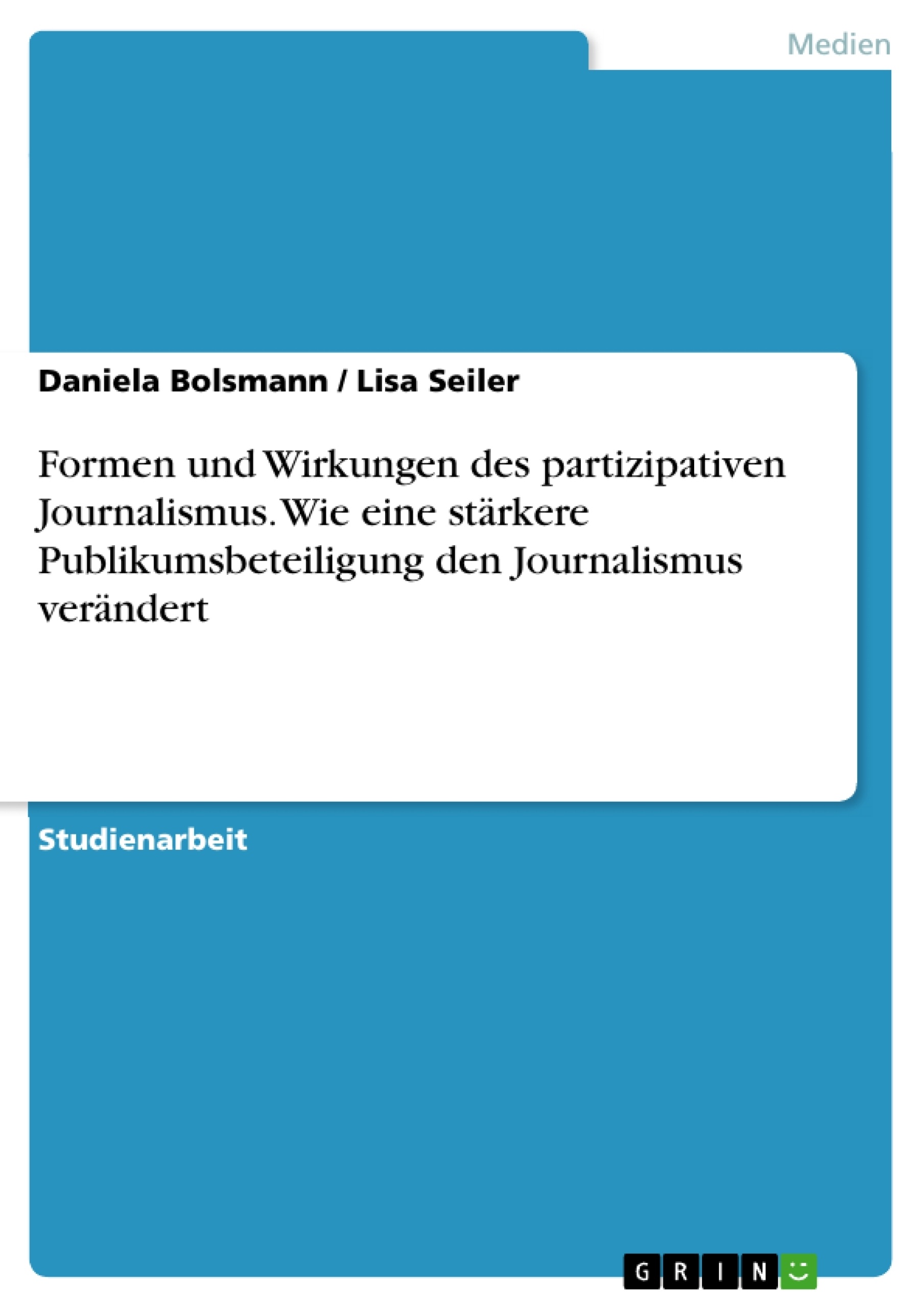...
Diese Arbeit widmet sich einer speziellen Form der Publikumsbeteiligung, die hier in Anlehnung an die Definition von Joyce Nip (2006) als „participatory journalism“, als par-tizipativer Journalismus also, bezeichnet wird. Unter diesem Stichwort versteht die vorlie-gende Arbeit einen Journalismus, der die Nähe seines Publikums sucht, indem er dieses an den eigenen Prozessen und Produkten beteiligt. Professionelle Journalisten werden dadurch nicht überflüssig, ihre Arbeit wird vom Publikum lediglich unterstützt bzw. ergänzt. Aufgrund seines hohen Potentials an Interaktivität ist das Internet für eine Zusammenarbeit mit dem Publikum besonders geeignet, aber auch in die Berichterstattung anderer Medien kann das Publikum stärker einbezogen werden.
Eine solche Form von Journalismus ist aus zweierlei Gründen interessant. Die neue Vorgehensweise wendet sich klar gegen den traditionellen Journalismus, in dem ein passi-ves Publikum von einer journalistischen Elite informiert wird. Wie ein dominanter Vater glaubt diese Elite ganz genau zu wissen, was für die Schützlinge am besten ist. Der partizipative Journalismus wendet sich gegen diese elitäre Bevormundung, zugleich jedoch will er die Revolte der mündig gewordenen Schützlinge stoppen. Er grenzt sich damit ab von dem Phänomen, das sich als Gegenbewegung zum traditionellen Journalismus versteht: den neuen Formen von Amateurjournalismus im Internet. Interessanterweise versucht der partizipative Journalismus dabei den webbasierten Bürgerjournalismus mit den eigenen Waffen zu schlagen: mit mehr Interaktion und Transparenz, mit Blogs und Wikis. Der par-tizipative Journalismus folgt somit dem Leitspruch von Blogger Jarvis: „Online, you have to give up control to gain power“ (2003).
Ziel dieser Arbeit ist es, den partizipativen Journalismus innerhalb des Spannungsfel-des zwischen den traditionellen und den von Amateuren bestimmten Formen zu verstehen: Wie ist er entstanden? Wie lassen sich partizipative Projekte umsetzen? Und wie wirken sie sich auf den Journalismus insgesamt aus? Die Literatur zum Thema hat diese Fragen bisher noch nicht systematisch und zusammenhängend beantwortet. Diese Arbeit wird die verschiedenen Ansätze daher systematisieren und modellhaft darstellen.
...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung - Publikumsbeteiligung im Journalismus
- 2. Abgrenzung und Definition von partizipativem Journalismus
- 2.1 Traditioneller Journalismus
- 2.1.1 Begriffsbestimmung
- 2.1.2 Kritik am traditionellen Journalismus
- 2.1.3 Interaktionsmodell
- 2.2 Public Journalism
- 2.2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2.2 Entwicklung
- 2.2.3 Philosophie und Ziele
- 2.2.4 Vorgehensweise
- 2.2.5 Kritik und Probleme
- 2.2.6 Interaktionsmodell
- 2.3 Webbasierter Bürgerjournalismus
- 2.3.1 Begriffsbestimmung
- 2.3.2 Entwicklung
- 2.3.3 Formen des webbasierten Bürgerjournalismus
- 2.3.3.1 Weblogs
- 2.3.3.2 Podcasts
- 2.3.3.3 Wikis
- 2.3.4 Konkurrenzverhältnis
- 2.3.5 Interaktionsmodell
- 2.4 Partizipativer Journalismus
- 2.4.1 Begriffsbestimmung
- 2.4.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den anderen Interaktionsmodellen
- 3. Formen des partizipativen Journalismus
- 3.1 Die Anfänge: Medien nutzen ihr Publikum
- 3.1.1 Katastrophenberichterstattung - Augenzeugen beliefern Medien
- 3.1.2 OhmyNews
- 3.2 Grundsatzentscheidungen
- 3.3 Modelle des partizipativen Journalismus
- 3.3.1 Stufe 1 - Das Publikum als Kommentator
- 3.3.2 Stufe 2 - Das Publikum als Assistent
- 3.3.3 Stufe 3 - Das Publikum als Produzent
- 3.3.4 Stufe 4 - Das Publikum als Redakteur (Wiki-Journalismus)
- 3.3.5 Überblick über das Vier-Stufen-Modell
- 3.4 Fallbeispiele
- 3.4.1 Saarbrücker Zeitung: Leser-Reporter
- 3.4.2 Rheinische Post: Opinio
- 3.4.3 Netzeitung: Readers Edition
- 3.4.4 Bakersfield Californian: Northwest Voice
- 3.4.5 Minnesota Public Radio
- 3.4.6 Current TV
- 3.4.7 BBC
- 4. Mögliche Folgen des partizipativen Journalismus
- 4.1 Chancen
- 4.1.1 Verbesserung der journalistischen Qualität
- 4.1.2 Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
- 4.2 Risiken und Probleme
- 4.3 Auswirkungen auf das journalistische Berufsbild
- Definition und Abgrenzung von partizipativem Journalismus
- Analyse verschiedener Modelle und Formen des partizipativen Journalismus
- Bewertung der Chancen und Risiken des partizipativen Journalismus
- Betrachtung der Auswirkungen auf das journalistische Berufsbild
- Zusammenhang zwischen dem Aufstieg des Internets und der veränderten Rolle des Publikums
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit dem Einfluss von Publikumsbeteiligung auf den Journalismus. Sie untersucht, wie sich die zunehmende Einbindung von Laien in die Produktion und Verbreitung von Nachrichten auf die journalistische Praxis und das Berufsbild auswirkt.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in das Thema Publikumsbeteiligung im Journalismus und beleuchtet den Wandel der Medienlandschaft im Kontext des Internets. Kapitel zwei befasst sich mit der Definition und Abgrenzung von partizipativem Journalismus und untersucht verschiedene Ansätze wie Public Journalism, webbasierten Bürgerjournalismus und traditionelle Formen der Mediennutzung. Kapitel drei analysiert die Entwicklung und verschiedene Formen des partizipativen Journalismus und präsentiert Fallbeispiele, die die unterschiedlichen Modelle illustrieren. Kapitel vier befasst sich mit den möglichen Folgen des partizipativen Journalismus, sowohl in Bezug auf Chancen wie die Verbesserung der journalistischen Qualität als auch auf Risiken und Probleme, die mit der Einbindung von Laien verbunden sind. Das Kapitel untersucht außerdem die Auswirkungen auf das journalistische Berufsbild.
Schlüsselwörter
Partizipativer Journalismus, Publikumsbeteiligung, Bürgerjournalismus, Public Journalism, Web 2.0, Internet, Medienwandel, Gatekeeper, Journalistisches Berufsbild, Chancen, Risiken, Interaktionsmodell, OhmyNews, Leser-Reporter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist partizipativer Journalismus?
Es ist eine Form des Journalismus, bei der das Publikum aktiv an der Entstehung von Nachrichten beteiligt wird, oft durch Kommentare, Hinweise oder eigene Beiträge.
Wie unterscheidet er sich vom Bürgerjournalismus?
Während Bürgerjournalismus oft unabhängig von Medienhäusern stattfindet, wird partizipativer Journalismus meist von Profis moderiert und in bestehende Medienstrukturen integriert.
Welche Chancen bietet die Publikumsbeteiligung?
Sie erhöht die Transparenz, liefert Augenzeugenberichte in Echtzeit und kann die Bindung der Leser an das Medium stärken.
Was sind die Risiken von partizipativen Projekten?
Probleme können bei der Qualitätssicherung, der Verifizierung von Informationen und rechtlichen Fragen (z.B. Urheberrecht) auftreten.
Wie verändert sich das Berufsbild des Journalisten?
Journalisten wandeln sich zunehmend von alleinigen "Gatekeepern" zu Moderatoren und Kuratoren von Informationen, die aus der Community kommen.
- Quote paper
- Daniela Bolsmann (Author), Lisa Seiler (Author), 2006, Formen und Wirkungen des partizipativen Journalismus. Wie eine stärkere Publikumsbeteiligung den Journalismus verändert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79621