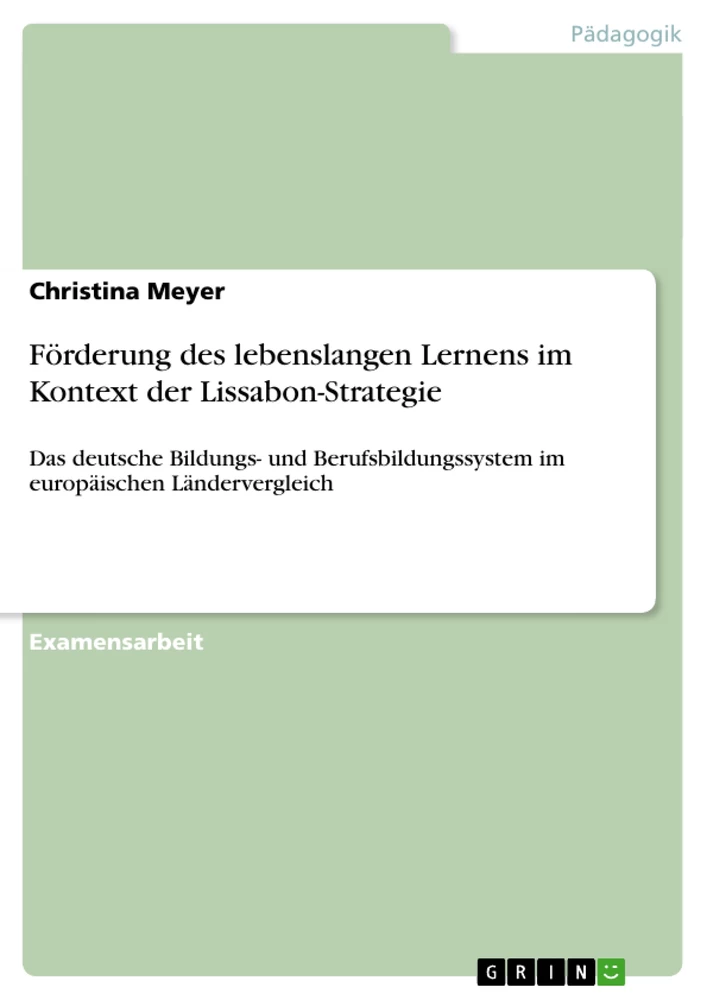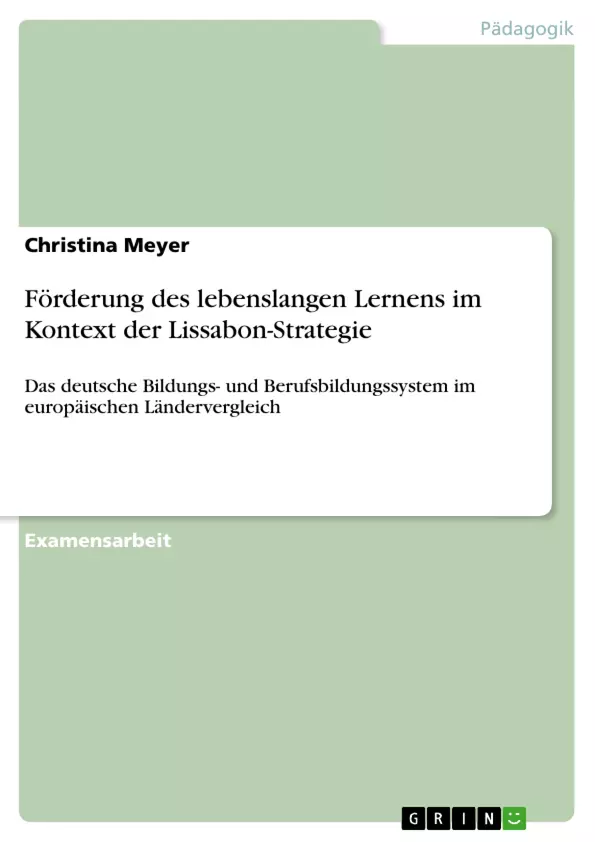Bildung steht in einem durchaus ambivalenten Verhältnis zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Zum einen werden die Bildungsbereiche geprägt durch neue Werthaltungen und Bedürfnisse der Gesellschaft, zum anderen soll Bildung aber auch aktiv dazu beitragen, die Zukunft zu gestalten.
Seit einigen Jahren werden im europäischen Diskurs verstärkt neue gesellschaftliche Entwicklungstendenzen diskutiert.
Die erfolgreiche Bewältigung der so genannten „neuen Herausforderungen“ kann nur mit Hilfe der Bildung geschehen. Als besonders relevant wird innerhalb der EU der Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft angesehen. Die Realisierung dieses neuen Gesellschaftsmodells soll vor allem durch lebenslanges Lernen erfolgen. Damit ist die Implementierung des lebenslangen Lernens zu einem Querschnittsziel der EU-Aktivitäten geworden. Die Lissabon-Strategie der EU aus dem Jahre 2000 und das dazugehörige Arbeitsprogramm 2010 für die allgemeine und berufliche Bildung gelten als wichtiger Schritt in diese Richtung. Die bisherige Erfolgsbilanz fällt allerdings eher dürftig aus, kaum ein Benchmark scheint bis zum gesetzten Zeitpunkt im Jahre 2010 erreichbar. Laut den Zwischenberichten lassen sich große Defizite bei der Implementierung des lebenslangen Lernens verzeichnen. Auch das deutsche Bildungs- und Berufsbildungssystem schneidet schlecht ab. Die Zielvorgabe für lebenslanges Lernen, als Benchmark konkret durch die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen gemessen, wird nicht nur weit verfehlt, im Ländervergleich ist Deutschland sogar ein Schlusslicht in diesem elementaren Bereich der Lissabon-Strategie.
Die Gründe hierfür und daraus resultierende Konsequenzen sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit näher beleuchtet werden. Ist das deutsche Bildungs- und Berufsbildungssystem wirklich „schlechter“ bei der Realisierung einer „Wissensgesellschaft“? In welchem Ausmaß tragen methodische Aspekte zu diesem Ergebnis bei? Ist vielleicht die deutsche Konzeption des lebenslangen Lernens einfach nicht „kompatibel“ mit den quantifizierten Vorstellungen innerhalb der Lissabon-Strategie und führt daher zu einem schlechten Abschneiden? Welche bildungspolitischen Schlussfolgerungen sind aus den Ergebnissen letztendlich zu ziehen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Lebenslanges Lernen als Antwort auf neue Herausforderungen
- 2. Lebenslanges Lernen: Theoretische und programmatische Implikationen
- 2.1 Begriffsbestimmung „Lebenslanges Lernen“
- 2.1.1 Definitionen
- 2.1.2 Funktionen des lebenslangen Lernens
- 2.1.3 Elemente des lebenslangen Lernens
- 2.2 Die berufliche Weiterbildung als elementarer Bestandteil des lebenslangen Lernens
- 2.2.1 Merkmale von Weiterbildung
- 2.2.2 Typologien von Weiterbildung
- 2.2.3 Trägerprofile
- 2.2.4 Funktionen beruflicher Weiterbildung
- 2.3 Themenschwerpunkte der Debatte um das lebenslange Lernen aus Sicht der beruflichen Bildung
- 2.3.1 Individualisierung
- 2.3.2 Pluralisierung der Milieus
- 2.3.3 Veränderte Produktionsmodelle und gewandelte Funktion des Berufes
- 2.3.4 Arbeitslosigkeit und Vorruhestand
- 2.3.5 Konsequenzen für die berufliche Bildung
- 2.4 Theorie- und Praxisebenen des lebenslangen Lernens
- 2.4.1 Lebenslanges Lernen als bildungspolitisches Handlungskonzept
- 2.4.1.1 Begriffsentwicklung im internationalen Diskurs
- 2.4.1.2 Lebenslanges Lernen in der EU
- 2.4.1.3 Gemeinsamkeiten der programmatischen Ansätze
- 2.4.2 Lebenslanges Lernen im erziehungswissenschaftlichen Diskurs
- 2.4.2.1 Kritik an den bildungspolitischen Konzeptionen des lebenslangen Lernens
- 2.4.2.2 Lebenslanges Lernen zwischen Anpassung und Emanzipation
- 2.4.3 Lebenslanges Lernen als subjektives Aneignungskonzept
- 2.4.3.1 Lernen als Aneignungsleistung
- 2.4.3.2 Lernen als lebensweltbezogener Erkenntnisprozess
- 2.4.3.3 Lernen als selbstgesteuerte Kompetenzentwicklung
- 2.4.3.4 Informelles Lernen
- 2.4.4 Lebenslanges Lernen als institutionelles Didaktikkonzept
- 2.4.4.1 Entwicklung einer neuen Lernkultur
- 2.4.4.2 Modularisierung
- 2.4.4.3 Betriebliche Weiterbildung
- 2.5 Optionen für die Bildungs- und Berufsbildungspolitik
- 3. Die Lissabon-Strategie der Europäischen Union
- 3.1 Die Relevanz der Lissabon-Strategie
- 3.2 Untersuchungsmerkmale der Implementierung des lebenslangen Lernens
- 3.3 Das Arbeitsprogramm 2010
- 3.3.1 Die,,Offene Methode der Koordinierung“
- 3.3.1.1 Indikatoren
- 3.3.1.2 Benchmarks
- 3.3.2 Statistischer Ländervergleich im Kontext des Arbeitsprogramms 2010
- 3.3.2.1 Grundsätze und Probleme der Methodik
- 3.3.2.2 Statistische Erfassung des lebenslangen Lernens
- 3.4 Resümee: Erfassung des lebenslangen Lernens in der Lissabon-Strategie
- 4. Das deutsche Bildungs- und Berufsbildungssystem im Ländervergleich
- 4.1 Relevanz und Methodik des Ländervergleichs
- 4.3 Das deutsche Bildungs- und Berufsbildungssystem
- 4.3.1 Politische Ebene
- 4.3.1.1 Rolle der beruflichen Weiterbildung im gesamten Bildungssystem
- 4.3.1.2 Infrastruktur und Hauptakteure
- 4.3.1.3 Ressourcenverwendung und Finanzierung
- 4.3.1.4 Strategien zur Förderung des lebenslangen Lernens
- 4.3.2 Institutionelle Ebene der Weiterbildungsinstitutionen
- 4.3.2.1 Aufgabenschwerpunkte der Weiterbildungsinstitutionen
- 4.3.2.2 Zusammenarbeit der Weiterbildungsanbieter
- 4.3.2.3 Qualitätssicherung
- 4.3.2.4 Planung des Angebotes
- 4.3.2.5 Zertifizierung
- 4.3.3 Institutionelle Ebene der Betriebe
- 4.3.3.1 Angebot der inner- und ausserbetrieblichen Weiterbildung
- 4.3.3.2 Planung
- 4.3.3.3 Qualitätssicherung
- 4.3.3.4 Anreize für KMU
- 4.3.4 Didaktische Ebene
- 4.3.4.1 Lernziele und -inhalte
- 4.3.4.2 Lernarrangements
- 4.3.4.3 Rolle der Lehrenden
- 4.3.5 Individuelle Ebene
- 4.3.5.1 Zugang
- 4.3.5.2 Beratung und Information
- 4.3.5.3 Zielgruppenspezifische Maßnahmen
- 4.4 Das englische Bildungs- und Berufsbildungssystem
- 4.4.1 Strukturelle Grundzüge
- 4.4.1.1 Übergänge nach Beendigung der Pflichtschulzeit
- 4.4.1.2 National Qualifications Framework (NQF)
- 4.4.1.3 National Vocational Qualifications (NVQs)
- 4.4.1.4 General National Vocational Qualifications (GNVQs)
- 4.4.1.5 Grundlegende Merkmale
- 4.4.2 Politische Ebene
- 4.4.2.1 Rolle der beruflichen Weiterbildung im gesamten Bildungssystem
- 4.4.2.2 Infrastruktur und Hauptakteure
- 4.4.2.3 Ressourcenverwendung und Finanzierung
- 4.4.2.4 Strategien zur Förderung des lebenslangen Lernens
- 4.4.3 Institutionelle Ebene der Weiterbildungsinstitutionen
- 4.4.3.1 Aufgabenschwerpunkte der Weiterbildungsinstitutionen
- 4.4.3.2 Zusammenarbeit der Weiterbildungsanbieter
- 4.4.3.3 Qualitätssicherung
- 4.4.3.4 Planung des Angebotes
- 4.4.3.5 Zertifizierung
- 4.4.4 Institutionelle Ebene der Betriebe
- 4.4.4.1 Angebot der inner- und ausserbetrieblichen Weiterbildung
- 4.4.4.2 Planung
- 4.4.4.3 Qualitätssicherung
- 4.4.4.4 Anreize für KMU
- 4.4.5 Didaktische Ebene
- 4.4.5.1 Lernziele und -inhalte
- 4.4.5.2 Lernarrangements
- 4.4.5.3 Rolle der Lehrenden
- 4.4.6 Individuelle Ebene
- 4.4.6.1 Zugang
- 4.4.6.2 Beratung und Information
- 4.4.6.3 Zielgruppenspezifische Maßnahmen
- 4.5 Ergebnisse des Ländervergleichs
- 4.5.1 Politische Ebene
- 4.5.1.1 Rolle der beruflichen Weiterbildung im gesamten Bildungssystem
- 4.5.1.2 Infrastruktur und Hauptakteure
- 4.5.1.3 Ressourcenverwendung und Finanzierung
- 4.5.1.4 Strategien zur Förderung des lebenslangen Lernens
- 4.5.2 Institutionelle Ebene der Weiterbildungsinstitutionen
- 4.5.2.1 Aufgabenschwerpunkte der Weiterbildungsinstitutionen
- 4.5.2.2 Zusammenarbeit der Weiterbildungsanbieter
- 4.5.2.3 Qualitätssicherung
- 4.5.2.4 Planung des Angebotes
- 4.5.2.5 Zertifizierung
- 4.5.3 Institutionelle Ebene der Betriebe
- 4.5.3.1 Angebot der inner- und ausserbetrieblichen Weiterbildung
- 4.5.3.2 Planung
- 4.5.3.3 Qualitätssicherung
- 4.5.3.4 Anreize für KMU
- 4.5.4 Didaktische Ebene
- 4.5.4.1 Lernziele und -inhalte
- 4.5.4.2 Lernarrangements
- 4.5.4.3 Rolle der Lehrenden
- 4.5.5 Individuelle Ebene
- 4.5.5.1 Zugang
- 4.5.5.2 Beratung und Information
- 4.5.5.3 Zielgruppenspezifische Maßnahmen
- Die Bedeutung und Relevanz des lebenslangen Lernens in der heutigen Arbeitswelt
- Die Lissabon Strategie und ihre Implikationen für die Förderung des lebenslangen Lernens
- Der Vergleich des deutschen und englischen Bildungs- und Berufsbildungssystems in Bezug auf die Förderung des lebenslangen Lernens
- Die Rolle der politischen, institutionellen und didaktischen Ebenen bei der Förderung des lebenslangen Lernens
- Die Herausforderungen und Chancen der Förderung des lebenslangen Lernens in Deutschland und England
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Förderung des lebenslangen Lernens im Kontext der Lissabon Strategie und beleuchtet das deutsche Bildungs- und Berufsbildungssystem im europäischen Ländervergleich. Die Arbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen und Chancen des lebenslangen Lernens im deutschen System im Vergleich zum englischen System zu betrachten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des lebenslangen Lernens ein und erläutert seine Relevanz als Antwort auf die Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen und programmatischen Implikationen des lebenslangen Lernens, darunter Begriffsbestimmung, Funktionen und Elemente. Die berufliche Weiterbildung als elementarer Bestandteil des lebenslangen Lernens wird näher betrachtet, einschließlich ihrer Merkmale, Typologien, Trägerprofile und Funktionen. Dieses Kapitel analysiert auch die Themenschwerpunkte der Debatte um das lebenslange Lernen aus Sicht der beruflichen Bildung, wie Individualisierung, Pluralisierung der Milieus, gewandelte Produktionsmodelle und die Folgen für die berufliche Bildung. Darüber hinaus werden die Theorie- und Praxisebenen des lebenslangen Lernens beleuchtet, einschließlich der bildungspolitischen Handlungskonzepte, des erziehungswissenschaftlichen Diskurses, des subjektiven Aneignungskonzepts und des institutionellen Didaktikkonzepts. Kapitel 3 befasst sich mit der Lissabon Strategie der Europäischen Union und ihrer Relevanz für die Förderung des lebenslangen Lernens. Das Arbeitsprogramm 2010, die,,Offene Methode der Koordinierung“, Indikatoren und Benchmarks sowie ein statistischer Ländervergleich im Kontext des Arbeitsprogramms 2010 werden ausführlich analysiert.
Schlüsselwörter
Lebenslanges Lernen, Lissabon Strategie, Berufsbildung, Bildungssystem, Ländervergleich, Deutschland, England, Weiterbildung, Politische Ebene, Institutionelle Ebene, Didaktische Ebene, Individualisierung, Pluralisierung, Arbeitswelt, Herausforderungen, Chancen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Lissabon-Strategie im Bildungsbereich?
Ziel ist der Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft, wobei lebenslanges Lernen als zentrales Instrument zur Zukunftsgestaltung dient.
Warum gilt Deutschland beim lebenslangen Lernen als „Schlusslicht“?
Die Teilnahmequoten an Weiterbildungsmaßnahmen verfehlen die EU-Benchmarks deutlich, was auf strukturelle und methodische Defizite im deutschen System hindeutet.
Was ist die „Offene Methode der Koordinierung“?
Es ist ein Steuerungsmodell der EU, das über Indikatoren und Benchmarks einen Ländervergleich ermöglicht, um nationale Bildungspolitiken zu harmonisieren.
Wie unterscheidet sich das deutsche vom englischen Berufsbildungssystem?
Die Arbeit vergleicht beide Systeme auf politischer, institutioneller und didaktischer Ebene, um Stärken und Schwächen bei der Implementierung von Weiterbildung aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt informelles Lernen?
Informelles Lernen wird als subjektives Aneignungskonzept und wichtiger Bestandteil der Kompetenzentwicklung außerhalb formaler Bildungseinrichtungen betrachtet.
- Quote paper
- Christina Meyer (Author), 2005, Förderung des lebenslangen Lernens im Kontext der Lissabon-Strategie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79651