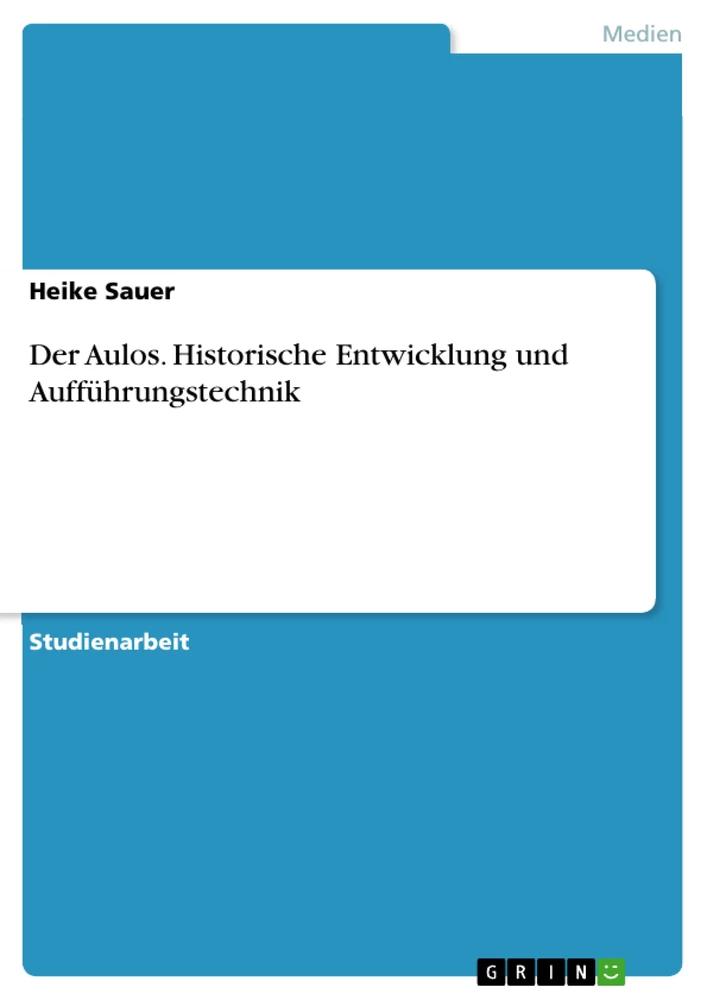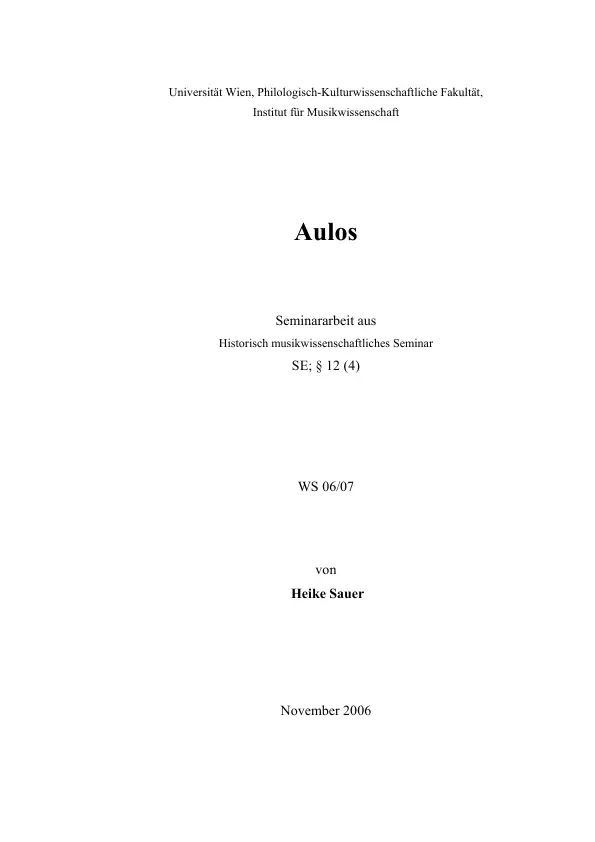„So heißt das Musikinstrument ‚Aulos’, weil die Luft hindurch geht, und alles was, geradlinig ausgestreckt ist, nennen wir Aulos, wie das Stadion und den Blutstrom.“
(Athenaios, Deipnosophistai V, 189 b,c) Auf diese Weise erklärt Athenaios (um 200 nach Chr.) in seinem „Gelehrtenmahl“ das Wort ‚Aulos’ (αυλός), und führt anschließend weitere Übersetzungsmöglichkeiten für ‚Aulos’ oder etymologisch sehr nah verwandte Wörter auf. So seien auch ‚Hof’, ‚Abgrund’, ‚Höhle’ und ‚Palast’ damit bezeichnet worden. Das Wort selbst ist indogermanischer Herkunft; ob die Indogermanen darunter jedoch schon ein Blasinstrument verstanden, oder aber damit einfach eine Röhre oder einen Hohlraum bezeichneten, hat sich bis heute noch nicht klären lassen. Man ist sich nicht einmal sicher, ob in der früheren Instrumentengeschichte ‚Aulos’ nicht nur als ein übergeordneter Sammelbegriff für Blasinstrumente fungierte.
Der Aulos war ein Instrument, das in der Regel paarig gespielt wurde. Das bedeutet, dass zwei unabhängige Röhren, in einem spitzen Winkel zueinander, gleichzeitig verwendet wurden, und dass der Aulet zwei Mundstücke zugleich bewältigen musste. Daraus geht auch die häufig gebrauchte Pluralform ‚Auloi’ hervor, die demnach nicht unbedingt mehrere Instrumentalisten voraussetzen muss.
Die Bohrung der Röhren war meist zylindrisch oder nur minimal konisch, wie es dem natürlichen Wachstum von Knochen, Schilfrohren oder Hölzern entspricht. Den ursprünglichen, einfachen Aulos beschreibt der griechische Schriftgelehrte Pollux (2. Hälfte des 2. Jh. nach Chr.) in seinem „Namenslexikon“ derart exakt, dass man sich genaue Vorstellungen von diesem Instrument machen kann (Abbildung 1):
Bombyx (βόµβυξ) bezeichnet die Röhre, in die die Trypemata (τρυπήµατα), die Grifflöcher, eingearbeitet sind. Zwischen Bombyx und dem Mundstück Zeugos (ζευγος), das manchmal auch nur durch das Teilstück Glotta (γλωττα), die sogenannte Zunge, umschrieben wird, sitzen zwei eiförmige Zwischenstücke, Holmos (όλµος) und Hypholmion (υφόλµιον).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Definition
- 2 Die Entwicklungsgeschichte des Aulos
- 2.1 Von der Frühgeschichte bis zur dorischen Wanderung
- 2.2 Die Zeit der Geometrischen Stile und die Archaische Zeit
- 2.3 Von der Klassik bis zur Spätantike
- 3 Das Mundstück des Aulos
- 4 Aufführungstechnik
- 4.1 Dopplung der Röhren
- 4.2 Überblasen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem antiken Musikinstrument Aulos. Ziel ist es, die Definition, die Entwicklungsgeschichte und die Aufführungstechnik des Aulos zu untersuchen. Dabei werden archäologische Funde und antike schriftliche Quellen herangezogen.
- Definition und Etymologie des Begriffs "Aulos"
- Entwicklung des Aulos von der Frühgeschichte bis zur Spätantike
- Konstruktion und Beschaffenheit des Aulos, insbesondere des Mundstücks
- Aufführungspraktiken, einschließlich Dopplung der Röhren und Überblastechnik
- Vergleich mit anderen antiken Blasinstrumenten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Definition: Der einleitende Abschnitt klärt den Begriff „Aulos“ anhand von Zitaten des Athenaios, der das Wort in seinem „Gelehrtenmahl“ mit Begriffen wie „Röhre“, „Hof“, „Abgrund“ etc. in Verbindung bringt. Die indogermanische Herkunft des Wortes wird erwähnt, jedoch bleibt die ursprüngliche Bedeutung (reine Röhre oder bereits Blasinstrument) unklar. Der Aulos wird als meist paarig gespieltes Instrument beschrieben, wobei die Pluralform „Auloi“ nicht zwangsläufig mehrere Instrumentalisten impliziert. Die zylindrische oder leicht konische Bohrung der Röhren und die detaillierte Beschreibung des Instruments durch Pollux (unter Verwendung von Begriffen wie Bombyx, Zeugos, Holmos und Hypholmion) geben einen Einblick in die Konstruktion.
2 Die Entwicklungsgeschichte des Aulos: Dieses Kapitel untersucht die Ursprünge des Aulos im Kontext der griechischen Kultur, die aus ägäischen und indogermanischen Einflüssen resultiert. Es wird auf die Einwanderung indogermanischer Völker und deren Kontakt mit den minoischen Kulturen hingewiesen. Der früheste Beleg für ein aulosartiges Instrument wird durch Funde aus der ersten Dynastie von Ur (ca. 2450 v. Chr.) präsentiert. Die älteste Darstellung in der Ägäis ist ein Kykladenidol von Keros (ca. 2200-2000 v. Chr.), das einen Aulosspieler zeigt. Obwohl die Instrumente der Funde nicht eindeutig als Rohrblattinstrumente identifiziert werden können, geben sie einen wichtigen Hinweis auf die frühe Verbreitung von aulosartigen Instrumenten.
Schlüsselwörter
Aulos, antikes Musikinstrument, Blasinstrument, Griechenland, Entwicklungsgeschichte, Aufführungstechnik, Archäologie, Etymologie, Rohrblattinstrument, Minoische Kultur, Mykenische Kultur, Indogermanisch, Ägäis.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Der antike Aulos
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem antiken griechischen Musikinstrument Aulos. Sie untersucht dessen Definition, Entwicklungsgeschichte und Aufführungstechnik, basierend auf archäologischen Funden und antiken schriftlichen Quellen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Definition und Etymologie des Begriffs "Aulos", die Entwicklung des Instruments von der Frühgeschichte bis zur Spätantike, die Konstruktion und Beschaffenheit des Aulos (insbesondere des Mundstücks), Aufführungspraktiken (Dopplung der Röhren und Überblastechnik) und einen Vergleich mit anderen antiken Blasinstrumenten.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Definition des Aulos, seiner Entwicklungsgeschichte (unterteilt in Phasen von der Frühgeschichte bis zur Spätantike), dem Mundstück des Aulos und der Aufführungstechnik (einschließlich Dopplung der Röhren und Überblastechnik). Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Seminararbeit stützt sich auf archäologische Funde und antike schriftliche Quellen. Genannt werden beispielsweise Athenaios („Gelehrtenmahl“) und Pollux, deren Beschreibungen des Aulos und seiner Bestandteile (Bombyx, Zeugos, Holmos und Hypholmion) analysiert werden.
Welche Erkenntnisse liefert die Arbeit zur Definition des Aulos?
Die Arbeit untersucht die verschiedenen Bedeutungen des Wortes "Aulos" anhand von Zitaten des Athenaios, der den Begriff mit Wörtern wie "Röhre", "Hof" und "Abgrund" in Verbindung bringt. Die indogermanische Herkunft des Wortes wird thematisiert, die ursprüngliche Bedeutung (reine Röhre oder Blasinstrument) bleibt jedoch unklar. Die Arbeit beschreibt den Aulos als meist paarig gespieltes Instrument, wobei die Pluralform "Auloi" nicht zwingend mehrere Instrumentalisten impliziert. Die zylindrische oder leicht konische Bohrung der Röhren wird ebenfalls beschrieben.
Was wird in der Arbeit über die Entwicklungsgeschichte des Aulos ausgesagt?
Das Kapitel zur Entwicklungsgeschichte untersucht die Ursprünge des Aulos im Kontext der griechischen Kultur, berücksichtigt ägäische und indogermanische Einflüsse und die Einwanderung indogermanischer Völker und deren Kontakt mit den minoischen Kulturen. Frühe Belege für aulosartige Instrumente werden aus der ersten Dynastie von Ur (ca. 2450 v. Chr.) und durch ein Kykladenidol von Keros (ca. 2200-2000 v. Chr.) präsentiert, welches einen Aulosspieler zeigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Aulos, antikes Musikinstrument, Blasinstrument, Griechenland, Entwicklungsgeschichte, Aufführungstechnik, Archäologie, Etymologie, Rohrblattinstrument, Minoische Kultur, Mykenische Kultur, Indogermanisch, Ägäis.
- Citar trabajo
- Mag. Art; Mag. Phil Heike Sauer (Autor), 2006, Der Aulos. Historische Entwicklung und Aufführungstechnik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79665