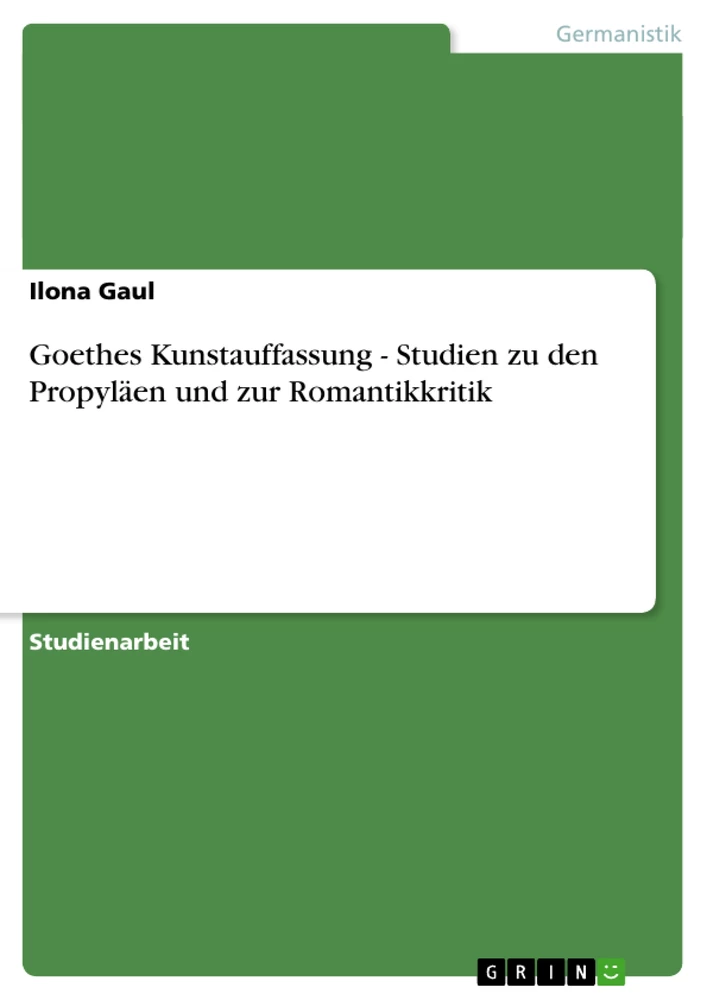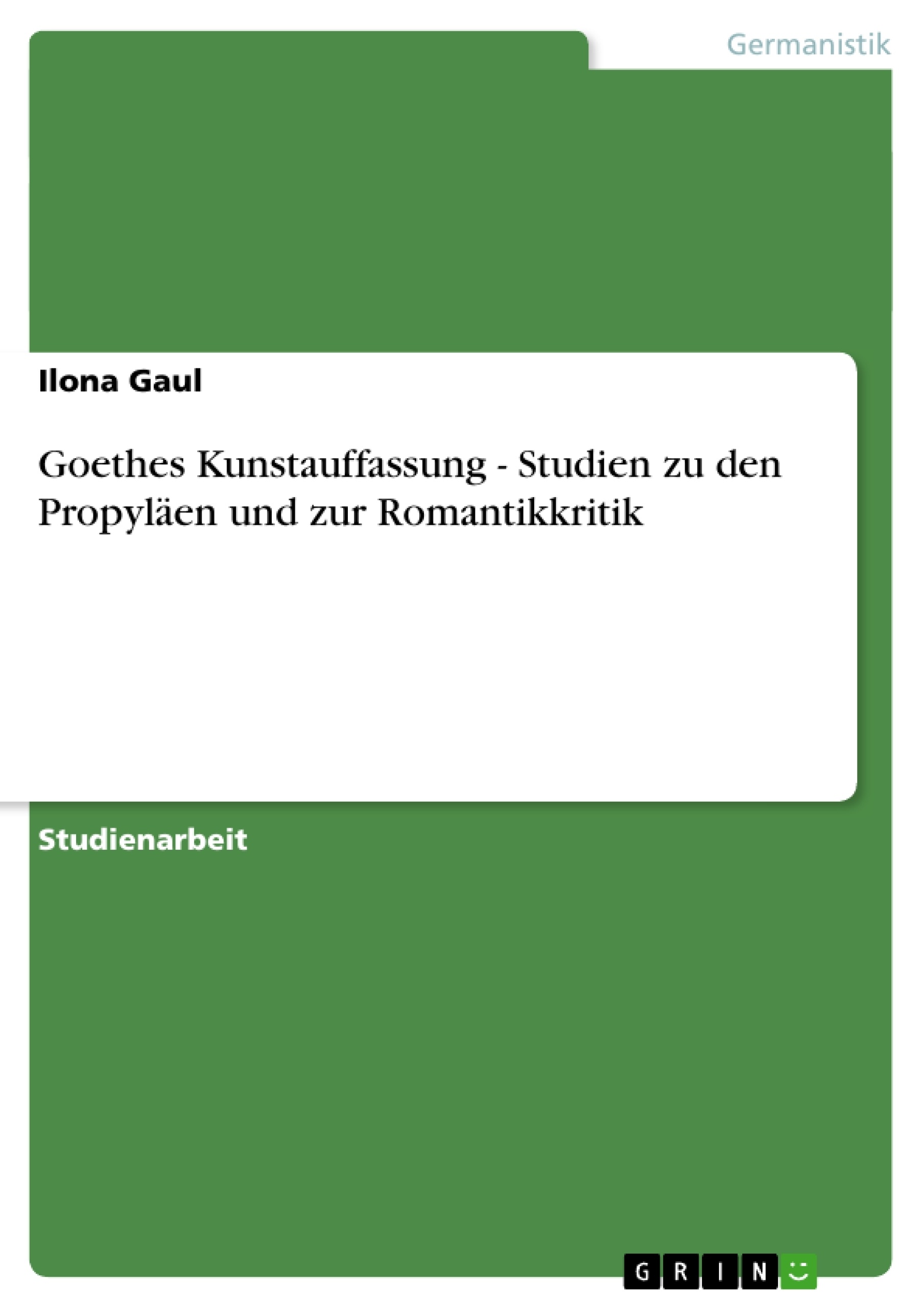[...] Im folgenden soll sich zunächst mit Goethe als Verfechter der Klassik auseinandergesetzt werden. In der klassischen Blütezeit bildet Goethe ein künstlerisches Sendungsbewusstsein aus, das sich vor allem in der Herausgabe der Kunstzeitschrift Propyläen äußert. Diese Periodische Schrift, wie sie im Untertitel heißt, erscheint 1798 bis 1800. Sie enthält sowohl Beiträge von Goethe selbst als auch von Wilhelm und Karoline von Humboldt sowie seinen engen Freunden Johann Heinrich Meyer und Friedrich von Schiller. Den eigentlichen Beiträgen schickt Goethe eine Einleitung voraus, die entscheidende Einblicke in Goethes Auffassung von Kunst gibt. Die dort geäußerten kunsttheoretischen Leitmaximen sollen detailliert betrachtet werden. Darüber hinaus soll der 1817 publizierte Aufsatz Neudeutsche religios-patriotische Kunst beleuchtet werden. Von 1816 bis 1828 betätigt sich Goethe erneut als Herausgeber eines Kunstmagazins, welches zunächst unter dem Titel Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein und Mayn Gegenden erscheint und ab dem zweiten Heft verkürzt als Ueber Kunst und Alterthum herauskommt. Hierin erscheint der Beitrag Neudeutsche religios-patriotische Kunst, der zwar von Meyer verfasst wird, aber aus einer engen Zusammenarbeit mit Goethe resultiert, der - wie aus Briefen und Tagebucheinträgen zu entnehmen ist - vollkommen hinter den Inhalten des Aufsatzes steht. In diesem Beitrag äußert sich nicht nur die Begeisterung für die klassische Antike, sondern hier wird vielmehr eine explizite Ablehnung der romantischen Ideale, insbesondere die der spotthaft so genannten Nazarener deutlich, die in den Propyläen so noch nicht zu finden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Goethes Kunstauffassung. Studien zu den Propyläen und zur Romantikkritik
- Entstehung der Propyläen
- Die Programmatik der Propyläen
- Der Wirkungserfolg der Propyläen
- Der Kampf gegen die Neu-deutsche religios-patriotische Kunst
- Hintergrund der Polemik
- Inhalte und Ziele der Streitschrift
- Zeitgenössische Rezeption
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes Kunstauffassung anhand seiner Beiträge zu den „Propyläen“ und seiner Kritik an der Romantik. Sie beleuchtet die Entwicklung seiner ästhetischen Positionen über verschiedene Lebensphasen hinweg und analysiert seine Auseinandersetzung mit der neu aufkommenden romantischen Kunstbewegung.
- Entwicklung von Goethes Kunstauffassung über seine Lebensphasen
- Die „Propyläen“ als Ausdruck von Goethes klassischer Kunstauffassung
- Goethes Kritik an der neu-deutschen religios-patriotischen Kunst
- Der Einfluss der klassischen Antike auf Goethes Kunstverständnis
- Der Gegensatz zwischen klassischer und romantischer Kunstauffassung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert Goethes Wandel in seiner Kunstauffassung über sein Leben, von der frühen Begeisterung für den Naturalismus bis hin zur späteren Hinwendung zur Klassik. Sie hebt die Kontinuität in seiner Entwicklung hervor und kündigt die detaillierte Auseinandersetzung mit den „Propyläen“ und der Romantikkritik an. Der Fokus liegt auf der Entwicklung seiner Kunsttheorie im Kontext seiner Lebensphasen und der Entwicklung seines künstlerischen Sendungsbewusstseins.
Goethes Kunstauffassung. Studien zu den Propyläen und zur Romantikkritik: Dieses Kapitel analysiert Goethes Kunstauffassung im Kontext der „Propyläen“, einer von ihm herausgegebenen Kunstzeitschrift, sowie seines Aufsatzes „Neudeutsche religios-patriotische Kunst“. Es untersucht die Entstehung der „Propyläen“, deren Programmatik, Wirkung und die Polemik gegen die Romantik. Der Abschnitt behandelt die Entstehung des Projektes aus der vorherigen Zusammenarbeit mit Johann Heinrich Meyer und die damit verbundenen Ziele, die darin liegen, eine allgemeingültige Kunstästhetik zu vermitteln und die klassische Antike als Vorbild zu etablieren. Die Kritik an der Romantik wird im Detail beleuchtet, wobei die Auseinandersetzung mit Wackenroder und Tieck eine zentrale Rolle spielt. Die Kapitel behandeln die Intentionen und den Hintergrund der Kritik sowie die zeitgenössische Rezeption.
Schlüsselwörter
Goethe, Kunstauffassung, Propyläen, Romantik, Klassik, Antike, Neudeutsche religios-patriotische Kunst, Johann Heinrich Meyer, Wilhelm und Karoline von Humboldt, Friedrich Schiller, Wackenroder, Tieck.
Goethes Kunstauffassung: Propyläen und Romantikkritik - FAQ
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht eingehend Goethes Kunstauffassung, insbesondere anhand seiner Beiträge zu den „Propyläen“ und seiner Kritik an der Romantik. Sie analysiert die Entwicklung seiner ästhetischen Positionen über verschiedene Lebensphasen und seine Auseinandersetzung mit der neu aufkommenden romantischen Kunstbewegung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: die Entwicklung von Goethes Kunstauffassung über seine Lebensphasen; die „Propyläen“ als Ausdruck von Goethes klassischer Kunstauffassung; Goethes Kritik an der neu-deutschen religios-patriotischen Kunst; den Einfluss der klassischen Antike auf Goethes Kunstverständnis; und den Gegensatz zwischen klassischer und romantischer Kunstauffassung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquellen sind Goethes Beiträge zu den „Propyläen“ und seine Romantikkritik, insbesondere seine Auseinandersetzung mit der „neu-deutschen religios-patriotischen Kunst“. Die Arbeit berücksichtigt auch den Kontext der Entstehung der „Propyläen“, die Zusammenarbeit mit Johann Heinrich Meyer und die Rezeption der Texte zu Goethes Lebzeiten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zu Goethes Kunstauffassung im Kontext der „Propyläen“ und der Romantikkritik (mit Unterkapiteln zur Entstehung, Programmatik, Wirkung der „Propyläen“ und der detaillierten Analyse der Kritik an der Romantik), und ein Fazit. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Goethes Kunstauffassung umfassend zu analysieren und ihre Entwicklung im Kontext seiner Lebensphasen und der zeitgenössischen Kunstdebatte zu beleuchten. Besonders der Vergleich zwischen Goethes klassischer Kunstauffassung und der aufkommenden Romantik steht im Mittelpunkt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Goethe, Kunstauffassung, Propyläen, Romantik, Klassik, Antike, Neudeutsche religios-patriotische Kunst, Johann Heinrich Meyer, Wilhelm und Karoline von Humboldt, Friedrich Schiller, Wackenroder, Tieck.
Wer sind die wichtigsten Personen, die in der Arbeit behandelt werden?
Neben Goethe selbst spielen Johann Heinrich Meyer (als Mitarbeiter an den Propyläen), die Humboldts (als wichtige Figuren im Kontext der Klassik), Friedrich Schiller (als einflussreicher Zeitgenosse) und die Romantiker Wackenroder und Tieck (als Hauptgegner in Goethes Kritik) eine wichtige Rolle.
Was ist der Fokus der Einleitung?
Die Einleitung skizziert Goethes Wandel in seiner Kunstauffassung über sein Leben und kündigt die detaillierte Auseinandersetzung mit den „Propyläen“ und der Romantikkritik an. Der Fokus liegt auf der Entwicklung seiner Kunsttheorie im Kontext seiner Lebensphasen und seines künstlerischen Sendungsbewusstseins.
Was wird im Hauptkapitel behandelt?
Das Hauptkapitel analysiert Goethes Kunstauffassung anhand der „Propyläen“ und seiner Romantikkritik. Es untersucht die Entstehung, Programmatik und Wirkung der „Propyläen“ sowie die Hintergründe und Ziele von Goethes Kritik an der „neu-deutschen religios-patriotischen Kunst“ und deren zeitgenössische Rezeption.
- Quote paper
- Ilona Gaul (Author), 2006, Goethes Kunstauffassung - Studien zu den Propyläen und zur Romantikkritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79686