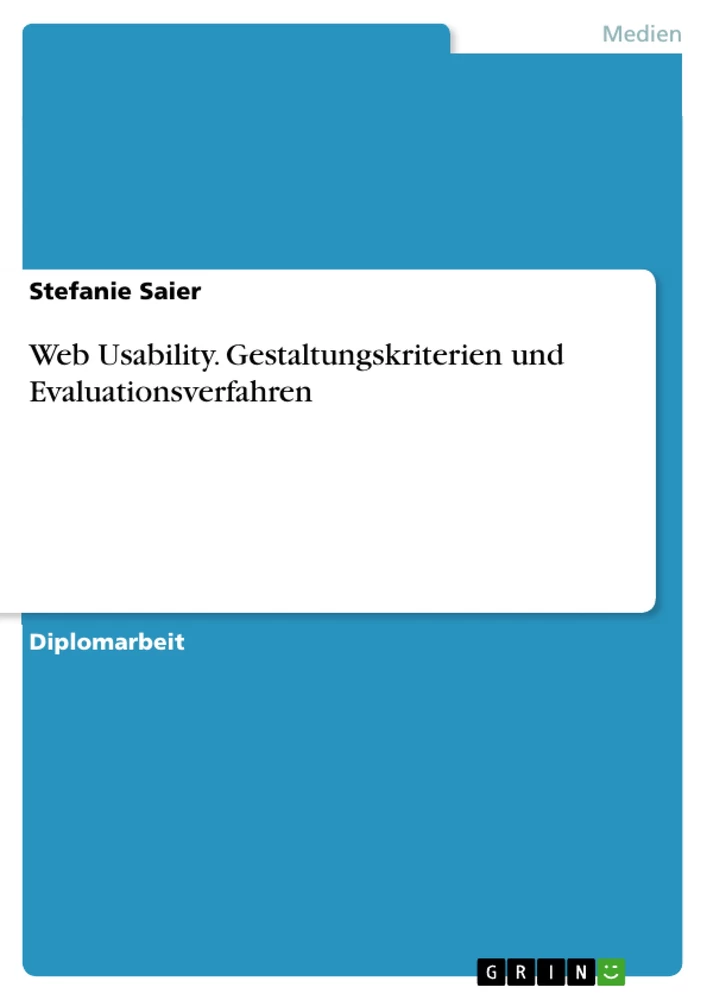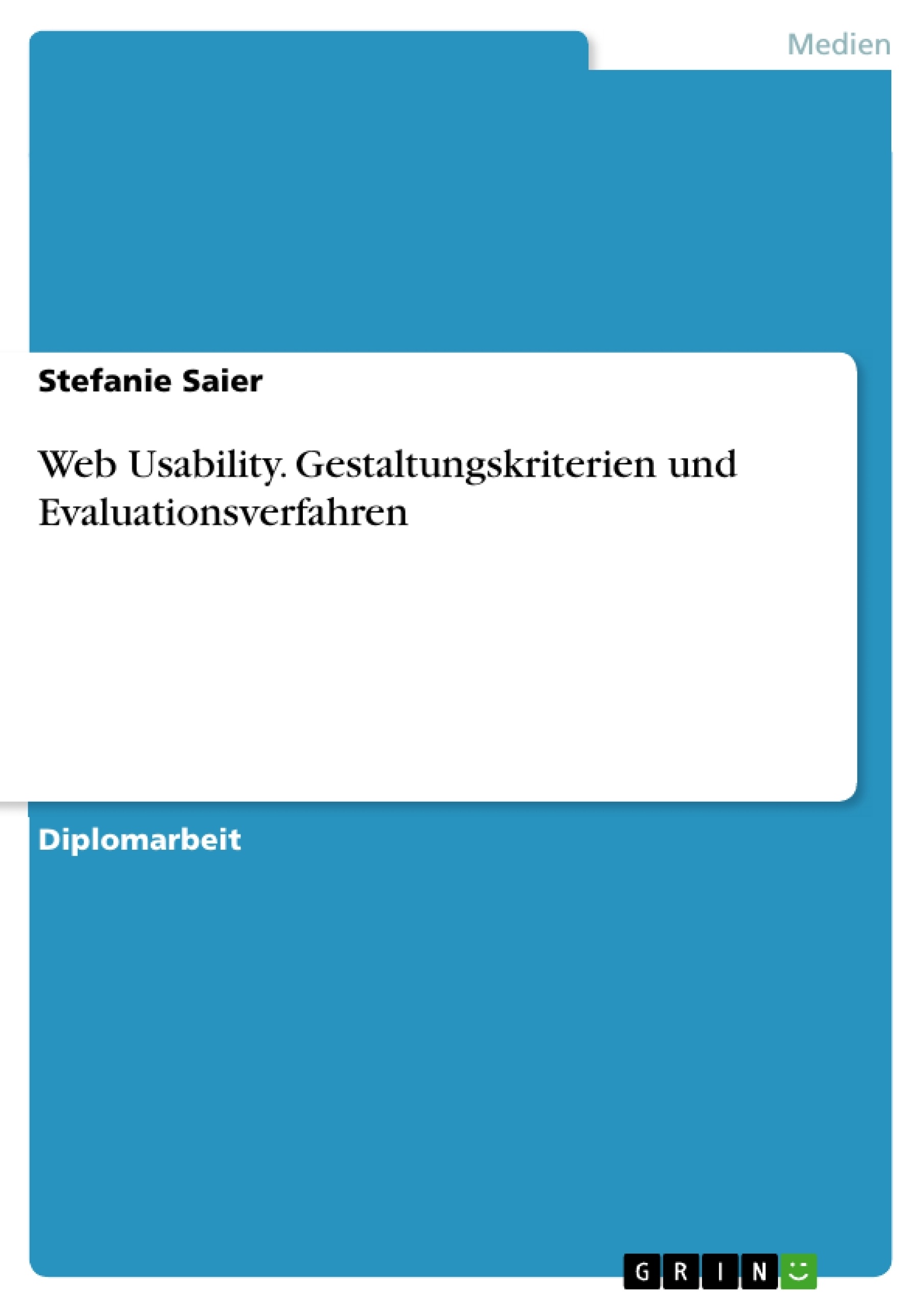"Usability" bedeutet nach der ISO Norm 9241 das Ausmaß, in dem ein Produkt von einem bestimmten Benutzer verwendet werden kann, um bestimmte Ziele in einem bestimmten Kontext effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen .
"Web Usability" bezeichnet in diesem Sinne also die benutzerfreundliche Gestaltung einer Website.
Die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Internetpräsenz diese Gebrauchstauglichkeit erreicht, sowie die Maßnahmen, die getroffen werden können, um ein Angebot auf das Qualitätsmerkmal Usability hin zu überprüfen und zu optimieren, sollen im Rahmen dieser Arbeit dargestellt werden.
Dabei geht nicht um die Betrachtung der Problemstellung aus dem Blickwinkel der einen oder anderen wissenschaftlichen Methode, sondern es soll ein integrativer Ansatz versucht werden, um der Komplexität des Themas gerecht zu werden - also die Kombination historischer, linguistischer, psychologischer, betriebswirtschaftlicher etc. Herangehensweisen - im Sinne der interdisziplinären Tradition der Medienwissenschaft.
Im Zentrum steht also weniger das Beispiel aus der Praxis des Usability Engineering, sondern die Einordnung des "Phänomens Web Usability" in seinen theoretischen Bezugsrahmen und die Betrachtung der Gestaltungs-, Evaluations- und Produktionsmöglichkeiten einer benutzerfreundlichen Website aus unterschiedlichen Perspektiven.
Inhaltsverzeichnis:
- 1. Einleitung
- 1.1 Das Thema dieser Arbeit
- 1.2 Aufbau und Gestaltung der Arbeit
- 2. Die HCI-Forschung
- 2.1 HCI – Human Computer Interface und Human Computer Interaction
- 2.2 Die Mensch-Computer-Interaktion (als solche)
- 2.3 Konfliktpotenzial bei der Mensch-Computer-Interaktion
- 2.3.1 Konfliktpotenzial - Die Metakommunikation
- 2.3.2 Konfliktpotenzial - Anwender contra Programmierer
- 2.3.3 Zielgruppenanalyse zur Vermeidung von Kommunikations-Konflikten
- 2.4 Forschung und Gestaltung im Bereich Human Computer Interaction
- 2.5 Disziplinen der HCI-Forschung
- 2.6 Benutzerschnittstellen - der Computer wird "usable"
- 2.6.1 Der Begriff "Schnittstelle" (Interface)
- 2.6.2 Der Begriff "Benutzerschnittstelle" und "Benutzeroberfläche"
- 2.6.3 Die "Grafische Benutzeroberfläche" (Graphical User Interface (GUI))
- 2.6.4 Die Geschichte der Grafischen Benutzeroberfläche
- 2.6.5 Das erste GUI – der Xerox Alto
- 2.6.6 Mehr Komfort für den Nutzer: Vom Kommandozeilen-Interface zum GUI
- 2.6.7 Die Schreibtisch- und die Menü-Metapher
- 2.6.8 Die Bedeutung von Icons für ein GUI
- 3. Das Internet - seine Dienste und Möglichkeiten
- 3.1 Das Internet
- 3.2 Das World Wide Web - der bekannteste Dienst des Internet
- 3.3 Matthias Horx prophezeit die Zukunft des Internet
- 3.4 Das kommerzialisierte Internet
- 3.4.1 Die Kommerzialisierung von Informationen
- 3.4.2 Das Internet als Marketingkanal
- 3.4.3 E-Business und E-Commerce
- 3.4.4 Entwicklung des E-Commerce in den letzten Jahren
- 3.4.5 Die Zukunft des E-Commerce
- 3.4.6 Die Bedeutung von Usability für den Erfolg eines E-Commerce-Angebots
- 4. Die Nutzer des Internet
- 4.1 Die Internetnutzung in Deutschland
- 4.2 Ergebnisse der ARD/ZDF Online-Studie
- 4.2.1 Die Internetnutzung einiger Zielgruppen
- 4.2.2 Nutzungsstrategien und Nutzungsdauer
- 4.2.3 Nutzungsprobleme
- 4.2.4 Schlussfolgerungen aus der Studie
- 4.3 Kategorisierung der Nutzungsziele
- 4.4 Die Bedeutung der Zielgruppenanalyse
- 4.5 Die Typologisierung von Internetnutzern
- 4.5.1 Das Verfahren der Typologisierung
- 4.5.2 Die Nutzertypologie des GFK Online-Monitors
- 4.5.3 Eine vereinfachte Nutzertypologie
- 5. Das Phänomen Hypertext
- 5.1 Die historische Entwicklung des Hypertext-Konzepts
- 5.2 Definition des Begriffs "Hypertext"
- 5.2.1 Herkunft des Wortes
- 5.2.2 Wortbedeutung
- 5.2.3 Definition
- 5.3 Abgrenzung eines Hypertextdokuments
- 5.4 Hypertexttypen
- 5.5 Die Strukturkomponenten eines Hypertextes
- 5.5.1 Knoten
- 5.5.2 Verweise (Hyperlinks)
- 6. Das Konstrukt Website
- 6.1 Begriff und Definition
- 6.1.1 Abgrenzung
- 6.2 Die Kategorisierung unterschiedlicher Websites
- 6.2.1 Die Kategorisierung von Yahoo nach Themengebieten
- 6.2.2 Die Kategorisierung von Modalis Research nach Business-Modellen
- 6.2.3 Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Kategorien
- 6.3 Die Webpage
- 6.3.1 Begriff und Definition
- 6.3.2 Elemente einer Webpage
- 6.3.3 Webpage-Kategorien
- 7. Das Qualitätskonzept Web Usability
- 7.1 Der Erfolg einer Website
- 7.2 Die Ergonomische Qualitätssicherung
- 7.3 Begriff und Definition von "Usability" bzw. "Web Usability"
- 7.4 Die Usability-Definition von Jakob Nielsen
- 7.5 Usability als "Ease of use" und "Quality of Use"
- 7.6 Normen und Standards
- 7.6.1 Die ergonomische Norm DIN EN ISO 9241
- 7.6.2 Die zentrale Norm 9241 Teil 11
- 7.6.3 Die Normen 9241- 10 und -12 bis -17
- 7.6.4 Objektive und subjektive Gebrauchstauglichkeit
- 7.6.5 Die Rolle der ergonomischen Normen bei der Evaluation eines Interfaces
- 7.7 Usability als Kombination aus "quality of use" und "joy of use"
- 7.8 Zusammenfassung der Usability-Definitionsansätze
- 8. Die Accessibility und Performanz einer Website
- 8.1 Barrierefreier Zugang für jedermann?
- 8.2 Die gesetzliche Verankerung des barrierefreien Internetzugangs
- 8.3 Richtlinien für eine barrierefreie Gestaltung von Websites
- 8.4 Die Validierung der Accessibility
- 8.5 Performanz als Faktor der Accessibility und Usability
- 9. Das Dialogdesign (Navigationsdesign) einer Website
- 9.1 Grundsätze der Dialoggestaltung nach der DIN EN ISO 9241-10
- 9.2 Aspekte der menschlichen Informationsverarbeitung
- 9.2.1 Das Chunking-Prinzip
- 9.2.2 Kategorien und Schemata
- 9.2.3 Mentale Modelle
- 9.2.4 Navigationsverhalten und Motivation
- 9.2.5 Navigationsverhalten und Involvement
- 9.2.6 Der Flow-Effekt als Idealzustand
- 9.3 Die Informationsarchitektur von Websites
- 9.3.1 Grundmuster der Website-Gliederung
- 9.3.2 Die hierarchische Informationsarchitektur
- 9.4 Unterschiedliche Gliederungs-Typen von Websites
- 9.4.1 Metapher
- 9.4.2 Tunnel
- 9.4.3 Portalseite als Homepage
- 9.4.4 Leitseite als Homepage
- 9.5 Orientierung und Navigation auf einer Website
- 9.5.1 Die Orientierung im Hyperspace
- 9.5.2 Der Browser als Orientierungshilfe
- 9.5.3 Seitentitel zur Orientierung
- 9.5.4 Kognitive Kontrolle und Feedback
- 9.6 Interaktive Navigationsübersichten
- 9.6.1 Navigationsmenüs
- 9.6.2 Navigationsmenü oder Suchmaschine?
- 9.6.3 Das Brotkrumen-Prinzip (Threading)
- 9.6.4 Der Einsatz von Navigationsmetaphern
- 9.7 Interaktionselemente
- 9.7.1 Assoziative und strukturelle Links
- 9.7.2 Externe und interne Links
- 9.7.3 Vorschaulinks
- 9.7.4 Querlinks und Deeplinks
- 9.7.5 Linkfarben und Linkbenennung
- 9.7.6 Das Ziel eines Links
- 9.7.7 Verlinkte Grafiken
- 9.7.8 Der Einsatz von Verhaltensmetaphern
- 9.7.9 Pull-down-Menüs
- 9.8 Zusätzliche Hilfestellungen
- 9.8.1 Sitemaps
- 9.8.2 FAQs - Häufig gestellte Fragen
- 10. Das Screendesign einer Website
- 10.1 Aspekte der optischen Wahrnehmung
- 10.1.1 Räumliches Sehen
- 10.1.2 Die linke und rechte Gehirnhälfte
- 10.1.3 Gestaltpsychologie
- 10.2 Farbwahrnehmung, Farbmodelle und Farbkontraste
- 10.2.1 Die Wahrnehmung und Interpretation von Farben
- 10.2.2 Unterschiedliche Farbmodelle
- 10.2.3 Farbkontraste
- 10.2.4 Der Einsatz von Farben auf einer Website
- 10.2.5 Konsequenz der Farbgestaltung für das Screen-Design
- 10.3 Typographie und Wording: Lesen am Bildschirm
- 10.3.1 Allgemeine Faktoren der Leserlichkeit
- 10.3.2 Die Typographie auf Websites
- 10.4 Bewegung und Animation
- 10.5 Grundsätze der Layoutgestaltung
- 10.5.1 Diagonalen und Schrägen
- 10.5.2 Die Blickrichtung
- 10.5.3 Das visuelle Gleichgewicht
- 10.5.4 Weißraum und Framing
- 10.5.5 Der Mittelpunkt einer Bildschirmfläche
- 10.5.6 Der Goldene Schnitt
- 10.5.7 Die Größe und Anordnung von Schaltflächen
- 10.5.8 Fazit zum Layout einer Webpage
- 11. Das Inhaltsdesign einer Website
- 11.1 Grafiken und Photos
- 11.2 Video
- 11.3 Audio
- 12. Schreiben für das World Wide Web
- 12.1 Hypertext als Sonderfall des herkömmlichen Textes
- 12.1.1 Linearität und Nicht-Linearität
- 12.1.2 Intertextualität
- 12.1.3 Interaktivität
- 12.1.4 Die Aufweichung des traditionellen Autoren-Begriffs
- 12.1.5 Die Aufweichung des traditionellen Leser-Begriffs
- 12.1.6 Die elektronische Umsetzung
- 12.1.7 Das Hypertext-Konzept im Vergleich zu herkömmlichen Texten
- 12.2 Textgestaltung für das World Wide Web
- 12.2.1 Das Leseverhalten im Web und seine Auswirkung auf die Textgestaltung
- 12.2.2 Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Texten
- 12.2.3 Klare und weiterführende Informationen
- 12.2.4 Wortwahl und Sprachstil
- 12.2.5 Der Spannungsbogen
- 12.2.6 Fazit
- 13. Kulturabhängige Gestaltungsfaktoren
- 13.1 Sprache
- 13.2 Farben
- 13.3 Kulturabhängige Icons und Symbole
- 13.4 Kulturelle Einflussfaktoren nach Hofstede
- 13.4.1 Der Faktor Machtdistanz
- 13.4.2 Weitere Faktoren
- 13.5 Der Faktor Kultur bei der Entwicklung und Evaluation
- 13.6 Fazit
- 14. Die Usability von Flash-Websites
- 15. Evaluationsverfahren zur Untersuchung von Web Usability
- 15.1 Der Evaluationsprozess einer Website
- 15.2 Websites als Untersuchungsgegenstand der Online-Marktforschung
- 15.3 Erhebungsmethoden der Marktforschung im Überblick
- 15.4 Aspekte der Online-Marktforschung
- 15.4.1 Sekundär- und Primärforschung
- 15.4.2 Quantitative und qualitative Forschung
- 15.4.3 Adressierte und anonyme Forschung
- 15.4.4 Reaktive und nicht-reaktive Methoden
- 15.4.5 Die Datenqualität bei Online-Befragungen
- 15.4.6 Rechtliche Aspekte der Online-Befragung
- 15.5 Methoden der Online-Befragung
- 15.5.1 Befragung per E-Mail und in Newsgroups
- 15.5.2 Unstandardisierte Befragungen
- 15.5.3 Befragungen im WWW
- 15.5.4 Spezielle Online-Untersuchungsmethoden
- 15.6 Die Server-Logfile-Analyse und das User-Tracking
- 15.6.1 Die Informationen aus den Server-Logfiles
- 15.6.2 Das User Tracking
- 15.6.3 Probleme bei der Analyse von Logfiles
- 15.6.4 Rechtliche Aspekte des User-Trackings
- 15.6.5 Die Kombination von Online-Befragung und Logfile-Analyse
- 15.6.6 Das Web Mining
- 15.6.7 Logfile-Analyse und Web Mining zur Untersuchung der Web Usability
- 15.7 Offline Methoden zur Untersuchung von Usability
- 15.7.1 Quantitative Methoden
- 15.7.2 Qualitative Methoden
- 15.7.3 Das standardisierte DATech-Prüfverfahren
- 15.7.4 Kosten und Nutzen eines Usability-Tests
- 16. Der Usability Engineering-Prozess
- 16.1 Die Analyse-Phase
- 16.2 Die Entwurfs- und Design-Phase
- 16.2.1 Ausrichten des Dialogdesigns an Zielgruppenstrukturen
- 16.2.2 Der Einsatz eines Prototyps
- 16.2.3 Der Einsatz von Storyboards
- 16.2.4 Der Einsatz von Usability Pattern
- 16.3 Die Implementierung und der Launch des Angebots
- 16.4 Zeitpunkt und Methoden der Evaluation im Überblick
- 17. Das "Projekt BerlinBeta"
- 17.1 Gegenstand der Untersuchung
- 17.1.1 Das Untersuchungsziel und die Grenzen der Untersuchung
- 17.1.2 Überblick über das Vorgehen und die verwendete Methoden
- 17.2 Die Nutzungshäufigkeit der Website
- 17.3 Der Aufbau der Website
- 17.4 Der Think Aloud-Test
- 17.4.1 Die Testpersonen und der Ort der Untersuchung
- 17.4.2 Bearbeitung der Szenarien durch die Testpersonen
- 17.4.3 Die Ergebnisse des Think Aloud-Tests
- 17.5 Befragung im Anschluss an den Think Aloud-Test
- 17.5.1 Befragung zur gesamten Website
- 17.5.2 Befragung zu einzelnen Bereichen der Website
- 17.6 Zusammenfassung der Ergebnisse aus Analyse, Test und Befragung
- 17.7 Maßnahmen zur Optimierung
- 17.8 Die Erkenntnisse aus dem Projekt
- 18. Schlusswort
- 19. Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Stefanie Saier (Author), 2002, Web Usability. Gestaltungskriterien und Evaluationsverfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79755