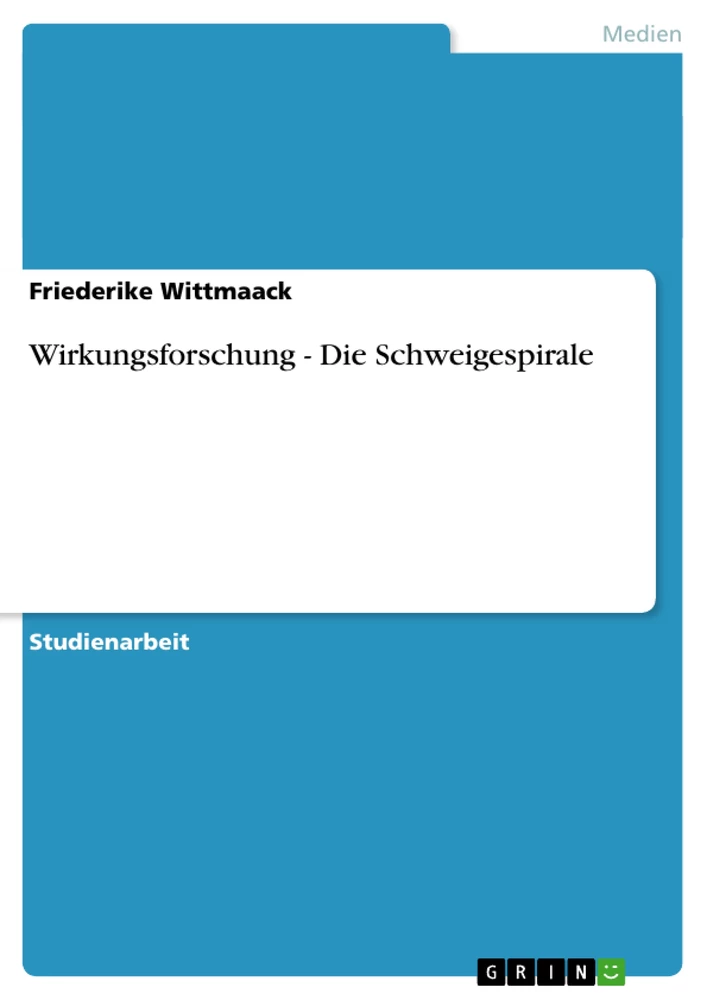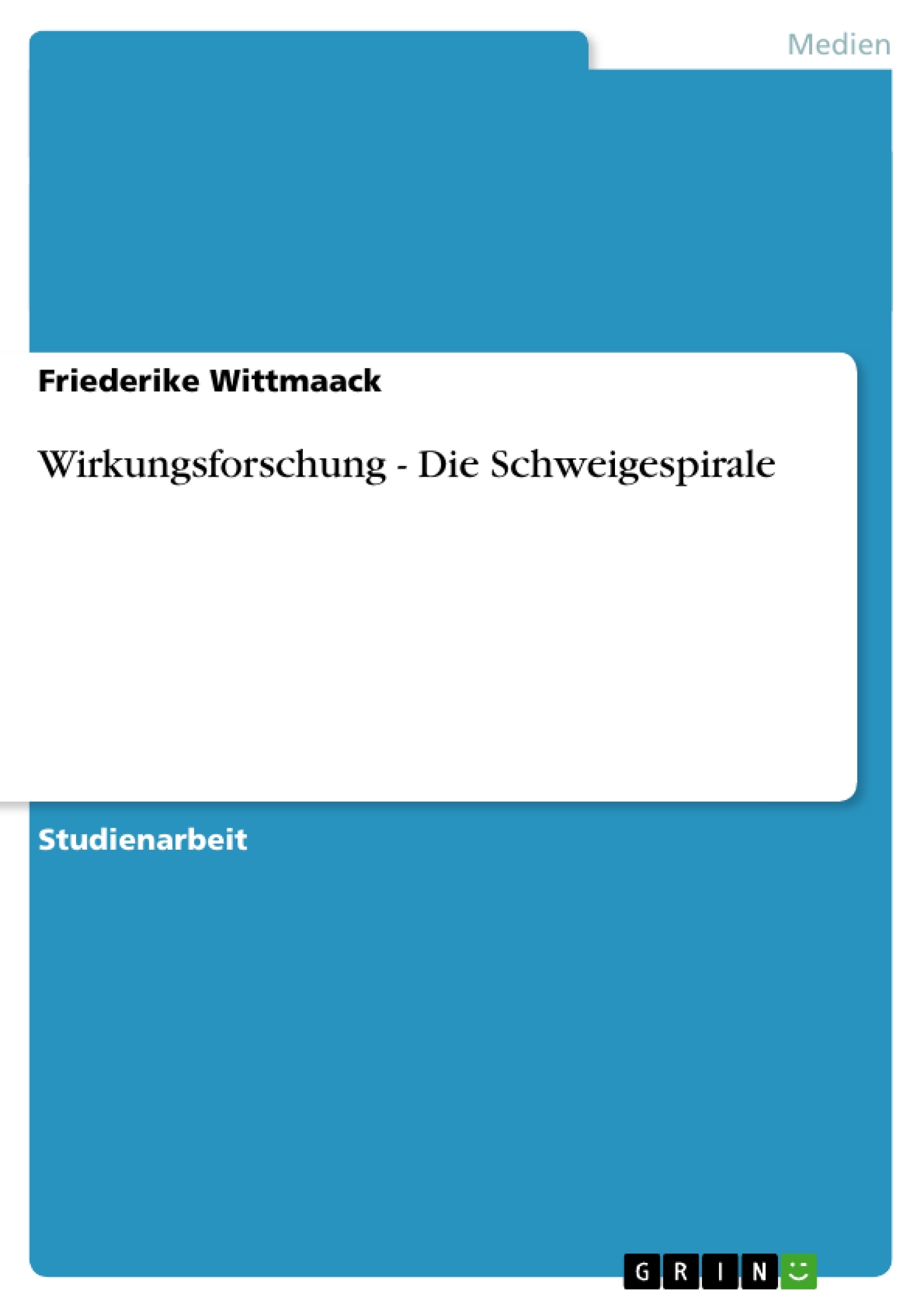Welche Wirkung haben Medien auf den Menschen? Sind die Einflüsse direkt nachweisbar oder verstecken sie sich in Verhaltensweisen der Menschen die mehr oder weniger von verschiedenen Medien beeinflusst sind? Und was ist eigentlich die Wirkung, die eine Aussage haben kann?
In dieser Arbeit wird der Begriff der Wirkung der Medien auf Menschen allgemein geklärt. Es wird dabei auf die Rolle des Rezipienten und des Mediums eingegangen. Das Modell des Stimulus-Response wird widerlegt und lässt Platz, verschiedene Wirkungsprozesse zu erläutern. Mehrere Wirkungstheorien wie die Pluralistische Ignoranz, der Looking-Glass-Effekt und der Third-Person-Effekt werden kurz beschrieben. Die Theorie der Schweigespirale, die davon ausgeht, dass Menschen, die die Minderheitsmeinung vertreten, diese oft verschweigen, um nicht isoliert zu werden, steht im Mittelpunkt der Betrachtungen. Je mehr diese Menschen schweigen, desto mehr scheint die Mehrheitsmeinung wirklich die Meinung der meisten Menschen zu werden. Hier erscheint es sinnvoll, einige andere Theorien einfließen zu lassen, die auf der Theorie der Schweigespirale aufbauen oder sie ergänzen. Es soll eine Verbindung zwischen verschiedenen Ansätzen zur Erklärung von Effekten der Medien auf die Menschen hergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangspunkt der Wirkungsforschung
- Definition Wirkung
- Der Rezipient
- Das Medium
- Wirkungsprozesse
- Modelle der Wirkungsforschung
- Die Schweigespirale
- Sozialpsychologische Erkenntnisse
- Kommunikationstheoretische Erkenntnisse
- Gesellschaftstheoretische Erkenntnisse
- Die Kommunikationsbereitschaft
- Die Rolle der Massenmedien
- Probleme der Theorie
- Die Schweigespirale
- Pluralistische Ignoranz
- Looking-Glass-Wahrnehmung
- Third-Person-Effekt
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit klärt den Begriff der Medienwirkung auf den Menschen und untersucht die Rolle des Rezipienten und des Mediums. Das Stimulus-Response-Modell wird kritisch beleuchtet und alternative Wirkungsprozesse werden erläutert. Im Fokus steht die Schweigespirale, welche das Verschweigen von Minderheitsmeinungen beschreibt. Zusätzlich werden weitere Theorien wie die Pluralistische Ignoranz, der Looking-Glass-Effekt und der Third-Person-Effekt kurz vorgestellt und in Beziehung zueinander gesetzt.
- Definition und Erklärung von Medienwirkung
- Analyse des Stimulus-Response-Modells und seiner Grenzen
- Detaillierte Betrachtung der Schweigespirale und ihrer Implikationen
- Einordnung weiterer relevanter Wirkungstheorien
- Zusammenführung verschiedener Ansätze zur Erklärung von Medienwirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Medienwirkung ein und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor. Sie thematisiert die Schwierigkeit, direkte Medienwirkungen nachzuweisen und betont die Komplexität der Wechselbeziehung zwischen Medien, Rezipienten und ihren jeweiligen Kontexten. Die Arbeit kündigt die Klärung des Wirkungsbegriffs sowie die Erörterung verschiedener Wirkungstheorien, insbesondere der Schweigespirale, an.
Ausgangspunkt der Wirkungsforschung: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Wirkung" im Kontext der Medienforschung, ausgehend von naturwissenschaftlichen Vorstellungen von Ursache und Wirkung. Das einfache Stimulus-Response-Modell wird als unzureichend dargestellt, da es die Komplexität der Medienwirkung und die aktive Rolle des Rezipienten vernachlässigt. Es wird betont, dass Medienwirkungen in einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Faktoren entstehen, die sowohl im Rezipienten selbst als auch in dessen Kontext liegen. Die Bedeutung der subjektiven und objektiven Situation des Rezipienten wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Medienwirkung, Schweigespirale, Pluralistische Ignoranz, Looking-Glass-Effekt, Third-Person-Effekt, Stimulus-Response-Modell, Rezipient, Massenmedien, Kommunikationstheorie, Wirkungsprozesse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Medienwirkungsforschung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Erforschung von Medienwirkungen auf den Menschen. Sie untersucht die Rolle des Rezipienten und des Mediums bei der Entstehung von Medienwirkungen und beleuchtet kritisch das einfache Stimulus-Response-Modell. Ein besonderer Fokus liegt auf der Schweigespirale und weiteren Theorien wie der Pluralistischen Ignoranz, dem Looking-Glass-Effekt und dem Third-Person-Effekt.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Theorien der Medienwirkungsforschung. Im Zentrum steht die Schweigespirale, die das Verschweigen von Minderheitsmeinungen beschreibt. Zusätzlich werden die Pluralistische Ignoranz, der Looking-Glass-Effekt und der Third-Person-Effekt erläutert und in Beziehung zueinander gesetzt. Das Stimulus-Response-Modell wird kritisch analysiert und als unzureichend für die Erklärung komplexer Medienwirkungen dargestellt.
Was wird unter „Medienwirkung“ verstanden?
Der Begriff „Medienwirkung“ wird in der Arbeit definiert und im Kontext der Medienforschung eingeordnet. Es wird deutlich gemacht, dass Medienwirkungen nicht einfach als direkte Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu verstehen sind, sondern in einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Faktoren entstehen, die sowohl im Rezipienten als auch in seinem Umfeld liegen.
Welche Rolle spielt der Rezipient?
Die Arbeit betont die aktive Rolle des Rezipienten bei der Entstehung von Medienwirkungen. Das einfache Stimulus-Response-Modell wird abgelehnt, weil es die Komplexität der Medienwirkung und die aktive Rolle des Rezipienten vernachlässigt. Die subjektive und objektive Situation des Rezipienten wird als entscheidend für die Wirkungsentstehung hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Medienwirkung, Schweigespirale, Pluralistische Ignoranz, Looking-Glass-Effekt, Third-Person-Effekt, Stimulus-Response-Modell, Rezipient, Massenmedien, Kommunikationstheorie und Wirkungsprozesse.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Ausgangspunkt der Wirkungsforschung, Kapitel zu den einzelnen Theorien (Schweigespirale, Pluralistische Ignoranz, Looking-Glass-Effekt, Third-Person-Effekt) und eine Schlussbemerkung. Die Einleitung stellt die Forschungsfragen vor und die einzelnen Kapitel behandeln die jeweiligen Theorien detailliert. Es gibt auch eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Auflistung der Schlüsselbegriffe.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit klärt den Begriff der Medienwirkung, untersucht die Rolle des Rezipienten und des Mediums und analysiert kritisch das Stimulus-Response-Modell. Sie beleuchtet detailliert die Schweigespirale und ordnet weitere relevante Wirkungstheorien ein, um verschiedene Ansätze zur Erklärung von Medienwirkungen zu vereinen.
- Quote paper
- Friederike Wittmaack (Author), 2006, Wirkungsforschung - Die Schweigespirale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80015