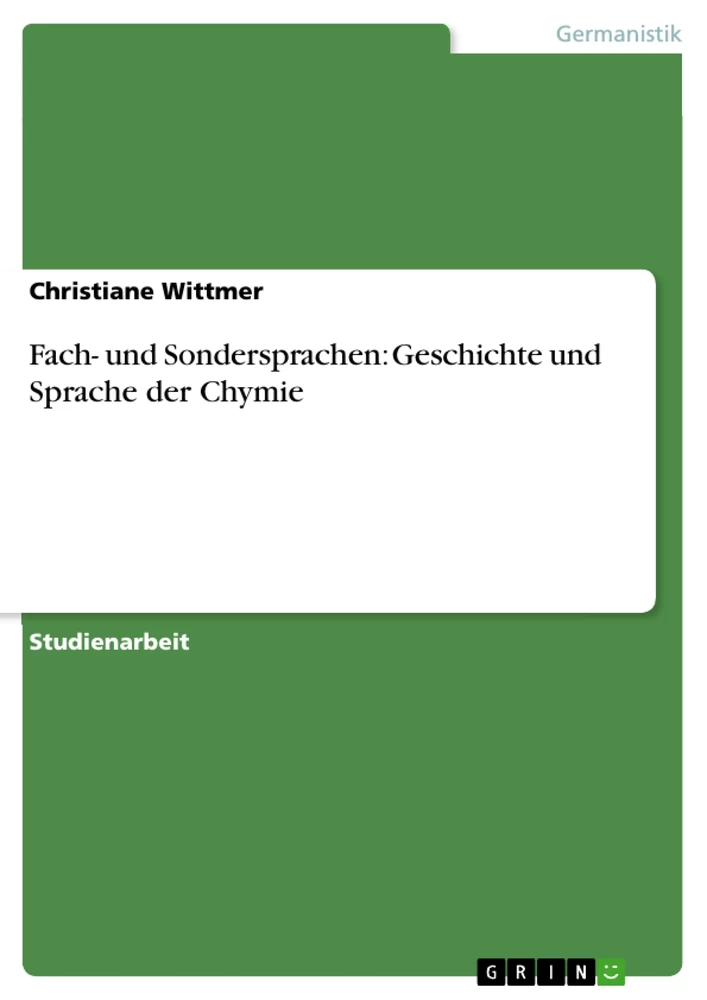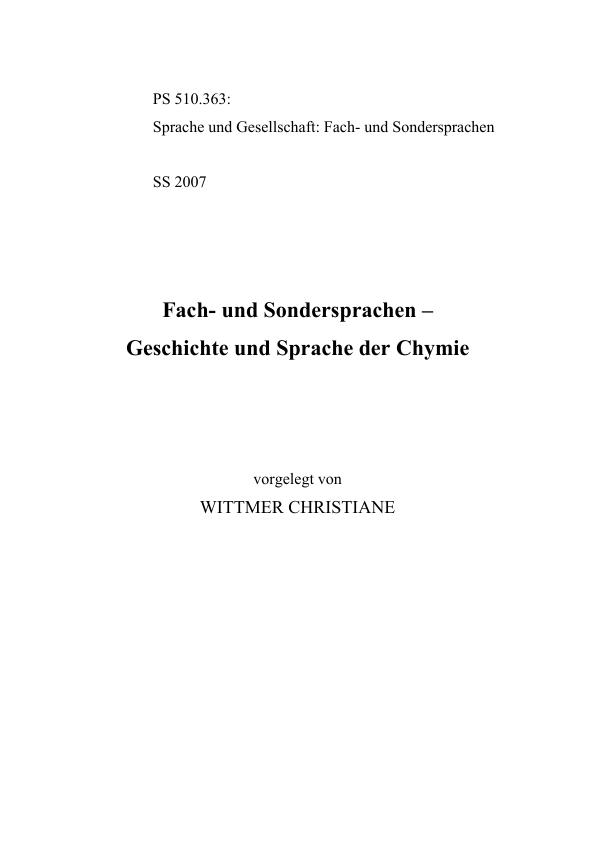Ziel dieser Arbeit ist es, in gegebenem Rahmen einerseits der Frage nachzugehen, was denn eine Fach- bzw. was eine Sondersprache sei, und andererseits einen kurzen Abriss der Geschichte der Alchemie von ihren Anfängen bis zu ihrem langsamen Übergang in eine moderne empirische Chemie sowie den Ansatz einer Analyse der Fachsprache selbiger Disziplin zu geben. Bevor dieses Vorhaben umgesetzt werden soll sei noch marginal Stellung zur Sprache allgemein genommen und danach noch kurz umrissen, worum es sich bei der so genannten Alchemie überhaupt handelt.
Inhaltsverzeichnis
- I. TEIL
- 2. Fach- und Sondersprachen
- a. Was ist eine Fachsprache?
- b. Was ist eine Sondersprache?
- II. TEIL
- 3. Geschichte der Alchemie
- a. Historischer Abriss der Geschichte der Alchemie
- III. TEIL
- 4. Die Fachsprache der Chymie
- a. Kurze Vorstellung der vier relevanten Drucke
- b. Zur Sprache der Alchemie allgemein
- c. Zur Sprache der vier Drucke
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text befasst sich mit der Definition von Fach- und Sondersprachen sowie mit einem kurzen Abriss der Geschichte der Alchemie, um schlussendlich einen Ansatz zur Analyse der Fachsprache dieser Disziplin zu liefern. Im Vorfeld wird kurz auf die Sprache allgemein eingegangen und die Alchemie als Disziplin genauer umrissen.
- Definition von Fach- und Sondersprachen
- Historischer Überblick über die Alchemie
- Analyse der Fachsprache der Chymie
- Bedeutung und Funktion von Fachsprachen
- Merkmale und Besonderheiten von Fachsprachen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Definition von Fach- und Sondersprachen. Es werden verschiedene Ansätze und Definitionen aus der Literatur vorgestellt und diskutiert, um ein umfassendes Verständnis für diese Sprachformen zu entwickeln. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Geschichte der Alchemie, wobei ein historischer Abriss die Entwicklung dieser Disziplin von ihren Anfängen bis zu ihrem Übergang in eine moderne empirische Chemie nachzeichnet. Das dritte Kapitel schließlich behandelt die Fachsprache der Chymie. Hier werden die vier relevanten Drucke der Alchemie vorgestellt und die spezifischen Sprachmerkmale dieser historischen Disziplin analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind: Fachsprache, Sondersprache, Alchemie, Chymie, Geschichte der Wissenschaft, Sprachentwicklung, Lexik, Satzbau, Fachkommunikation.
- Quote paper
- Christiane Wittmer (Author), 2007, Fach- und Sondersprachen: Geschichte und Sprache der Chymie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80066