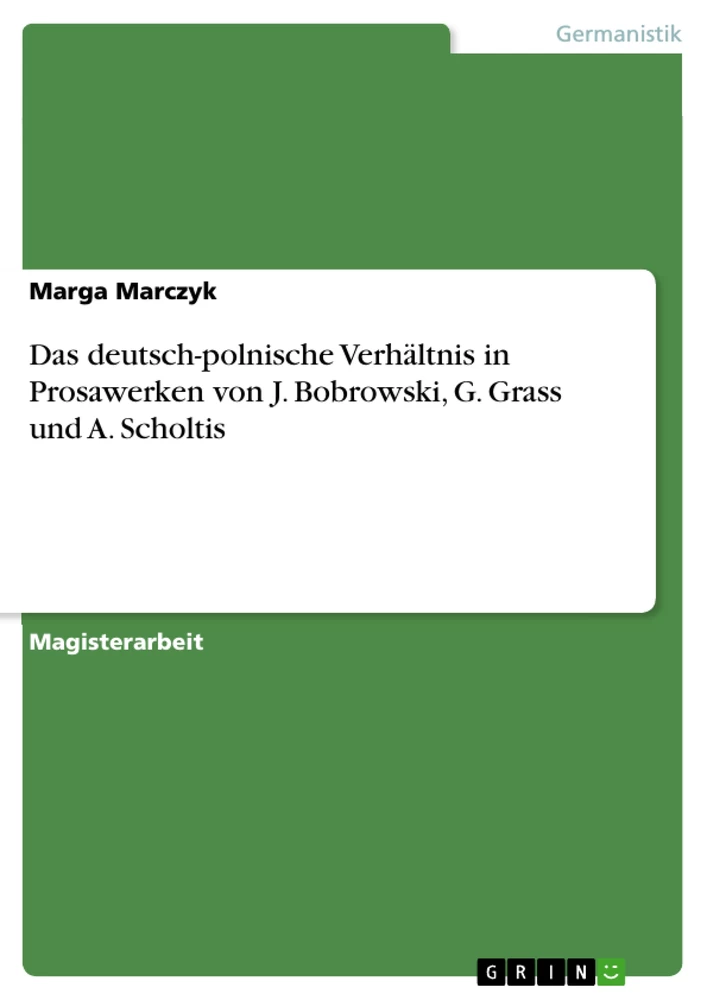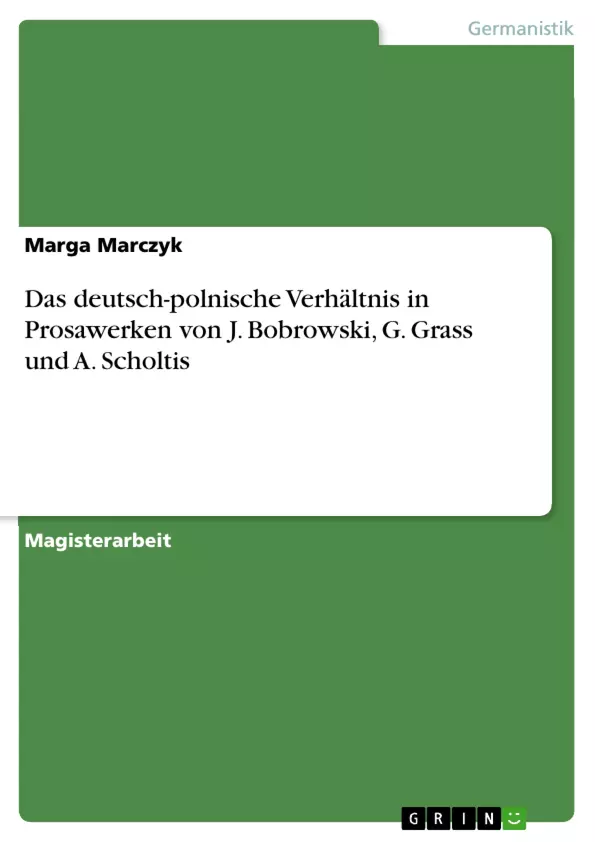Angesichts des Beitritts Polens zur EU im Mai 2004 schien das deutsch-polnische Zerwürfnis aus der Welt geschaffen. Erst kürzlich zeigten die Turbulenzen beim EU-Gipfel 2007, dass das Schaffen politischer Grundlagen zwar begrüßenswert und notwendig ist, ein verständnisvolles und damit friedliches Zusammenleben jedoch nur durch eine intensive Auseinandersetzung mit seinen europäischen Nachbarn und Bündnisstaaten erreicht werden kann.
Hauptgegenstand der vorgelegten Untersuchung ist die Entwicklung des deutschen Polenbilds, wie sie aus den vorgestellten Texten ersichtlich wird. Ausgewählt wurden die Romane Ostwind (1932) von August Scholtis, Die Blechtrommel (1959) von Günter Grass, Levins Mühle (1964) von Johannes Bobrowski und schließlich die Erzählung Unkenrufe (1992) von Günter Grass.
Jacobsen (1973) führt aus, dass Nationenbilder „unabhängig von den objektiven Kenntnissen der betroffenen Personen und Sachverhalte“ entstehen, es sich bei ihnen vielmehr um „subjektiv gewertete, von ganz besonderen Traditionen geprägte und selektiv wahrgenommene Leitbilder“ handelt, die als Stereotype angesehen werden können. Aufgrund ihrer Subjektivität können Stereotype kaum empirisch überprüft werden, doch ist eine Verifizierung/Falsifizierung ohne Belang, da die Existenz von Stereotypen nicht geleugnet werden kann und sie somit eine „gesellschaftliche Realität“ (Hahn, 1995)darstellen, die nicht ignoriert werden darf, sondern zu einer kritischen Auseinandersetzung herausfordert.
Literatur vermag in Bezug auf Stereotype viel zu leisten, da der „Freiraum, den sie als Fiktion hat“ (Stüben, 1995), genutzt werden kann, „um verkrustete Vorstellungen aufzubrechen“, und sie sogar „Gegenbilder zu tradierten Bildern zu erzeugen“ vermag. Letzteres ist besonders bei ungerechtfertigt negativen Stereotypen wünschenswert.
Die zu erbringende Leistung der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung darüber, „welche (körperlichen, seelischen, geistigen) Eigenschaften in literarischen Werken bestimmten [...] Gruppen oder deren Mitgliedern zugeschrieben werden“, ohne dass der kausale Zusammenhang des einzelnen Werks verloren geht.
Zudem sind die „geistes- und mentalitätsgeschichtlichen Grundlagen aufzudecken“, auf denen das Polenbild basiert. Das bedeutet, dass die „lebensgeschichtliche Situation und der Erfahrungshorizont eines Autors“ beleuchtet werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Polen in der deutschen Literatur - Einige Voraussetzungen.
- 1.1. Zur Rolle von Stereotypen
- 1.2. Aufgaben und Möglichkeiten der Literatur
- 2. August Scholtis: Ostwind.
- 2.1. August Scholtis – Ein Leben im Grenzland
- 2.2. Ostwind - Eine kurze Entstehungsgeschichte
- 2.3. Ostwind Polen und Deutsche in Oberschlesien
- 2.3.1. Woicech, Dollny und Trockenbrott
- 2.3.2. Der Erste Weltkrieg und seine Folgen
- 2.3.3. Zeit der polnischen Aufstände und Teilung Oberschlesiens
- 2.3.4. Kaczmarek
- 3. Günter Grass: Die Blechtrommel.
- 3.1. Grass' Jugend in Danzig
- 3.2. Die Blechtrommel entsteht
- 3.3. Die Polenbezüge der Blechtrommel
- 3.3.1. Die polnischen Gestalten in der Blechtrommel
- 3.3.1.1. Joseph Koljaiczek
- 3.3.1.2. Vinzent Bronski
- 3.3.1.3. Jan Bronski
- 3.3.2. Das Triumvirat – Agnes, Matzerath, Jan Bronski
- 3.3.3. Oskar
- 3.3.3.1. Oskars kaschubisch-polnisches Erbe
- 3.3.3.2. Oskar, der Geschichte-Erzähler
- 4. Johannes Bobrowski: Levins Mühle
- 4.1. Ein Sarmate im 20. Jahrhundert - Johannes Bobrowski
- 4.2. Ausweitung des „sarmatischen Kosmos“ – Zur Entstehung von Levins Mühle
- 4.3. Die Deutschen im Osten - Bobrowskis Modellfall nationaler Interaktion
- 4.3.1. Der Enkel-Erzähler in Levins Mühle
- 4.3.2. Der Großvater und seine „Unionsgenossen“
- 4.3.2.1. Die Geistererscheinungen des Großvaters
- 4.3.3. Habedank-Gruppe
- 4.3.4. Direkte Konfrontation zwischen Großvater- und Habedank-Gruppe
- 5. Günter Grass: Unkenrufe.
- 5.1. Zur Einordnung der Unkenrufe
- 5.2. Aleksandra und Alexander – ein harmonisch-gegensätzliches Paar
- 5.3. Der Versöhnungsfriedhof - Tod einer Utopie
- 5.4. Der Krötenschlucker – Erzähler der Unkenrufe
- 5.5. Das Motiv der Unkenrufe
- 5.6. Erna Brakup oder: Das Sterben der Kaschuben
- 5.7. Chatterjee – Utopie einer asiatisch-europäischen Symbiose
- 6. Abschließende Betrachtung der behandelten Prosawerke
- 6.1. Vergleich der Prosawerke in Hinblick auf Erzählhaltung, Einbettung von Geschichte und Zeitgeschichte sowie sprachliche Gestaltung
- 6.1.1. Ostwind und Die Blechtrommel
- 6.1.2. Levins Mühle
- 6.1.3. Unkenrufe
- 6.2. Das Polenbild bei Scholtis, Grass und Bobrowski
- 6.2.1. August Scholtis
- 6.2.2. Günter Grass
- 6.2.3. Johannes Bobrowski
- 7. 60 Jahre deutsch-polnisches Verhältnis im Spiegel der Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Darstellung des deutsch-polnischen Verhältnisses in drei ausgewählten Prosawerken von J. Bobrowski, G. Grass und A. Scholtis. Die Arbeit beleuchtet die jeweiligen historischen und literarischen Kontexte, analysiert die literarischen Strategien der Autoren und untersucht die Konstruktion des Polenbildes in den Werken.
- Die Rolle von Stereotypen und ihre Verwendung in der Literatur
- Die historische Entwicklung des deutsch-polnischen Verhältnisses und ihre literarische Rezeption
- Die Darstellung von Polen und Deutschen in den Prosawerken und die Frage nach der Identität in Grenzsituationen
- Der Einfluss der individuellen Lebenserfahrungen der Autoren auf ihre Werke
- Die unterschiedlichen literarischen Ansätze und Erzählstrategien der drei Autoren
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel setzt sich mit dem Einfluss von Stereotypen in der deutschen Literatur auseinander und beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen der Literatur, das deutsch-polnische Verhältnis zu beschreiben. Das zweite Kapitel widmet sich dem Roman „Ostwind“ von August Scholtis, der das Leben in Oberschlesien vor und nach dem Ersten Weltkrieg schildert. Es werden die historischen Hintergründe der Region und die Darstellung des Zusammenlebens von Polen und Deutschen beleuchtet. Kapitel drei untersucht Günter Grass’ Roman „Die Blechtrommel“ mit Fokus auf die polnischen Figuren und deren Rolle in der Handlung. Dabei werden die Lebensumstände des Protagonisten Oskar Matzerath in der deutschen und polnischen Gesellschaft sowie die sprachliche Gestaltung der polnischen Figuren in der Blechtrommel analysiert. Kapitel vier analysiert Johannes Bobrowskis Roman „Levins Mühle“, der sich mit der Geschichte eines deutschen Großvaters in Ostpreußen beschäftigt und die Konfrontation mit der polnischen Bevölkerung thematisiert. Das fünfte Kapitel befasst sich mit Günter Grass’ Erzählung „Unkenrufe“, die sich mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs und den Schwierigkeiten einer Versöhnung zwischen Deutschen und Polen auseinandersetzt.
Schlüsselwörter
Deutsch-polnisches Verhältnis, Stereotypen, Identität, Grenzsituation, Oberschlesien, Danzig, Ostpreußen, Geschichte, Zeitgeschichte, Literatur, Prosa, Roman, Erzählung, Bobrowski, Grass, Scholtis, Polenbild.
Welche Autoren werden in dieser Untersuchung zum deutsch-polnischen Verhältnis analysiert?
Die Arbeit analysiert Werke von August Scholtis, Günter Grass und Johannes Bobrowski.
Welche Rolle spielen Stereotype in der Literatur laut dieser Arbeit?
Stereotype dienen als subjektiv geprägte Leitbilder, die in der Literatur kritisch hinterfragt, aufgebrochen oder durch Gegenbilder ersetzt werden können.
Welche Werke von Günter Grass werden im Text behandelt?
Behandelt werden der Roman "Die Blechtrommel" und die Erzählung "Unkenrufe".
Worum geht es in Johannes Bobrowskis "Levins Mühle"?
Der Roman thematisiert die nationale Interaktion und Konfrontation zwischen Deutschen und Polen in Ostpreußen am Beispiel eines Mühlenbesitzers.
Was ist der historische Rahmen der Untersuchung?
Die Untersuchung spannt einen Bogen von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg (Scholtis) über die Nachkriegszeit (Die Blechtrommel) bis hin zur Zeit nach der Wende (Unkenrufe).
Welche Regionen stehen im Mittelpunkt der literarischen Schauplätze?
Zentrale Schauplätze sind Oberschlesien, Danzig und Ostpreußen.