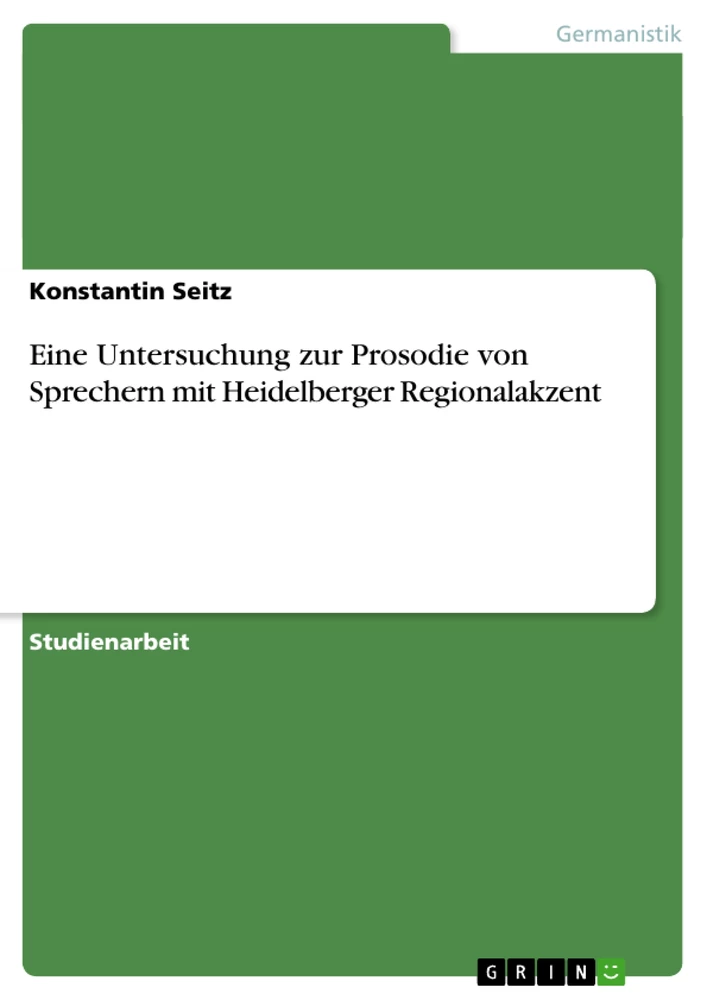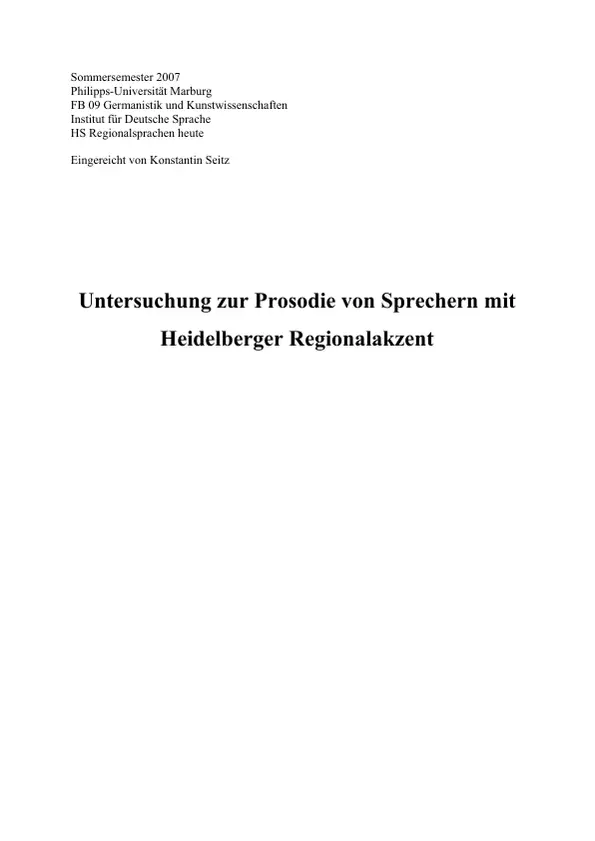Sprachaufnahmen von Heidelberger Polizisten wurden angehört und die perzeptiven Impressionen anschließend im intersubjektiven Vergleich überprüft, analysiert und schematisiert. Grundlage hierfür ist der Ansatz nach Adriaens (1991), der hörrelevante prosodische Größen zur Forschungsgrundlage macht. Dabei werden überspezifizierte Messergebnisse auf kleinstmögliche perzeptiv relevante Einheiten reduziert.
Die visualisierten Tonhöhenverläufe (Pitch-Konturen) wurden auf das prosodische Merkmal, das auditiv als Tonhöhenverlauf wahrgenommen werden kann reduziert und zu stilisierten Copy-Konturen vereinfacht.
So konnten einige auffällige Merkmale in den untersuchten Heidelberger Aufnahmen festgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Methode
- 2. Ergebnisse
- 2.1. Tonhöhenschwankungen innerhalb einzelner Silben
- 2.1.1. Tonhöhenverläufe im Kontext
- 2.2. „steigend-fallend“-Muster in Interrogationsphrasen
- 2.3. „Heidelberger Doppelpunkt“ -minimale Tonhöhenschwankungen innerhalb der Tonhöhenverläufe
- 2.4. Heidelberger Singsang
- 2.5. Phänomen des „Stimmbruchs“
- 3. Zum Forschungsstand
- 3.1. „Schleifton“ nach Peters
- 4. Beispiel-Kategorien
- 4.1 Aussagephrasen
- 4.1.1 Aussagephrasen - zweistufig fallend - nebenbetont
- 4.1.1.1 Beispiele „stillt“, „den“ und „und“
- 4.1.1.2 Beispiel „müssen“
- 4.1.2 Aussagephrasen - zweistufig fallend - hauptbetont
- 4.1.2.1 Beispiel „Punkt“
- 4.1.2.2 Beispiel „kühlt“
- 4.1.3 Aussagephrasen - steigend-fallend - nebenbetont
- 4.1.3.1 Beispiel „müsste“
- 4.1.3.2 Beispiele „sie“, „sie“, „sind“
- 4.1.4a Aussagephrasen – steigend-fallend – hauptbetont
- 4.1.4a.1 Beispiel „Polizeinotruf“
- 4.1.4a.2 Beispiel „Kaltes“
- 4.1.4a.3 Beispiel: „einfällt“
- 4.1.4b Aussagephrasen – leicht steigend-fallend – hauptbetont
- 4.1.4b.1 Beispiel „aufhören“
- 4.1.4b.2 Beispiel „Polizeiposten“
- 4.1.4b.3 Beispiele „kühlen“, „Kaltes“
- 4.1.5 Aussagephrasen – fallend-steigend – nebenbetont
- 4.1.5.1 Beispiel „das“
- 4.1.5.2 Beispiel „nei“
- 4.1.6 Aussagephrasen – fallend-steigend – hauptbetont
- 4.2. Interrogationsphrase
- 4.2.1 Interrogationsphrase - zweistufig fallend – nebenbetont
- 4.2.1.1 Beispiel „wer“
- 4.2.2 Interrogationsphrase - zweistufig fallend – hauptbetont
- 4.2.2.1 Beispiel „lose“
- 4.2.3 Interrogationsphrase - steigend-fallend – Entscheidungsfragen
- 4.2.3.1 Beispiel „eusch“
- 4.2.3.2 Beispiel „Kreuz“
- 4.2.3.3 Beispiel „Sie“
- 4.2.4 Interrogationsphrase - fallend-steigend – nebenbetont
- 4.2.5.1 Beispiel „wo“
- 4.2.5 Interrogationsphrase - fallend-steigend – hauptbetont
- 4.2.6.1 Beispiel „passiert“
- 5. Thesen
- 5.1 „steigend-fallend“-Muster in Interrogationsphrasen
- 5.2. Phänomen des „Stimmbruchs“
- 5.2.1 Beispiel „hinaus“
- 5.2.2 Beispiel „wissen“
- 5.3 „Heidelberger Singsang“
- 5.3.1 Beispiel „kühlen, was Kaltes“
- 5.3.2 Beispiel: „was den Leuten einfällt!“
- 5.3.3 Beispiel „Da muss ich erst mal in die Datenbank hineinholen!“
- Beschreibung der Tonhöhenschwankungen innerhalb einzelner Silben im Heidelberger Akzent.
- Analyse von „steigend-fallend“-Mustern in Interrogationsphrasen.
- Untersuchung des Phänomens „Heidelberger Singsang“.
- Beschreibung des „Stimmbruchs“ als prosodisches Merkmal.
- Vergleich mit dem Forschungsstand zur Prosodie und regionalen Varietäten.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Prosodie des Heidelberger Regionalakzents. Ziel ist die Beschreibung und Analyse spezifischer prosodischer Merkmale dieses Akzents anhand von Sprachaufnahmen Heidelberger Polizisten. Die Studie konzentriert sich auf die Identifizierung und Charakterisierung von Tonhöhenverläufen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Methode: Die Arbeit beschreibt die angewandte Methode, die auf der subjektiven Wahrnehmung von prosodischen Merkmalen basiert, gefolgt von einer Überprüfung und Visualisierung mittels des Programms „Praat“. Die subjektive Perzeption wird durch visualisierte Tonhöhenverläufe überprüft und vereinfacht, um die perzeptiv relevanten Einheiten zu identifizieren. Der Ansatz folgt Adriaens' Modell deutscher Intonation, das hörrelevante prosodische Größen zur Forschungsgrundlage macht und überspezifizierte Messergebnisse auf kleinstmögliche perzeptiv relevante Einheiten reduziert.
2. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse der Sprachaufnahmen. Es werden verschiedene Tonhöhenschwankungen innerhalb einzelner Silben identifiziert (zweistufig fallend, steigend-fallend, fallend-steigend, steigend-fallend-steigend), die sich vom Standarddeutschen unterscheiden. Die Analyse beleuchtet den Kontext dieser Variationen, wobei die meisten als kontextunabhängig beschrieben werden. Ausnahmen bilden der „Stimmbruch“ und eine kurze Fallbewegung am Ende von Fragen. Die Ergebnisse liefern eine detaillierte Beschreibung der spezifischen prosodischen Merkmale des Heidelberger Akzents.
3. Zum Forschungsstand: Dieses Kapitel setzt die Ergebnisse in den Kontext des bestehenden Forschungsstandes zur Prosodie und insbesondere zum „Schleifton“ nach Peters. Es wird ein Vergleich angestellt und die Einordnung der eigenen Ergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs vorgenommen. Die Bezugnahme auf bestehende Theorien und Studien bildet einen wichtigen Teil dieser Analyse, um die Bedeutung und Neuheit der eigenen Forschungsarbeit herauszustellen.
4. Beispiel-Kategorien: Dieses Kapitel präsentiert detaillierte Beispiele für die identifizierten prosodischen Muster, unterteilt nach Aussage- und Interrogationsphrasen und nach Betonungsmuster. Jede Kategorie wird anhand von konkreten Beispielen aus den Sprachaufnahmen erläutert und illustriert. Die ausführliche Darstellung der Beispiele dient der Veranschaulichung der in Kapitel 2 beschriebenen Ergebnisse und zur genaueren Beschreibung der spezifischen Merkmale des Heidelberger Akzents.
5. Thesen: Das Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse der Studie in Form von Thesen zusammen. Es werden die wichtigsten Beobachtungen zu den „steigend-fallend“-Mustern in Interrogationsphrasen, dem Phänomen des „Stimmbruchs“ und dem „Heidelberger Singsang“ prägnant formuliert und diskutiert. Die Thesen bilden einen zusammenfassenden Überblick über die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit.
Schlüsselwörter
Heidelberger Regionalakzent, Prosodie, Tonhöhenverlauf, Intonation, regionale Varietät, Sprachanalyse, „steigend-fallend“-Muster, „Stimmbruch“, „Heidelberger Singsang“, perzeptive Analyse, Praat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des Heidelberger Regionalakzents
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Prosodie des Heidelberger Regionalakzents, insbesondere die Tonhöhenverläufe in Aussage- und Interrogationsphrasen. Die Analyse basiert auf Sprachaufnahmen von Heidelberger Polizisten.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Methode kombiniert subjektive Wahrnehmung prosodischer Merkmale mit einer Überprüfung und Visualisierung mittels des Programms Praat. Der Ansatz folgt Adriaens' Modell deutscher Intonation, um hörrelevante prosodische Einheiten zu identifizieren.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Analyse identifizierte verschiedene Tonhöhenschwankungen (zweistufig fallend, steigend-fallend, fallend-steigend etc.), die sich vom Standarddeutschen unterscheiden. Besondere Aufmerksamkeit erhielten der „Stimmbruch“ und der „Heidelberger Singsang“.
Was ist der „Heidelberger Singsang“?
Der „Heidelberger Singsang“ ist ein in der Arbeit beschriebenes prosodisches Merkmal des Heidelberger Akzents, das sich durch spezifische Tonhöhenverläufe auszeichnet. Konkrete Beispiele hierfür werden im Kapitel zu den Beispiel-Kategorien erläutert.
Was ist der „Stimmbruch“ im Kontext dieser Studie?
Der „Stimmbruch“ bezeichnet ein spezifisches prosodisches Merkmal, welches durch einen abrupten Tonhöhenwechsel charakterisiert ist und im Heidelberger Akzent beobachtet wurde. Beispiele hierfür sind im Kapitel zu den Ergebnissen und den Thesen zu finden.
Wie werden die Ergebnisse im Kontext des Forschungsstands eingeordnet?
Die Ergebnisse werden im Kontext des bestehenden Forschungsstands zur Prosodie, insbesondere zum „Schleifton“ nach Peters, eingeordnet. Ein Vergleich mit existierenden Theorien und Studien wird durchgeführt.
Welche Beispiel-Kategorien wurden untersucht?
Die Analyse unterscheidet zwischen Aussage- und Interrogationsphrasen, jeweils unterteilt nach Betonung (Haupt- und Nebenbetonung). Für jede Kategorie werden detaillierte Beispiele mit Tonhöhenverläufen präsentiert.
Welche Thesen werden aufgestellt?
Die zentralen Ergebnisse werden in Form von Thesen zusammengefasst, die sich auf die „steigend-fallend“-Muster in Interrogationsphrasen, den „Stimmbruch“ und den „Heidelberger Singsang“ konzentrieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heidelberger Regionalakzent, Prosodie, Tonhöhenverlauf, Intonation, regionale Varietät, Sprachanalyse, „steigend-fallend“-Muster, „Stimmbruch“, „Heidelberger Singsang“, perzeptive Analyse, Praat.
Wo finde ich detaillierte Beispiele?
Detaillierte Beispiele für die identifizierten prosodischen Muster finden sich in Kapitel 4 ("Beispiel-Kategorien"), unterteilt nach Aussage- und Interrogationsphrasen sowie Betonungsmustern.
- Citation du texte
- Konstantin Seitz (Auteur), 2007, Eine Untersuchung zur Prosodie von Sprechern mit Heidelberger Regionalakzent, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80084