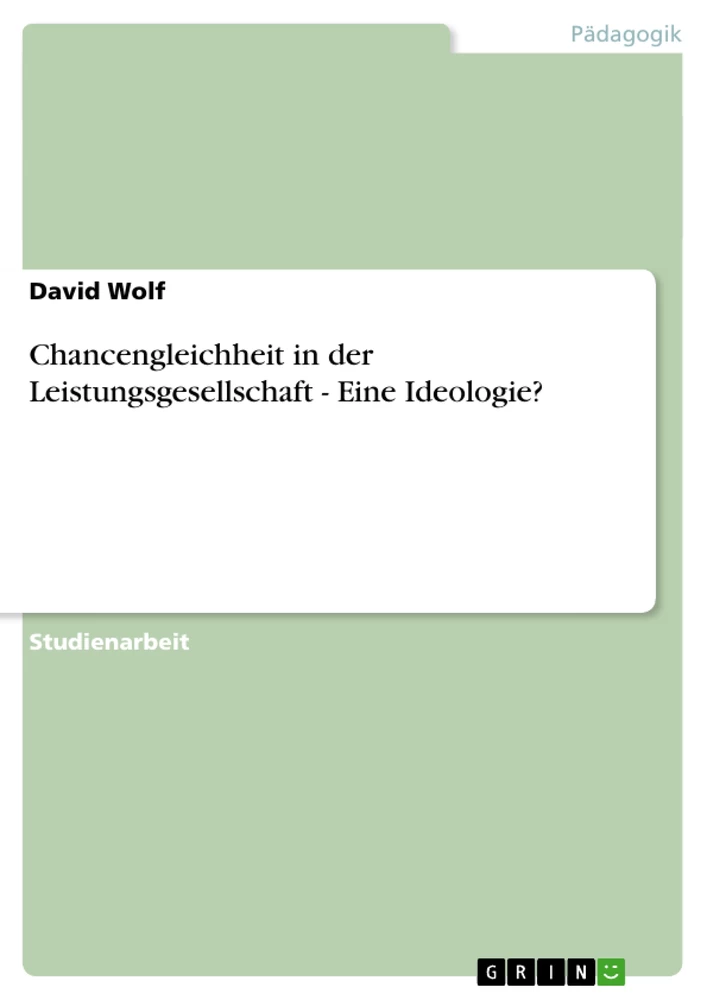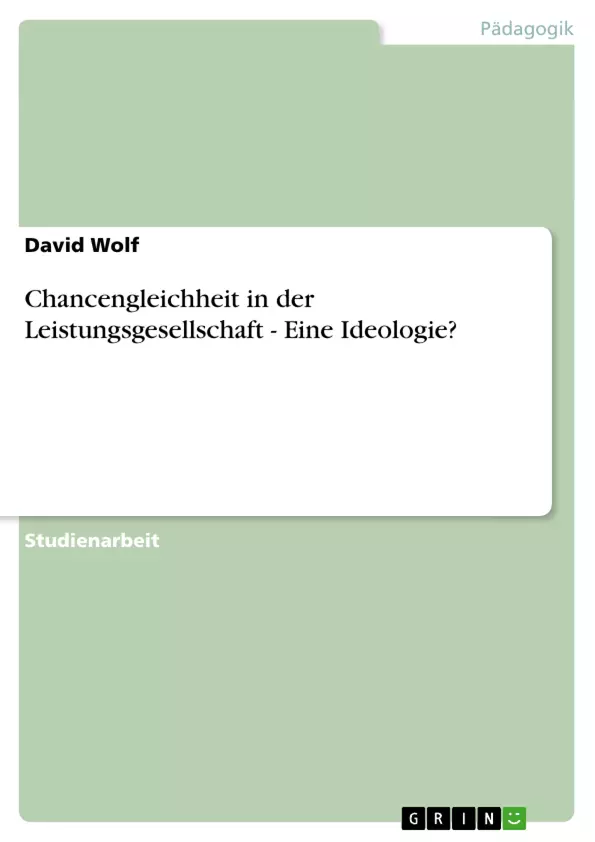In den letzten Monaten und Jahren ist es verstärkt zu einer politischen Diskussion um den Wirtschaftsstandort Deutschland gekommen. Dabei prallen die unterschiedlichsten Meinungen aufeinander. Die einen fordern einen Staat, der sich zum größten Teil aus der Wirtschaft und den Wirtschaftsabläufen heraushält; die anderen sehen gerade in der Lenkung der Wirtschaftsabläufe, d.h. in einer gezielten Wirtschaftspolitik, das non plus ultra. Nur allzu oft bleiben aber diejenigen in der öffentlichen Diskussion außen vor, die durch ihre eigentliche Arbeitsleistung erheblichen Einfluss auf die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes haben, eben die arbeitende Bevölkerung. Volkswirtschaftlich spricht man vom sogenannten Humankapital. Dabei handelt es sich um ,,das einer Volkswirtschaft zur Verfügung stehende menschliche Leistungs- potential einschließlich Leistungsreserven und zukünftigen Leistungspotentialen. Es umfasst sowohl die Personen mit ihren angeborenen und/oder durch Investitionen in Schul- und Berufsausbildung geschaffenen Fertigkeiten und Kenntnissen als auch die personelle Zusammensetzung einer Volkswirtschaft."1 In dieser Definition taucht immer wieder das Wort ,,Leistung" auf. Diese Leistung, ausgedrückt in den Fertigkeiten und Kenntnissen, wird in einer Volkswirtschaft auf vielfältige Weise erbracht und ist, wie oben erwähnt, entweder angeboren oder muss erst erworben werden. Was aber verbirgt sich hinter dem Begriff der Leistung ? Dies muss zunächst in einem ersten Schritt geklärt werden.
[...]
_____
1 Knaur, Universallexikon 1991,1992, Bd. 7, S. 2580
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Chancengleichheit im deutschen Bildungswesen
- 2.1 Geschichtliche Verortung
- 2.2 Die Bedeutung der Chancengleichheit für die Wissenschaft
- 3. Festlegung der Untersuchungsindikatoren
- 4. Darstellung und Interpretation des Datenmaterials
- 4.1 Untersuchung der einzelnen Indikatoren
- 4.1.1 Bildungstradition im Elternhaus
- 4.1.2 Berufliche Stellung der Eltern
- 4.1.3 Elterliches Einkommen
- 4.2 Die wirtschaftliche Lage der Studierenden
- 4.1 Untersuchung der einzelnen Indikatoren
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage, ob in der deutschen Leistungsgesellschaft tatsächlich Chancengleichheit im Bildungswesen herrscht. Sie beleuchtet die geschichtliche Entwicklung des Begriffs Chancengleichheit sowie dessen Bedeutung für die Wissenschaft. Dabei werden die wirtschaftlichen und sozialen Faktoren beleuchtet, die den Zugang zum Studium beeinflussen könnten.
- Chancengleichheit in der Leistungsgesellschaft
- Die Rolle der Bildung im Kontext der Leistungsgesellschaft
- Einflussfaktoren auf den Bildungsstatus von Studierenden
- Untersuchung von Disparitäten im Hinblick auf Chancengleichheit
- Interpretation von Daten zur sozialen und wirtschaftlichen Herkunft von Studierenden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik der Chancengleichheit in der Leistungsgesellschaft ein und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Bildung und wirtschaftlicher Leistung. Das Kapitel 2 analysiert die geschichtliche Entwicklung des Begriffs Chancengleichheit und deren Bedeutung für die Wissenschaft. Kapitel 3 definiert die Untersuchungsindikatoren, die im Folgenden zur Analyse des Datenmaterials dienen. Kapitel 4 präsentiert und interpretiert die Daten aus der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes, um mögliche Disparitäten im Hinblick auf die Chancengleichheit im Studium aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Leistungsgesellschaft, Bildungswesen, Humankapital, Bildungsstatus, Soziale Marktwirtschaft, wirtschaftliche und soziale Herkunft von Studierenden, Datenanalyse, Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes.
Häufig gestellte Fragen
Ist Chancengleichheit in Deutschland eine Ideologie oder Realität?
Die Hausarbeit untersucht kritisch, ob im deutschen Bildungswesen tatsächlich Chancengleichheit herrscht oder ob soziale Disparitäten den Zugang zum Studium bestimmen.
Was versteht man unter "Humankapital"?
Es bezeichnet das Leistungspotential einer Volkswirtschaft, bestehend aus angeborenen sowie durch Ausbildung erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten der Bevölkerung.
Welche Faktoren beeinflussen den Bildungserfolg am stärksten?
Die Arbeit analysiert Indikatoren wie die Bildungstradition im Elternhaus, die berufliche Stellung der Eltern und das elterliche Einkommen.
Welche Datenquelle wird für die Untersuchung genutzt?
Die Analyse basiert maßgeblich auf den Daten der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes.
Wie wirkt sich die wirtschaftliche Lage auf Studierende aus?
In Kapitel 4.2 wird detailliert die wirtschaftliche Situation der Studierenden beleuchtet und interpretiert, um Rückschlüsse auf die Chancengerechtigkeit zu ziehen.
- Quote paper
- David Wolf (Author), 2001, Chancengleichheit in der Leistungsgesellschaft - Eine Ideologie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8009