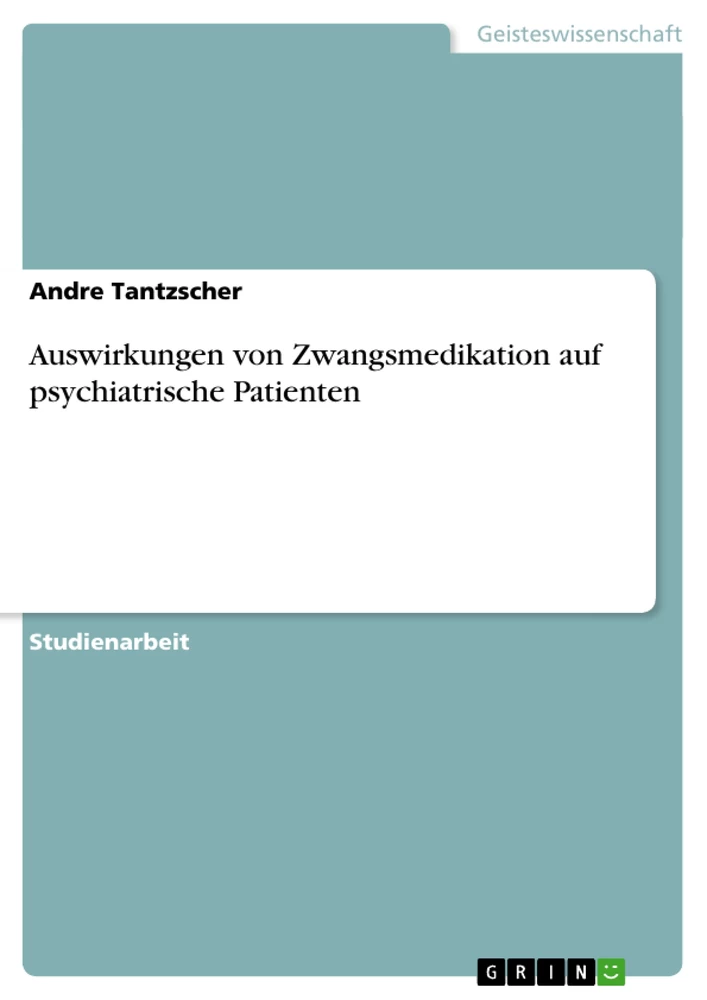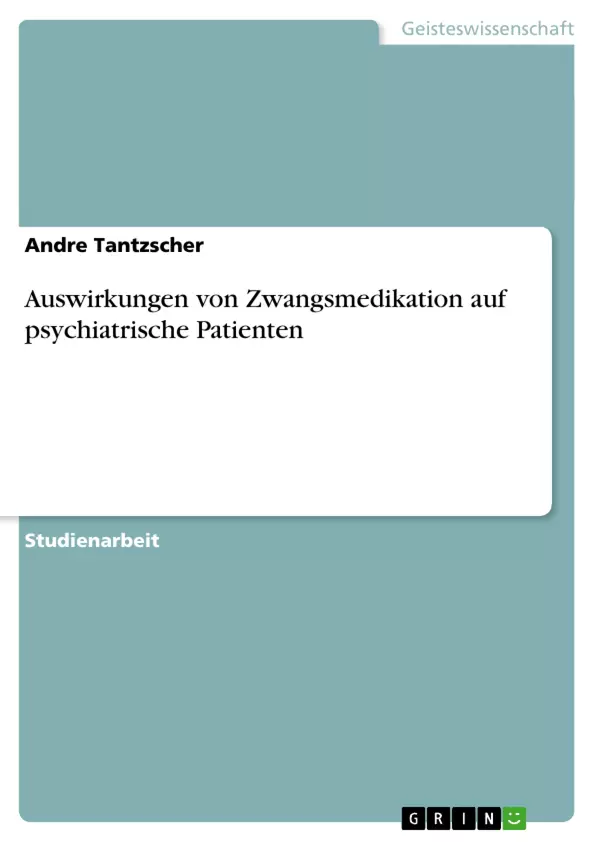Meinen Zivildienst absolvierte ich 1997/1998 in einer Körperbehindertenschule in Hannover. Mir wurde die individuelle Schwerstbehindertenbetreuung eines 16jährigen Jugendlichen, der als Behinderungsbild athetotische Tetraplegie hatte, übertragen. Er saß in einem Rollstuhl. Außer dem üblichen Rollstuhlbeckengurt waren an dem Rollstuhl zusätzliche Gurte auf den Armlehnen und am Fußbrett installiert. Bei meiner Betreuungseinweisung wurde mir erklärt, dass ich die Arme und Füße dieses Schülers festschnallen sollte, wenn ich mit ihm über den Schulkorridor fuhr, damit er weder sich noch andere durch seine unkontrollierten Bewegungen mit den Armen und Beinen verletze. Anfangs schnallte ich ihn auch fest. Ich fixierte ihn. Jedoch versuchte ich mich in seine Lage hinein zu versetzen und ließ mich auch einmal in seinem Rollstuhl fixieren. Dabei erlebte ich ein Gefühl der vollkommenen Ausgeliefertheit sowie Machtlosigkeit. Während meiner Zivildienstzeit übte ich mit diesem Schüler das Fahren mit dem Rollstuhl durch die Schule ohne Fixierung. Ich stellte fest, dass er ohne die Fesseln in einem ruhigeren Zustand war. Mit seinen Arm- und Fußgurten verkrampfte er sich zunehmend.
An dieses Erlebnis erinnerte ich mich als ich im Vorlesungsverzeichnis über die Vorlesung „Hilfe wider Willen – Zwang und Gewalt in der Psychiatrie“ las.
Ich wollte mehr darüber wissen und tiefer in die Thematik einsteigen.
Meine Hausarbeit beginnt mit der Klärung der Begriffe „Gewalt“, „Zwangseinweisung“, „Zwangsmedikation“. Im Hauptteil setze ich mich mit dem Erlebten des Patienten und Auswirkungen der Zwangseinweisung sowie Zwangsmedikation auseinander. Zum Schluss formuliere ich sozialpädagogische Ansätze zur Gewaltminderung in der Psychiatrie.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärung
- 2.1 Gewalt
- 2.2 Zwangseinweisung
- 2.3 Zwangsmedikation
- 3 Auswirkungen der Zwangsmedikation
- 3.1 Ablauf einer Zwangsmedikation
- 3.2 Wirkungen und Nebenwirkungen der Zwangsmedikamente
- 3.3 Die Fixierung
- 3.4 Erleben durch den Patienten
- 3.5 Stigmatisierung
- 3.6 Wechselwirkung Gewalt und Gegengewalt
- 4 Sozialpädagogische Ansätze zur Gewaltminderung
- 4.1 Deeskalationsmaßnahmen und Zuhören
- 4.2 Institutionelle Veränderungen
- 4.3 Beschwerdestellen
- 4.4 Aufklärungsarbeit
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen von Zwangsmedikation auf psychiatrische Patienten. Sie beleuchtet die Definitionen von Gewalt und Zwang im Kontext der Psychiatrie und analysiert den Ablauf einer Zwangsmedikation, inklusive der damit verbundenen physischen und psychischen Folgen für Betroffene. Die Arbeit untersucht zudem sozialpädagogische Ansätze zur Gewaltminderung.
- Definitionen von Gewalt und Zwang in der Psychiatrie
- Ablauf und Auswirkungen von Zwangsmedikation
- Erleben der Zwangsmaßnahmen aus Patientensicht
- Stigmatisierung von Psychiatrieerfahrenen
- Sozialpädagogische Ansätze zur Gewaltminderung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit wird durch eine persönliche Erfahrung des Autors im Zivildienst eingeleitet, die die Thematik der Fixierung und deren Auswirkungen auf den Betroffenen verdeutlicht. Der Autor kündigt die Klärung der Begriffe Gewalt, Zwangseinweisung und Zwangsmedikation an, gefolgt von einer Auseinandersetzung mit dem Erleben des Patienten und sozialpädagogischen Ansätzen zur Gewaltminderung.
2 Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt die vielschichtigen Bedeutungen von Gewalt und unterscheidet diese vom legitimierten Zwang. Es werden verschiedene Definitionen von Gewalt präsentiert und der Begriff des Zwangs im Kontext von Zwangseinweisung und Zwangsmedikation erläutert. Die rechtlichen Grundlagen für Zwangseinweisungen werden skizziert, und die Notwendigkeit von Zwangsmedikationen in bestimmten Fällen (z.B. lebensbedrohliche organische Erkrankungen) wird diskutiert. Die verschiedenen Formen der Zwangsmedikation, vom Aufzeigen von Konsequenzen bis hin zur körperlichen Gewalt, werden beschrieben.
3 Auswirkungen der Zwangsmedikation: Dieses Kapitel beschreibt die zwei Hauptaufgaben der Psychiatrie und stellt fest, dass nur ein Drittel der Zwangseinweisungen auf selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten zurückzuführen ist. Es gliedert den Ablauf einer Zwangsmedikation in drei Phasen: Anbahnung, Zwangsanwendung und Verarbeitung. Die Zwangsanwendung wird aus situativ-aktueller und historisch-biographischer Perspektive beleuchtet. Es werden die Wirkungen und Nebenwirkungen verschiedener Medikamentengruppen (Neuroleptika, Antidepressiva, Tranquilizer) diskutiert. Die Fixierung als massiver Eingriff in die Patientenrechte wird erklärt. Schließlich wird das Erleben der Zwangsmaßnahmen aus Patientensicht detailliert dargestellt, unter Bezugnahme auf Umfragen und Interviews, welche die negative Wahrnehmung der Betroffenen, die oft mit Gefühlen von Kränkung und Entwürdigung einhergeht, belegen. Stigmatisierung und die Wechselwirkung zwischen Gewalt und Gegengewalt werden als weitere wichtige Aspekte behandelt.
4 Sozialpädagogische Ansätze zur Gewaltminderung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene sozialpädagogische Ansätze zur Gewaltminderung in der Psychiatrie. Es beginnt mit Deeskalationsmaßnahmen und der Bedeutung des aktiven Zuhörens. Institutionelle Veränderungen wie das Herner Modell (offene Tür, Außenorientierung, Heterogenität) werden diskutiert. Die Einrichtung von funktionierenden Beschwerdestellen und die Bedeutung von Aufklärungsarbeit, sowohl in der Familie als auch in der Öffentlichkeit, werden als wichtige Faktoren zur Verbesserung der Situation hervorgehoben. Ein Beispiel für einen Notfallplan zur Vermeidung von Aggressionen wird vorgestellt.
Schlüsselwörter
Zwangsmedikation, Psychiatrie, Gewalt, Zwangseinweisung, Patientenrechte, Stigmatisierung, Deeskalation, Sozialpädagogik, Psychopharmaka, Nebenwirkungen, Gewaltminderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Zwangsmedikation in der Psychiatrie
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Auswirkungen von Zwangsmedikation auf psychiatrische Patienten. Sie beleuchtet die Definitionen von Gewalt und Zwang im Kontext der Psychiatrie, analysiert den Ablauf einer Zwangsmedikation mit den physischen und psychischen Folgen und betrachtet sozialpädagogische Ansätze zur Gewaltminderung.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definitionen von Gewalt und Zwang in der Psychiatrie, den Ablauf und die Auswirkungen von Zwangsmedikation, das Erleben der Zwangsmaßnahmen aus Patientensicht, die Stigmatisierung von Psychiatrieerfahrenen und sozialpädagogische Ansätze zur Gewaltminderung.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Begriffsklärung (Gewalt, Zwangseinweisung, Zwangsmedikation), einem Kapitel zu den Auswirkungen der Zwangsmedikation (Ablauf, Wirkungen, Nebenwirkungen, Fixierung, Patientenerleben, Stigmatisierung, Gewalt und Gegengewalt), einem Kapitel zu sozialpädagogischen Ansätzen zur Gewaltminderung (Deeskalation, institutionelle Veränderungen, Beschwerdestellen, Aufklärungsarbeit) und einem Fazit.
Was wird unter „Zwangsmedikation“ verstanden?
Die Hausarbeit beschreibt Zwangsmedikation als einen Eingriff, der verschiedene Formen annehmen kann, vom Aufzeigen von Konsequenzen bis hin zur körperlichen Gewalt. Die rechtlichen Grundlagen und die Notwendigkeit in bestimmten Fällen (z.B. lebensbedrohliche organische Erkrankungen) werden diskutiert.
Welche Auswirkungen hat Zwangsmedikation auf Patienten?
Die Hausarbeit beschreibt die Auswirkungen aus verschiedenen Perspektiven: den Ablauf in Phasen (Anbahnung, Zwangsanwendung, Verarbeitung), die Wirkungen und Nebenwirkungen verschiedener Medikamentengruppen (Neuroleptika, Antidepressiva, Tranquilizer), die Fixierung als massiven Eingriff, das negative Erleben der Patienten (Kränkung, Entwürdigung) und die Stigmatisierung.
Welche sozialpädagogischen Ansätze zur Gewaltminderung werden vorgestellt?
Die Hausarbeit präsentiert Deeskalationsmaßnahmen und aktives Zuhören, institutionelle Veränderungen (z.B. das Herner Modell), funktionierende Beschwerdestellen und Aufklärungsarbeit als wichtige Faktoren zur Gewaltminderung in der Psychiatrie. Ein Beispiel für einen Notfallplan wird ebenfalls vorgestellt.
Wie wird Gewalt in der Hausarbeit definiert?
Die Hausarbeit klärt die vielschichtigen Bedeutungen von Gewalt und unterscheidet diese vom legitimierten Zwang. Es werden verschiedene Definitionen präsentiert und der Begriff des Zwangs im Kontext von Zwangseinweisung und Zwangsmedikation erläutert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Zwangsmedikation, Psychiatrie, Gewalt, Zwangseinweisung, Patientenrechte, Stigmatisierung, Deeskalation, Sozialpädagogik, Psychopharmaka, Nebenwirkungen, Gewaltminderung.
Wie wird die Einleitung der Hausarbeit gestaltet?
Die Einleitung beginnt mit einer persönlichen Erfahrung des Autors im Zivildienst, die die Thematik der Fixierung und deren Auswirkungen verdeutlicht. Der Autor kündigt die Klärung der Begriffe Gewalt, Zwangseinweisung und Zwangsmedikation an, gefolgt von einer Auseinandersetzung mit dem Erleben des Patienten und sozialpädagogischen Ansätzen zur Gewaltminderung.
- Arbeit zitieren
- Andre Tantzscher (Autor:in), 2005, Auswirkungen von Zwangsmedikation auf psychiatrische Patienten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80123