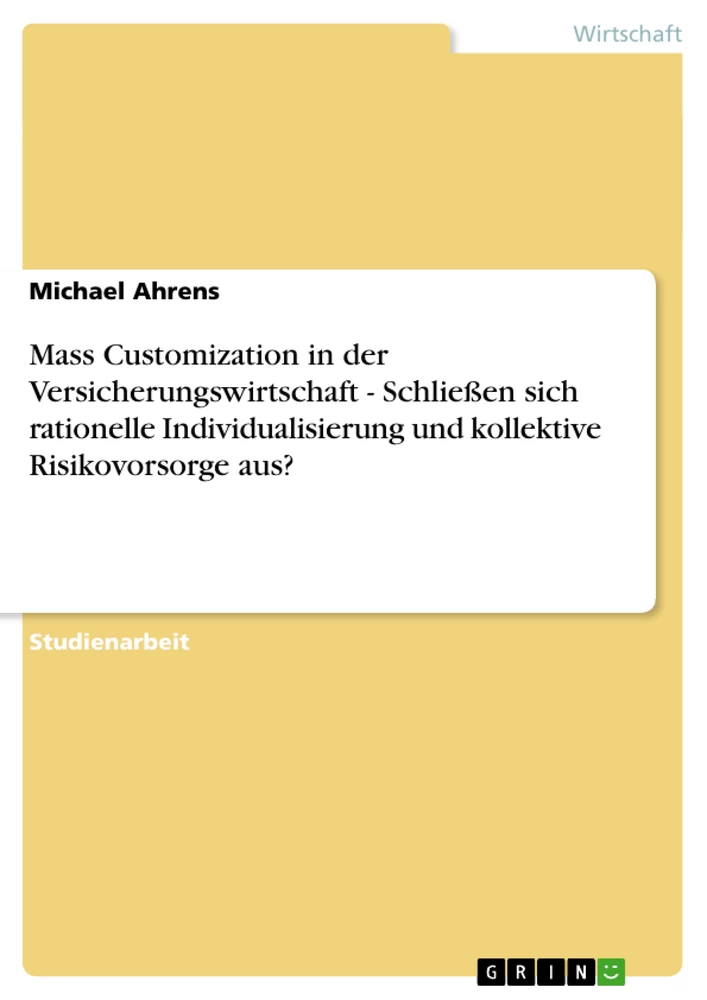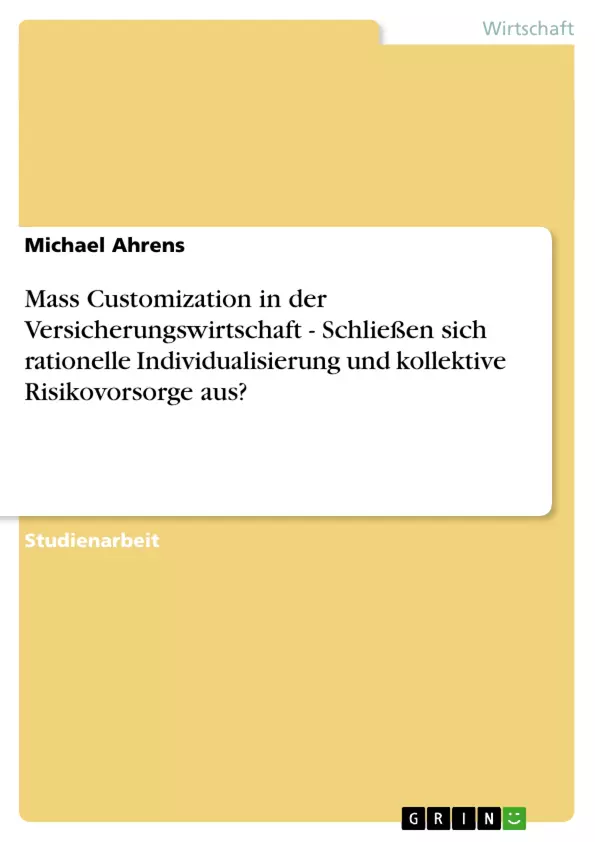Seit Beginn der industriellen Revolution vor 150 Jahren wurde das Bild der Wirtschaft zunehmend durch die massenhafte Fertigung homogener Standardwaren geprägt. Hierdurch wurde eine effiziente und rationelle Produktion erreicht. Neue technische und technologische Errungenschaften, wie das Internet und flexible Fertigungssysteme senken jedoch Informations- und Rüstkosten erheblich. Hierdurch erscheint, um den steigenden Anforderungen des Marktes nach individuellen Produkten gerecht zu werden, eine gleichzeitige Verfolgung von Differenzierungsstrategie und Kostenführerschaft als möglich. Der Begriff der Mass Customization bezog sich bisher vorrangig auf die Erstellung materieller Güter. Durch den Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft gewinnen immaterielle Güter neben Sachgütern immer mehr an Bedeutung.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, inwieweit das Konzept der Mass Customization in einer bestimmen Dienstleistungsbrache, der Versicherungswirtschaft, verwendet und umgesetzt werden kann. Dafür sollen folgende Fragestellungen im Mittelpunkt der Arbeit stehen.
- Wie lautet das Konzept der Mass Customization und welche Kritikpunkte gibt es?
- Sind die besonderen Grundsätze und Rahmenbedingungen der Versicherungswirtschaft mit dem Konzept der Mass Customization vereinbar?
- Wie kann eine Umsetzung der kundenindividuellen Massenproduktion von Versicherungsprodukten ausgestaltet werden?
- Welche Grenzen bestehen hierfür und wie können sie überwunden werden?
Im Rahmen dieser Arbeit muss auf weitere Fragen zur Mass Customization von Versicherungsprodukten verzichtet werden, so z.B. weitere Verwendungsmöglichkeiten der Individualisierungsinformationen, ökonomische Messbarkeit des Erfolgs der Strategie, inhaltliche und formale Ausgestaltung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die Bestandsführung, und Prozesssteuerung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung, Zielsetzung der Arbeit
- 2. Das Konzept Mass Customization
- 2.1 Mass Customization als Wettbewerbsstrategie
- 2.2 Kritik der Konzeptionen
- 2.3 Rahmenbedingungen und Individualisierungstrends
- 2.4 Mass Customization von Dienstleistungen
- 3. Mass Customization in der Versicherungswirtschaft
- 3.1 Grundlagen und Rahmenbedingungen
- 3.2 Versicherungstechnik und Versicherungsproduktion
- 3.2.1 Voraussetzungen der Versicherbarkeit
- 3.2.2 Tarifierung der Versicherungsleistung
- 3.2.3 Gesetzmäßigkeiten des Risikoausgleichs - Widerspruch zwischen Kollektiv und Individualisierung
- 3.3 Mass Customization der Versicherungsleistung
- 3.3.1 Mass Customization der Primärleistungen
- 3.3.2 Mass Customization der Sekundärleistungen
- 3.3.3 Grenzen der Individualisierung
- 4. Schlussbetrachtung und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob sich rationelle Individualisierung und kollektive Risikovorsorge im Kontext der Mass Customization in der Versicherungswirtschaft ausschließen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Möglichkeiten und Grenzen der Individualisierung von Versicherungsprodukten und -leistungen im Hinblick auf die grundlegenden Prinzipien der Versicherung.
- Mass Customization als Wettbewerbsstrategie in der Dienstleistungsbranche
- Die Bedeutung von Individualisierungstrends und Rahmenbedingungen für die Versicherungswirtschaft
- Anpassung von Versicherungsprodukten und -leistungen an individuelle Bedürfnisse
- Spannungsfeld zwischen Kollektiv und Individualisierung im Kontext des Risikoausgleichs
- Grenzen der Individualisierung in der Versicherungswirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung, Zielsetzung der Arbeit
Die Einleitung führt in das Thema Mass Customization in der Versicherungswirtschaft ein und stellt die Forschungsfrage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Individualisierung im Kontext der kollektiven Risikovorsorge. Die Zielsetzung der Arbeit wird dargelegt. - Kapitel 2: Das Konzept Mass Customization
Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept der Mass Customization als Wettbewerbsstrategie und analysiert seine Kritikpunkte. Es werden die Rahmenbedingungen und Individualisierungstrends in der Dienstleistungsbranche betrachtet und die Anwendung des Konzepts im Bereich der Dienstleistungen beleuchtet. - Kapitel 3: Mass Customization in der Versicherungswirtschaft
Das Kapitel behandelt die Grundlagen und Rahmenbedingungen der Versicherungswirtschaft. Es analysiert die Versicherungstechnik und -produktion, inklusive der Voraussetzungen der Versicherbarkeit, der Tarifierung von Versicherungsleistungen und der Gesetzmäßigkeiten des Risikoausgleichs. Der Widerspruch zwischen Kollektiv und Individualisierung in diesem Zusammenhang wird diskutiert. Das Kapitel betrachtet die Mass Customization von Primär- und Sekundärleistungen in der Versicherung und analysiert die Grenzen der Individualisierung.
Schlüsselwörter
Mass Customization, Versicherungswirtschaft, Individualisierung, Risikovorsorge, Kollektiv, Versicherungsprodukte, Versicherungstechnik, Tarifierung, Risikoausgleich, Primärleistungen, Sekundärleistungen, Grenzen der Individualisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Mass Customization in der Versicherungswirtschaft?
Es beschreibt die Strategie, Versicherungsangebote individuell an Kundenbedürfnisse anzupassen, während gleichzeitig die Kostenvorteile einer Massenproduktion gewahrt bleiben.
Schließen sich Individualisierung und kollektiver Risikoausgleich aus?
Die Arbeit untersucht dieses Spannungsfeld und prüft, ob eine zu starke Individualisierung die Gesetzmäßigkeiten des Risikoausgleichs im Kollektiv gefährdet.
Welche Primärleistungen können individualisiert werden?
Dazu gehören die Ausgestaltung des Versicherungsschutzes, die Wahl der Deckungssummen und die Anpassung der Tarife an das persönliche Risikoprofil.
Was sind Sekundärleistungen bei Versicherungsprodukten?
Sekundärleistungen umfassen Serviceangebote, Informationsbereitstellung oder zusätzliche Beratungsleistungen, die den Kernschutz ergänzen.
Welche technischen Entwicklungen ermöglichen Mass Customization?
Vor allem das Internet und flexible IT-Systeme senken die Informations- und Rüstkosten, sodass individuelle Tarifierungen rentabel werden.
Wo liegen die Grenzen der Individualisierung bei Versicherungen?
Grenzen bestehen durch rechtliche Rahmenbedingungen, die Komplexität der Bestandsführung und die Notwendigkeit, ein ausreichend großes Kollektiv für den Risikoausgleich zu erhalten.
- Citation du texte
- Dipl. Kfm. Michael Ahrens (Auteur), 2002, Mass Customization in der Versicherungswirtschaft - Schließen sich rationelle Individualisierung und kollektive Risikovorsorge aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8013