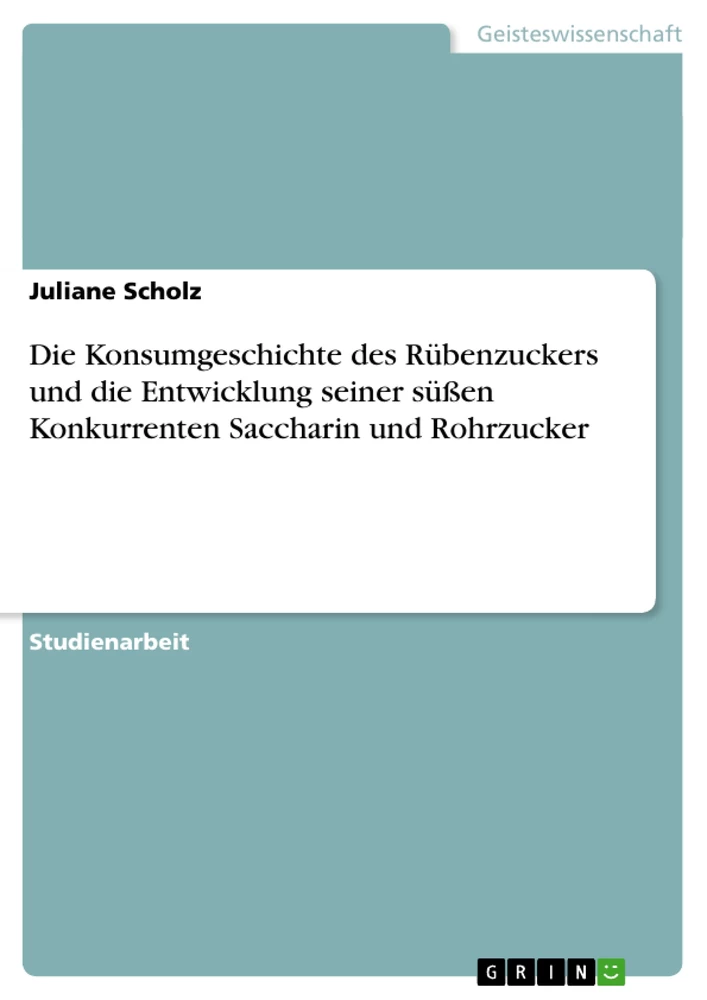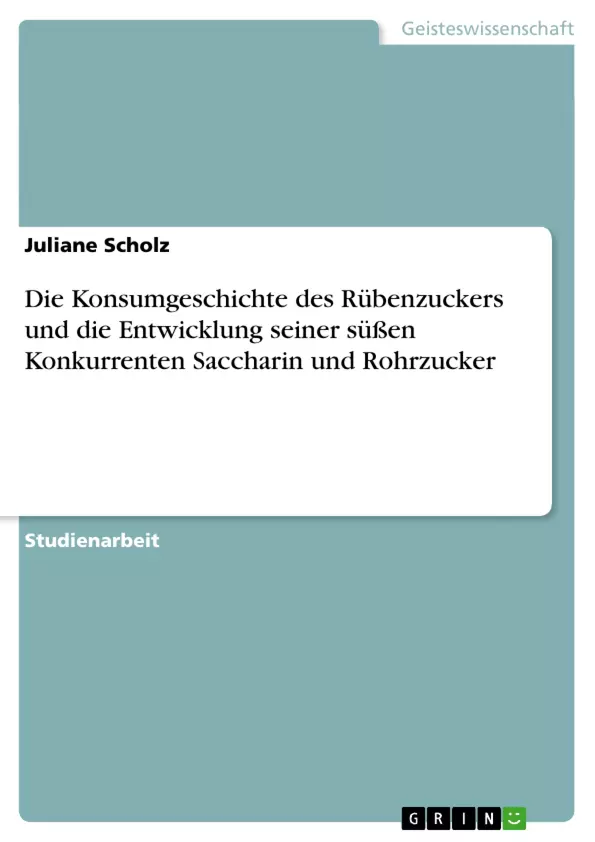In der vorliegenden Arbeit soll geklärt werden, inwieweit der in Deutschland erfundene Rübenzucker in Konkurrenz zu anderen Produkten wie dem Rohrzucker, den künstlichen Süßstoffen und dem Honig stand, und inwiefern sich dies auf den Konsum innerhalb der Gesellschaft auswirkte. Von Bedeutung sind ebenfalls die gesellschaftlichen und politischen Akteure und deren normative Rahmensetzung, in der der Zucker zu einem alltäglichen Nahrungsmittel werden konnte und bis heute einstige Konkurrenten substituiert hat. Neben den historischen Entwicklungen der Rübenzuckerindustrie, insbesondere in der mitteldeutschen Region, sowie der Veränderung der Bedeutung des Zuckers im 17. und 18. Jahrhundert, soll insbesondere auf politische sowie historische Faktoren eingegangen werden, die den Zuckerkonsum begünstigten oder beschränkten. Daneben spielen sozialpsychologische Aspekte eine Rolle, die den Zucker von einem reinen Luxusprodukt der Oberschicht zu einem alltäglichen Nahrungsmittel werden ließen. Hierbei soll neben Akteuren auch die kulturelle Bedeutung des Zuckerkonsums, welcher je nach Zeitpunkt als wertvoller Kalorienträger hofiert oder überwiegend als ungesund verteufelt wurde, untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die historische Entwicklung des Zuckerkonsums in Europa und seine Bedeutung im Zivilisationsprozess
- Anbau und Verbreitung des Zuckerrohrs von der Antike bis in die frühe Neuzeit
- Der Zuckerluxus vom Spätmittelalter bis zum 18. Jahrhundert
- Zuckerkonsum im 19. und 20. Jahrhundert
- Die Entwicklung der Rübenzuckers und seiner süßen Konkurrenten und ihre soziale und wirtschaftliche Bedeutung in Deutschland
- Die Pionierphase 1747-1840
- Expansionsphase 1841 bis 1880 - Rübenzucker versus Rohrzucker
- Die Ausweitung der Rübenzuckerindustrie 1881-1914 - Rübenzucker versus Saccharin
- Die Lösung der „Saccharinfrage“ und die Entwicklung des Rübenzuckers 1915 bis 1945
- Nachkriegszeit und europäischer Wirtschaftsraum - Das Ende des Zuckerkrieges?
- Der Zuckerkrieg im 21. Jahrhundert
- Künstliche Süßstoffe als Inbegriff des modernen Lebensstils
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konsumgeschichte des Rübenzuckers in Deutschland und seine Konkurrenz zu Rohrzucker und Saccharin. Ziel ist es, die Entwicklung des Zuckerkonsums von einem Luxusgut zu einem alltäglichen Nahrungsmittel zu beleuchten und die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren zu analysieren, die diese Entwicklung beeinflusst haben. Die Rolle der Akteure und die normative Rahmensetzung werden ebenso betrachtet wie sozialpsychologische Aspekte des Zuckerkonsums.
- Die historische Entwicklung des Zuckerkonsums in Europa
- Die Konkurrenz zwischen Rübenzucker, Rohrzucker und Saccharin
- Die soziale und wirtschaftliche Bedeutung des Zuckers in Deutschland
- Politische und historische Faktoren, die den Zuckerkonsum beeinflusst haben
- Die kulturelle Bedeutung des Zuckerkonsums
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Konsumgeschichte des Zuckers ein und hebt die vergleichbare Bedeutung von Zucker und Kartoffel hervor. Sie skizziert die unterschiedliche Entwicklung des Zuckerkonsums in England und Deutschland und benennt die zentrale Forschungsfrage: die Konkurrenz des Rübenzuckers zu Rohrzucker, künstlichen Süßstoffen und Honig und deren Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Konsum. Die Arbeit verspricht eine Betrachtung gesellschaftlicher und politischer Akteure, historischer Entwicklungen der Rübenzuckerindustrie, sowie sozialpsychologischer Aspekte, die zum Wandel des Zuckerkonsums beigetragen haben.
2. Die historische Entwicklung des Zuckerkonsums in Europa und seine Bedeutung im Zivilisationsprozess: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Zuckerkonsums in Europa, beginnend mit dem Anbau und der Verbreitung des Zuckerrohrs. Es verfolgt den Weg des Zuckers von einem Luxusgut der Oberschicht zu einem alltäglichen Nahrungsmittel für alle Bevölkerungsschichten. Dabei wird die Rolle des Zuckers im Zivilisationsprozess und seine Bedeutung für die Entwicklung der modernen Esskultur beleuchtet. Das Kapitel diskutiert auch die These einer fehlenden angeborenen Vorliebe für Süßes, unter Bezugnahme auf asiatische Esskulturen.
3. Die Entwicklung der Rübenzuckers und seiner süßen Konkurrenten und ihre soziale und wirtschaftliche Bedeutung in Deutschland: Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung des Rübenzuckers in Deutschland und seiner Konkurrenz zu Rohrzucker und Saccharin. Es gliedert sich in verschiedene Phasen, die jeweils die besonderen Herausforderungen und Entwicklungen der Rübenzuckerindustrie beleuchten. Der Fokus liegt auf der Expansionsphase, der Ausweitung der Industrie und der "Lösung der Saccharinfrage". Soziale und wirtschaftliche Implikationen werden ausführlich behandelt.
4. Nachkriegszeit und europäischer Wirtschaftsraum - Das Ende des Zuckerkrieges?: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Zuckermarktes in der Nachkriegszeit und im europäischen Wirtschaftsraum. Es untersucht den anhaltenden „Zuckerkrieg“ im 21. Jahrhundert und beleuchtet die Rolle künstlicher Süßstoffe im modernen Lebensstil. Die hier angesprochenen Entwicklungen im Zuckermarkt stehen in enger Beziehung zum vorherigen Kapitel und setzen den Fokus auf die langfristigen Auswirkungen der industriellen Entwicklungen auf den Konsum und dessen gesellschaftliche Relevanz.
Schlüsselwörter
Rübenzucker, Rohrzucker, Saccharin, Zuckerkonsum, Konsumgeschichte, Deutschland, Europa, Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Industrielle Revolution, Esskultur, Zivilisationsprozess, künstliche Süßstoffe, Zuckermarktordnung, Agrarpolitik.
FAQ: Konsumgeschichte des Rübenzuckers in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konsumgeschichte des Rübenzuckers in Deutschland und seine Konkurrenz zu Rohrzucker und Saccharin. Sie beleuchtet die Entwicklung des Zuckerkonsums von einem Luxusgut zu einem alltäglichen Nahrungsmittel und analysiert die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die diese Entwicklung beeinflusst haben. Die Rolle der Akteure und die normative Rahmensetzung werden ebenso betrachtet wie sozialpsychologische Aspekte des Zuckerkonsums.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Zuckerkonsums in Europa, den Wettbewerb zwischen Rübenzucker, Rohrzucker und Saccharin, die soziale und wirtschaftliche Bedeutung des Zuckers in Deutschland, politische und historische Einflussfaktoren auf den Zuckerkonsum und die kulturelle Bedeutung des Zuckerkonsums.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung des Zuckerkonsums in Europa, ein Kapitel zur Entwicklung des Rübenzuckers und seiner Konkurrenten in Deutschland, ein Kapitel zur Nachkriegszeit und dem europäischen Wirtschaftsraum und ein Resümee mit Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Zuckerkonsumgeschichte und deren Kontext.
Wie wird die Konkurrenz zwischen Rübenzucker, Rohrzucker und Saccharin dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Konkurrenz zwischen diesen drei Zuckerarten über verschiedene historische Phasen hinweg. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung der Rübenzuckerindustrie in Deutschland und ihren Herausforderungen im Wettbewerb mit Rohrzucker und später Saccharin. Die "Lösung der Saccharinfrage" wird als wichtiger Aspekt behandelt.
Welche Rolle spielen gesellschaftliche und politische Faktoren?
Die Arbeit betont die Bedeutung gesellschaftlicher und politischer Faktoren für die Entwicklung des Zuckerkonsums. Sie analysiert die Rolle verschiedener Akteure, die normative Rahmensetzung und die sozialpsychologischen Aspekte des Zuckerkonsums. Politische Entscheidungen und wirtschaftliche Entwicklungen werden als wichtige Einflussfaktoren dargestellt.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ist die Untersuchung der Konkurrenz des Rübenzuckers zu Rohrzucker, künstlichen Süßstoffen und Honig und deren Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Konsum.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rübenzucker, Rohrzucker, Saccharin, Zuckerkonsum, Konsumgeschichte, Deutschland, Europa, Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Industrielle Revolution, Esskultur, Zivilisationsprozess, künstliche Süßstoffe, Zuckermarktordnung, Agrarpolitik.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz darstellen.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet einen langen Zeitraum, beginnend mit der Antike und dem Anbau des Zuckerrohrs, über die Entwicklung der Rübenzuckerindustrie in verschiedenen Phasen bis in die Nachkriegszeit und das 21. Jahrhundert. Die Arbeit umfasst also mehrere Jahrhunderte.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für die Geschichte des Zuckerkonsums, die Entwicklung der Zuckerindustrie und die sozioökonomischen Aspekte des Zuckerkonsums interessieren. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke.
- Quote paper
- Juliane Scholz (Author), 2007, Die Konsumgeschichte des Rübenzuckers und die Entwicklung seiner süßen Konkurrenten Saccharin und Rohrzucker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80169