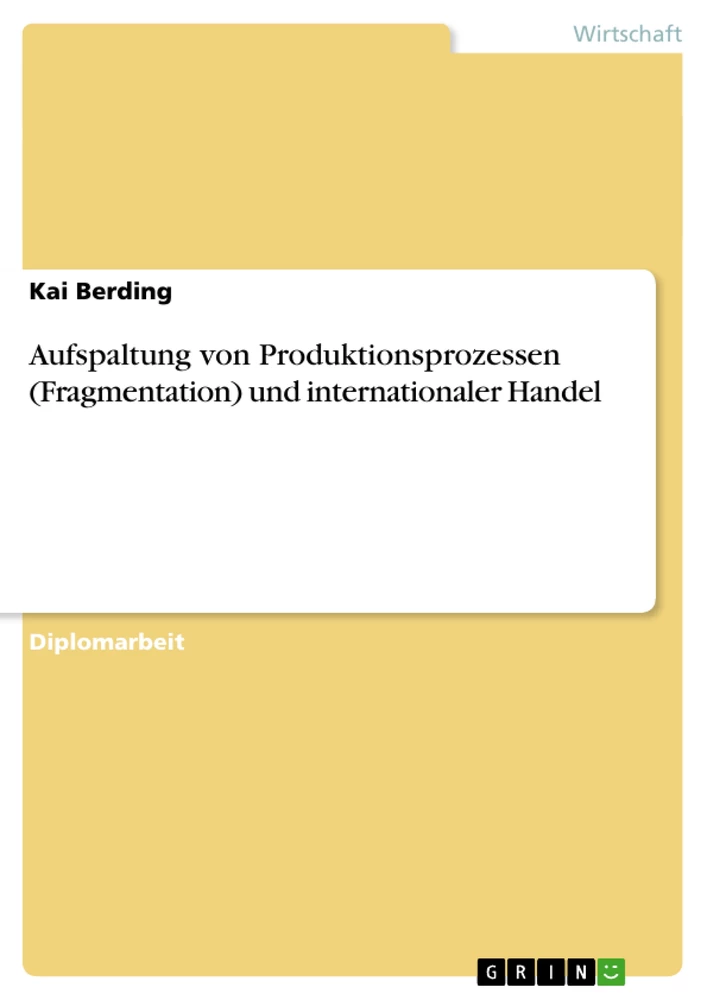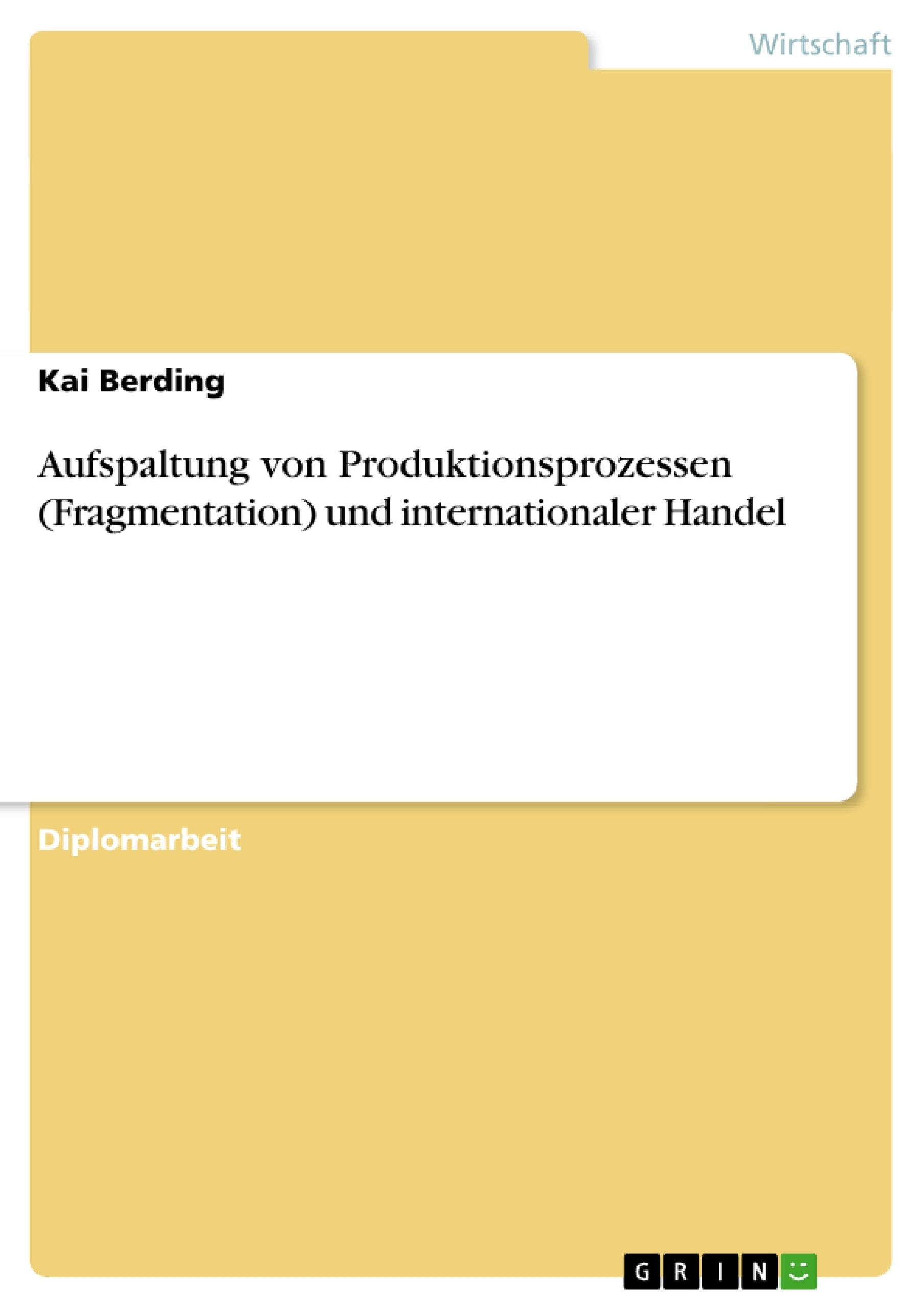Globalisierung ist heutzutage zu einem Schlagwort in den Medien geworden. Die aktuelle wissenschaftliche Diskussion spaltet die Globalisierung in zwei Teilbereiche. Einerseits wird hierbei die horizontale Globalisierung betrachtet, bei der die immer weiter steigende Bedeutung des Nord-Süd-Handels thematisiert wird (z.B. bei Davis (1998). Andererseits wird die vertikale Globalisierung untersucht, bei der es um die Zerlegung (Fragmentierung) von Produktionsprozessen über Landesgrenzen hinaus geht. Diese vertikale Globalisierung ist Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. Wie wichtig dieses Thema ist, zeigt sich in den Dimensionen, die diese vertikale Globalisierung heute angenommen hat. So hat der Handel mit Fragmenten bereits im Jahr 2000 einen Anteil von 30 % am Gesamthandelsvolumen erreicht. Die Entwicklung dieses Anteils ist hierbei weiterhin steigend. Besonders in den Medien der Industrieländer wird diese Form der Globalisierung hierbei keineswegs als rein positives Phänomen empfunden. Die hierbei oftmals angestellte, einfache Rechnung lautet: Wenn sich für die produ-zierenden Unternehmen eines Hochlohnlandes die Möglichkeit ergibt, die Waren auch in einem Land mit geringeren Löhnen zu produzieren, wird es diese Möglichkeit nutzen. Dem Hochlohnland bleiben nur zwei Möglichkeiten: Unterbeschäftigung oder eine drastische Senkung des Inlandslohnes. Beides führt in dieser einfachen Rechnung zu einer Wohlfahrtseinbuße für die Arbeitnehmer des betroffenen Landes und zeitgleich durch die Ausnutzung der niedrigeren Auslandslöhne zu Wohlstandszuwächsen bei den Kapitaleignern. Verschärfend kommt in dieser einfachen Betrachtung hinzu, dass die Nutznießer der Globalisierung große, multinationale Unternehmen sind, die ihre Wohlfahrt somit auf „dem Rücken des kleinen Mannes“ immer weiter steigern.
Ziel dieser Arbeit ist es , zu untersuchen, ob die sehr einfachen und auf den ersten Blick sehr logisch erscheinenden Annahmen auch wirklich zutreffend sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. FRAGMENTIERUNG IM FALLE EINES PRODUKTIONSFAKTORS
- 2.1. Ricardo-Modell in einer kleinen, offenen Volkswirtschaft
- 2.1.1. Ohne Fragmentierung
- 2.1.2. Mit Fragmentierung
- 2.2. Zwei Länder - Ricardo - Modell
- 3. FRAGMENTIERUNG IM FALLE ZWEIER HOMOGENER PRODUKTIONSFAKTOREN
- 3.1. Linear-limitationale Produktionsfunktionen
- 3.1.1. Einführung der Fragmentierung
- 3.1.2. Spezialisierung auf ein Fragment im Inland
- 3.1.3. Produktion beider Fragmente im Inland
- 3.1.4. Komplette Produktionsverlagerung des fragmentierten Gutes ins Ausland
- 3.2. Substitutionale Produktionsfunktionen
- 3.2.1. Das Heckscher-Ohlin-Modell in einer kleinen, offenen Volkswirtschaft
- 3.2.2. Zwei Länder – Heckscher - Ohlin – Modell
- 4. FRAGMENTIERUNG IM FALLE SEKTORSPEZIFISCHEN KAPITALS
- 4.1. Ohne Beschränkung der Aufteilung der Produktionsstandorte
- 4.1.1. Ohne Outsourcing
- 4.1.2. Mit Outsourcing
- 4.2. Bei Beschränkung der Aufteilung der Produktionsstandorte
- 4.2.1. Der Ein – Firmen – Fall
- 4.2.2. Der Mehr-Firmen-Fall
- 4.2.2.1. Der kritische Lohnanstieg
- 4.2.2.2. Die Lohnänderungsraten
- 4.2.2.3. Gleichgewichtsbetrachtungen
- 4.2.3. Auswirkungen verschiedener Faktoren auf die Wohlfahrt
- 5. ZUSAMMENFASSUNG UND GESAMTÜBERBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Aufspaltung von Produktionsprozessen (Fragmentation) und deren Auswirkungen auf den internationalen Handel. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Facetten der Fragmentierung in unterschiedlichen Modellrahmen, indem sie sowohl den Fall eines einzelnen Produktionsfaktors als auch den Fall mehrerer Produktionsfaktoren betrachtet.
- Die Auswirkungen der Fragmentierung auf die Produktionsstruktur und die Wohlfahrt in kleinen, offenen Volkswirtschaften.
- Die Rolle von Faktormobilität und Faktorpreisen bei der Fragmentierung und der internationalen Arbeitsteilung.
- Die Analyse von Outsourcing und der Auswirkungen auf die Lohnstruktur und das Beschäftigungniveau.
- Die Untersuchung der Bedeutung sektorspezifischen Kapitals für die Fragmentierung und die internationale Spezialisierung.
- Die Entwicklung von Gleichgewichtsmodellen, die die Fragmentierung und die Interaktionen zwischen inländischen und ausländischen Unternehmen berücksichtigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 analysiert die Fragmentierung im Fall eines Produktionsfaktors, wobei das Ricardo-Modell als Ausgangspunkt dient. Es werden verschiedene Szenarien betrachtet, unter anderem die Fragmentierung in einer kleinen, offenen Volkswirtschaft und die Fragmentierung in einem Zwei-Länder-Modell.
Kapitel 3 erweitert die Analyse auf den Fall von zwei homogenen Produktionsfaktoren. Es werden sowohl linear-limitationale als auch substitutionale Produktionsfunktionen betrachtet. Im Fall linear-limitationaler Produktionsfunktionen werden verschiedene Szenarien untersucht, wie z.B. die Spezialisierung auf ein Fragment im Inland, die Produktion beider Fragmente im Inland und die vollständige Produktionsverlagerung des fragmentierten Gutes ins Ausland.
Kapitel 4 untersucht die Fragmentierung im Fall sektorspezifischen Kapitals. Es werden verschiedene Szenarien betrachtet, unter anderem die Fragmentierung ohne und mit Outsourcing, wobei sowohl der Fall einer Beschränkung der Aufteilung der Produktionsstandorte als auch der Fall ohne Beschränkung analysiert wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen internationale Fragmentierung, Außenhandel, Produktionsfaktoren, Produktionsfunktionen, Ricardo-Modell, Heckscher-Ohlin-Modell, Outsourcing, sektorspezifisches Kapital, Wohlfahrt, Gleichgewicht, Lohnstruktur, Beschäftigung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Fragmentierung von Produktionsprozessen?
Fragmentierung bezeichnet die Zerlegung eines Produktionsprozesses in einzelne Segmente (Fragmente), die an verschiedenen Standorten weltweit durchgeführt werden können.
Was ist der Unterschied zwischen horizontaler und vertikaler Globalisierung?
Horizontale Globalisierung fokussiert auf den Handel mit Endprodukten, während vertikale Globalisierung die Aufspaltung der Wertschöpfungskette über Landesgrenzen hinweg beschreibt.
Welche Auswirkungen hat Outsourcing auf die Löhne in Hochlohnländern?
Die Arbeit untersucht die These, ob Outsourcing zwingend zu Lohnsenkungen oder Unterbeschäftigung führt oder ob Spezialisierungsgewinne diese Effekte ausgleichen können.
Wie wird Fragmentierung im Ricardo-Modell analysiert?
Im Ricardo-Modell wird untersucht, wie sich die internationale Arbeitsteilung ändert, wenn nicht nur ganze Güter, sondern einzelne Produktionsschritte gehandelt werden.
Führt Fragmentierung immer zu einer Wohlfahrtssteigerung?
Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle, um zu zeigen, unter welchen Bedingungen Fragmentierung den Wohlstand steigert und wer die potenziellen Verlierer dieses Prozesses sind.
- Arbeit zitieren
- Diplom Kaufmann Kai Berding (Autor:in), 2007, Aufspaltung von Produktionsprozessen (Fragmentation) und internationaler Handel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80201