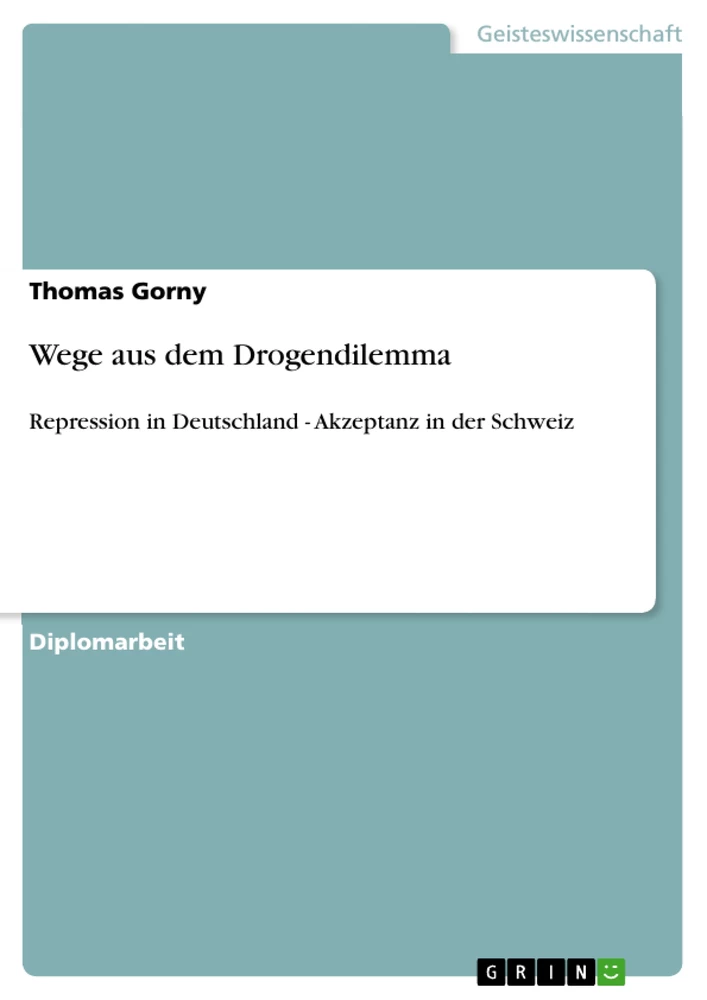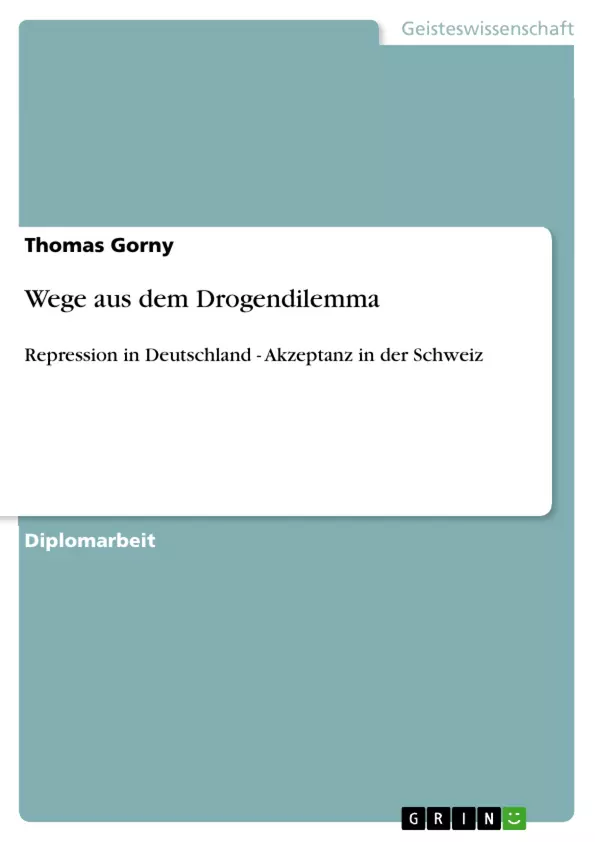Diese Diplomarbeit tangiert relativ viele Bereiche, die zwar alle in irgendeiner Form mit Drogen zu tun haben, aber vielleicht nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen. So geht es im Inhalt nicht nur um eine gegenwärtige Situationsanalyse in der BRD und eine weitere Forderung nach „Akzeptierender Drogenarbeit/politik“.
Für mich selbst war es notwendig, meinen Wissensstand zu Methadonvergabe und Therapie in Deutschland etwas aufzufrischen, aber auch die Frage nach dem Erfolg und Nutzen von solchen Hilfsangeboten in einer abstinenzorientierten Drogenarbeit/politik zu stellen. Geschichtliche Hintergründe spielen dabei auch eine Rolle, mehr als ursprünglich geplant. Speziell hierzu gibt es aber weitaus detaillierter abgefaßte Diplomarbeiten und Literatur als diese Diplomarbeit.
Die von mir sehr geschätzten Musiker Jimi Hendrix und Jim Morrison finden genauso ihre Erwähnung, wie die Möglichkeit der Schmerztherapie mit Opioiden. Diese beiden Themen wurden im Laufe der Entstehung dieser Arbeit plötzlich wichtig und finden als sogenannte Einschübe ihren Platz.
Da sich das Kapitel „Das Zürcher Modell. Vorbild für Deutschland?“ überwiegend auf die Erfahrungsberichte des Projektes „Lifeline“ stützt, war es auch nötig, einen Einschub über das politische System der Schweiz zu machen, besonders wegen der Volksinitiative „Jugend ohne Drogen“ die am 28.09.1997 von der Mehrheit des Schweizer Stimmvolkes abgelehnt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Drogengebrauch in den vergangenen Jahrzehnten
- Historischer Hintergrund des Opiatgebrauchs im deutschen Raum
- Die sechziger Jahre - Renaissance des illegalen Drogengebrauchs
- Einschub: Tote Musiker - lebendige Kulte - falsche Mythen
- Die Jahre 1970 - 1974: Die „Harte Szene“ entwickelt sich
- Hilfsysteme in der abstinenzorientierten Drogenhilfe
- Die Rolle der Therapeuten
- Substitution - Opiatverschreibung und die Rolle der Mediziner
- Einschub: Schmerztherapie mit Opioiden
- Gründe, warum sich Menschen trotz alledem für den Gebrauch harter Drogen entscheiden
- Der materielle Reiz des Lebens als Dealer
- Fixer/Dealersein als Lebensstil
- Soziale Komponenten des Fixerdaseins
- Kritik an der traditionellen Sichtweise von Opiatsucht und ihrer Bekämpfung
- Gründe für zunehmende Kritik
- Unterschiedliche Sucht- und Abhängigkeitsdefinitionen
- Sucht als Bestandteil der Gesellschaft
- Substanz- oder stoffgebundene Süchte
- Prozess- oder stoffungebundene Süchte
- Gefördert, geduldet, abgelehnt. Vom unterschiedlichen Umgang mit ähnlichen und gleichen Suchtphänomenen
- Traditionelles Suchtverständnis - Erweitertes Sucht-verständnis. Eine Gegenüberstellung aus „Zürcher Sicht“
- Die traditionelle Problemdefinition (Sucht als Krankheit)
- Die erweiterte Problemdefinition (Der Mensch in einer Krise)
- Das Zürcher Modell. Vorbild für Deutschland?
- Veränderte Politik - veränderte Meinungen
- Die Initiative „Jugend ohne Drogen“
- Initianten und Ziel der Initiative
- Ergebnisse der Volksabstimmung am 28.09.1997
- Analyse im Spiegel der Zürcher Presse
- Die vierte Säule der Drogenpolitik in der Schweiz: Die Überlebenshilfe
- Kurzer historischer Abriß über die Drogenproblematik in Zürich
- Der Urknall für Fixerstuben: Das Autonome Jugendzentrum am Anfang der achtziger Jahre
- Der Needle-Park: Platzspitz ab 1986
- Der Letten ab 1992
- Was ist unter der Überlebenshilfe im Einzelnen zu verstehen?
- Ziele; Zielgruppen
- Einrichtungen
- Die Kontakt- und Anlaufstellen (K.& A.) und Gassenzimmer
- Das Angebot einer Kontakt- und Anlaufstelle
- Cafeteria
- Hygienische und sanitäre Einrichtungen
- Einfache medizinische Grundversorgung
- Beschäftigung
- Beratung, Vermittlung, Sachhilfe, Betreuung
- Die Gassenzimmer
- Konzeption
- Der Aspekt der ärztlichen Betreuung in Gassenzimmern
- Einige statistische Zahlen über den Betrieb
- Sozialarbeit in einer K.& A.
- Das Projekt Lifeline/Crossline. Die Heroinabgabe in Zürich
- Auszüge aus den Erfahrungen der Pilotphase 01.12.1993 - 31.12.1996
- Niederschwelligkeit
- Arbeitshypothesen
- Zielgruppen
- Abgabemodalitäten
- Betreuungskonzept
- Substanzen
- Die Auswirkungen auf die Teilnehmer
- Gesundheitlicher Bereich
- Psychischer Bereich
- Psychosoziale Situation und Betreuung
- Heroinvergabe - Abstinenz - Entzug
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Umgang mit Drogen in Deutschland und der Schweiz, wobei ein besonderer Fokus auf die unterschiedlichen Strategien der Repression (Deutschland) und Akzeptanz (Schweiz) gelegt wird. Die Arbeit beleuchtet historische Entwicklungen im Drogenkonsum, analysiert verschiedene Suchtdefinitionen und bewertet unterschiedliche Ansätze der Drogenhilfe.
- Historische Entwicklung des Drogenkonsums in Deutschland
- Vergleichende Analyse der Drogenpolitik in Deutschland und der Schweiz
- Bewertung verschiedener Strategien der Drogenhilfe (abstinenzorientiert vs. substitutionsorientiert)
- Analyse des Zürcher Modells und seiner Übertragbarkeit auf Deutschland
- Untersuchung unterschiedlicher Suchtdefinitionen und -verständnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Drogengebrauch in den vergangenen Jahrzehnten: Dieses Kapitel liefert einen historischen Überblick über den Drogenkonsum, insbesondere den Opiatgebrauch, in Deutschland. Es beleuchtet die Entwicklung vom historischen Hintergrund bis hin zur "harten Szene" der 1970er Jahre, inklusive sozialer und kultureller Faktoren, die den Drogenkonsum beeinflusst haben. Der Fokus liegt auf dem Wandel im Drogenkonsum und den gesellschaftlichen Reaktionen darauf.
Hilfsysteme in der abstinenzorientierten Drogenhilfe: Dieses Kapitel beschreibt die traditionellen Ansätze der Drogenhilfe in Deutschland, die stark auf Abstinenz ausgerichtet sind. Es analysiert die Rolle von Therapeuten und die Debatte um die Methadon-Substitution. Der Text hinterfragt die Effektivität dieser abstinenzorientierten Ansätze im Kontext der gesellschaftlichen Realität des Drogenkonsums.
Gründe, warum sich Menschen trotz alledem für den Gebrauch harter Drogen entscheiden: Dieser Abschnitt untersucht die Motive hinter dem Drogenkonsum, geht über die reine Suchtproblematik hinaus und betrachtet die sozialen und ökonomischen Aspekte, die Menschen in den Drogenkonsum und Dealertum treiben. Es werden sowohl materielle Anreize als auch den Lebensstil als Fixer/Dealer umfassend beleuchtet.
Kritik an der traditionellen Sichtweise von Opiatsucht und ihrer Bekämpfung: Das Kapitel kritisiert die traditionellen Ansätze der Drogenbekämpfung und legt die Gründe für die zunehmende Kritik dar. Es bereitet den Wechsel zum erweiterten Suchtverständnis vor, das im folgenden Kapitel näher erläutert wird.
Unterschiedliche Sucht- und Abhängigkeitsdefinitionen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen von Sucht, sowohl stoffgebunden als auch stoffungebunden. Es vergleicht verschiedene gesellschaftliche Reaktionen auf verschiedene Suchtformen und bereitet die Diskussion über das Zürcher Modell vor.
Traditionelles Suchtverständnis - Erweitertes Sucht-verständnis. Eine Gegenüberstellung aus „Zürcher Sicht“: Im Zentrum dieses Kapitels steht der Vergleich zwischen dem traditionellen Verständnis von Sucht als Krankheit und dem erweiterten Verständnis, das den Menschen in seiner Krise sieht. Diese Gegenüberstellung dient als Brücke zum Zürcher Modell.
Das Zürcher Modell. Vorbild für Deutschland?: Dieses Kapitel stellt das Zürcher Modell der Drogenpolitik vor und analysiert dessen Implikationen für Deutschland. Es berücksichtigt die politischen und gesellschaftlichen Kontexte und bewertet die Ergebnisse der Volksinitiative "Jugend ohne Drogen".
Die vierte Säule der Drogenpolitik in der Schweiz: Die Überlebenshilfe: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Konzept der Überlebenshilfe in der Schweizer Drogenpolitik. Es skizziert die historische Entwicklung, beschreibt die konkreten Maßnahmen und beleuchtet Ziele und Zielgruppen dieser Politik.
Die Kontakt- und Anlaufstellen (K.& A.) und Gassenzimmer: Das Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung der Überlebenshilfe durch Kontakt- und Anlaufstellen und Gassenzimmer. Es geht detailliert auf das Angebot dieser Einrichtungen ein, von der medizinischen Versorgung bis hin zur sozialen Betreuung.
Das Projekt Lifeline/Crossline. Die Heroinabgabe in Zürich: Dieses Kapitel analysiert das Pilotprojekt Lifeline/Crossline zur Heroinabgabe in Zürich. Es bewertet die Ergebnisse der Pilotphase und geht auf die Auswirkungen auf die Teilnehmer ein, sowohl im gesundheitlichen als auch im psychosozialen Bereich.
Schlüsselwörter
Drogenpolitik, Drogenkonsum, Abhängigkeit, Sucht, Repression, Akzeptanz, Abstinenz, Substitution, Methadon, Zürcher Modell, Überlebenshilfe, Kontakt- und Anlaufstellen, Gassenzimmer, Heroinabgabe, Deutschland, Schweiz, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Drogenpolitik im Vergleich - Deutschland und die Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Umgang mit Drogen in Deutschland und der Schweiz, wobei ein besonderer Fokus auf die unterschiedlichen Strategien der Repression (Deutschland) und Akzeptanz (Schweiz) gelegt wird. Es werden historische Entwicklungen im Drogenkonsum beleuchtet, verschiedene Suchtdefinitionen analysiert und unterschiedliche Ansätze der Drogenhilfe bewertet. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Zürcher Modell und seiner Übertragbarkeit auf Deutschland.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die historische Entwicklung des Drogenkonsums in Deutschland, einen Vergleich der Drogenpolitik in Deutschland und der Schweiz, die Bewertung verschiedener Strategien der Drogenhilfe (abstinenzorientiert vs. substitutionsorientiert), eine Analyse des Zürcher Modells und seine Übertragbarkeit auf Deutschland sowie eine Untersuchung unterschiedlicher Suchtdefinitionen und -verständnisse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich mit dem Drogengebrauch der vergangenen Jahrzehnte, Hilfesystemen in der abstinenzorientierten Drogenhilfe, den Gründen für den Drogenkonsum, der Kritik an traditionellen Sichtweisen, unterschiedlichen Suchtdefinitionen, dem traditionellen und erweiterten Suchtverständnis, dem Zürcher Modell, der Überlebenshilfe in der Schweiz, Kontakt- und Anlaufstellen, Gassenzimmern und dem Projekt Lifeline/Crossline befassen. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche historischen Entwicklungen des Drogenkonsums werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Hintergrund des Opiatgebrauchs im deutschen Raum, die Renaissance des illegalen Drogengebrauchs in den 1960er Jahren, die Entwicklung der „harten Szene“ in den Jahren 1970-1974 und den Wandel im Drogenkonsum und die gesellschaftlichen Reaktionen darauf.
Welche Ansätze der Drogenhilfe werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht abstinenzorientierte und substitutionsorientierte Ansätze der Drogenhilfe. Die Rolle von Therapeuten und die Debatte um die Methadon-Substitution werden analysiert. Die Effektivität der abstinenzorientierten Ansätze wird im Kontext der gesellschaftlichen Realität des Drogenkonsums hinterfragt.
Was ist das Zürcher Modell und warum ist es relevant?
Das Zürcher Modell der Drogenpolitik wird vorgestellt und seine Implikationen für Deutschland analysiert. Es werden die politischen und gesellschaftlichen Kontexte berücksichtigt und die Ergebnisse der Volksinitiative "Jugend ohne Drogen" bewertet. Das Modell beinhaltet unter anderem die Überlebenshilfe mit Kontakt- und Anlaufstellen, Gassenzimmern und dem Projekt Lifeline/Crossline zur Heroinabgabe.
Was beinhaltet die Überlebenshilfe im Zürcher Modell?
Die Überlebenshilfe umfasst Maßnahmen wie Kontakt- und Anlaufstellen (K.&A.), Gassenzimmer und das Projekt Lifeline/Crossline zur Heroinabgabe. Es geht darum, Drogenkonsumenten ein niederschwelliges Angebot an medizinischer Versorgung, sozialer Betreuung und Unterstützung zu bieten, um ihre Überlebenschancen zu verbessern und die Ausbreitung von Krankheiten zu minimieren.
Was sind Kontakt- und Anlaufstellen (K.&A.) und Gassenzimmer?
Kontakt- und Anlaufstellen bieten niederschwellige Unterstützung für Drogenkonsumenten, inklusive medizinischer Grundversorgung, Beratung und sozialer Betreuung. Gassenzimmer ermöglichen Konsum unter hygienischen Bedingungen und medizinischer Aufsicht.
Was ist das Projekt Lifeline/Crossline?
Lifeline/Crossline war ein Pilotprojekt zur kontrollierten Heroinabgabe in Zürich. Die Arbeit analysiert die Ergebnisse dieses Projekts hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gesundheit, die psychische Situation und die psychosoziale Betreuung der Teilnehmer.
Welche unterschiedlichen Suchtdefinitionen werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert unterschiedliche Suchtdefinitionen, sowohl stoffgebunden als auch stoffungebunden, und vergleicht gesellschaftliche Reaktionen auf verschiedene Suchtformen. Der Vergleich zwischen dem traditionellen Verständnis von Sucht als Krankheit und dem erweiterten Verständnis, das den Menschen in seiner Krise sieht, spielt eine zentrale Rolle.
- Arbeit zitieren
- Thomas Gorny (Autor:in), 1998, Wege aus dem Drogendilemma, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80205