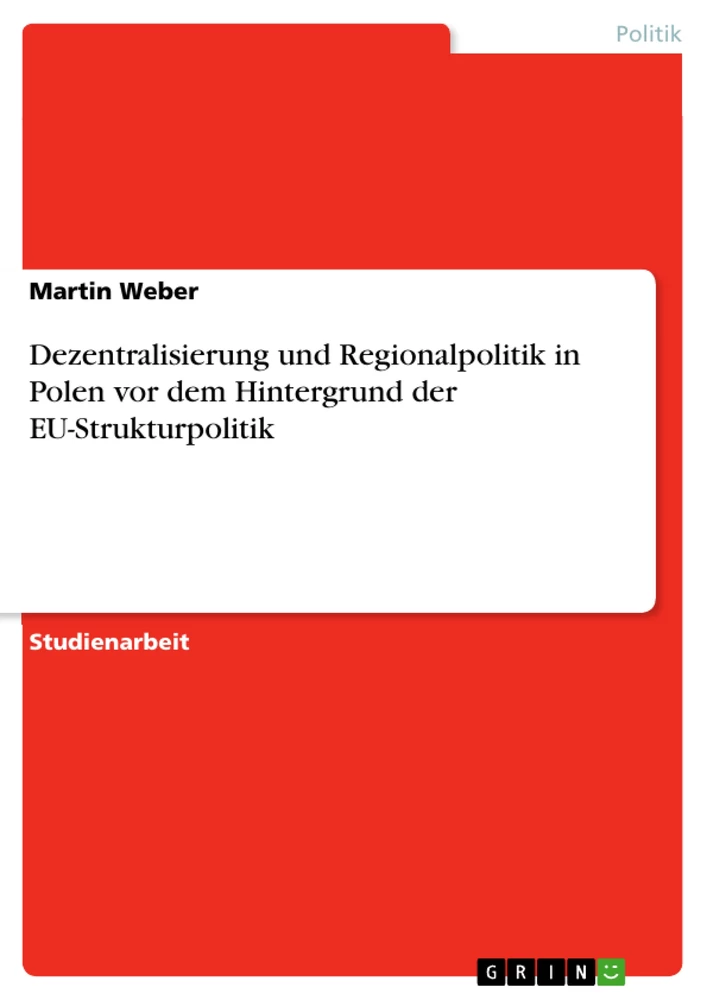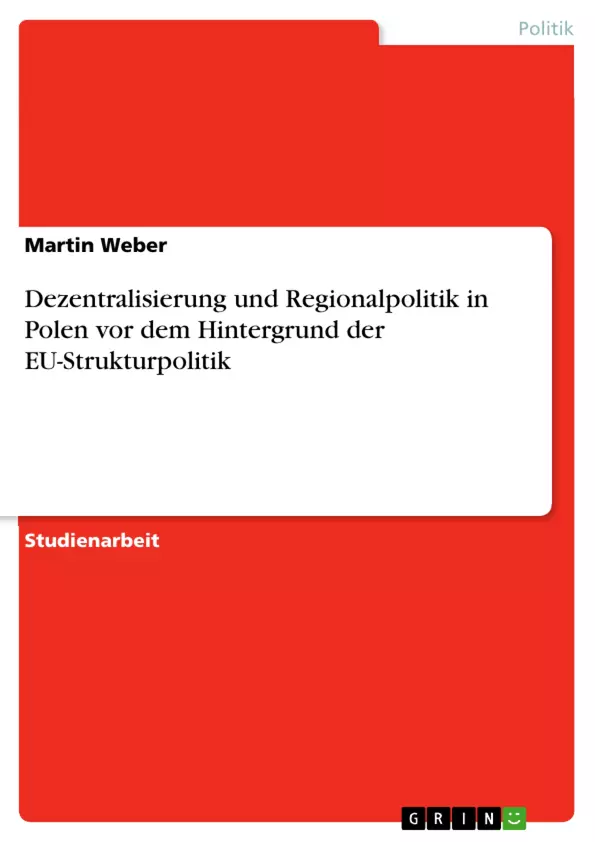Die eigentliche Herausforderung der kürzlich erfolgten Erweiterung der EU besteht laut Pedersen und Johannsen darin, die Etablierung einer effizienten öffentlichen Verwaltung weiter voranzutreiben, die in der Lage ist, den gemeinschaftlichen Besitzstand der EU, den acquis communautaire, zu implementieren. Denn:
„Considering the regulatory character of the EU, this means that if EU-legislation is not translated into concrete change at the national level, the whole idea of European integration and common policies fails.“
Teilaspekte dieses konkreten Wandels beschreibt die Kommission im letzten Bericht über die Vorbereitungen Polens auf den am 1. Mai 2004 erfolgten Beitritt zur Europäischen Union (EU) folgendermaßen: „Polen hat sich für die territoriale Gliederung mit der Kommission auf eine NUTS-Klassifizierung verständigt.“ Hinter dieser einfachen Feststellung verbirgt sich jedoch ein seit 1989 andauernder und in Teilen äußerst kontrovers diskutierter Prozess der Dezentralisierung und der Reform lokaler und regionaler Selbstverwaltung in Polen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht einerseits darin, diesen Reformprozess nachzuzeichnen. Dabei soll insbesondere betrachtet werden, wie die Aussicht auf die Transferleistungen im Rahmen der Strukturpolitik diesen Prozess beeinflusst hat. Dazu werde ich zunächst kurz auf die EU-Strukturpolitik generell eingehen, um deren Prinzipien und die wichtigsten Begriffe vorzustellen. Daran anschließend werden die Reorganisation der lokalen und regionalen Selbstverwaltung in Polen sowie die seit 1989 in diesem Land durchgeführten Hilfsprogramme der EU dargestellt. Unter Rückgriff auf die Erfahrungen mit den Vorbeitrittshilfen, werde ich dann zu einer Einschätzung übergehen, welche Umstände die erhofften positiven Wirkungen der EU-Strukturpolitik in Polen möglicherweise einschränken oder gar verhindern können.
Eine ausführliche Darlegung der Diskussion um die generelle ökonomische Wirksamkeit der EU-Strukturpolitik soll in diesem Rahmen nicht erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundzüge der EU-Strukturpolitik
- 3. Die Europäisierung lokaler und regionaler Selbstverwaltung in Polen
- 3.1 Die erste Reformphase
- 3.2 Die zweite Reformphase
- 4. Die EU-Strukturpolitik in Polen - Erfahrungen und Prognosen
- 5. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Prozess der Dezentralisierung und der Reform der lokalen und regionalen Selbstverwaltung in Polen vor dem Hintergrund der EU-Strukturpolitik. Sie untersucht, wie die Aussicht auf Transferleistungen im Rahmen der Strukturpolitik diesen Prozess beeinflusst hat. Dabei wird zunächst ein Überblick über die Prinzipien der EU-Strukturpolitik gegeben. Anschließend werden die Reorganisation der lokalen und regionalen Selbstverwaltung in Polen und die seit 1989 durchgeführten Hilfsprogramme der EU dargestellt. Die Arbeit befasst sich mit der Einschätzung, welche Umstände die erhofften positiven Wirkungen der EU-Strukturpolitik in Polen möglicherweise einschränken oder verhindern können.
- Die Reformphase der lokalen und regionalen Selbstverwaltung in Polen
- Der Einfluss der EU-Strukturpolitik auf die Dezentralisierung
- Die Prinzipien und Ziele der EU-Strukturpolitik
- Die Erfahrungen mit den Vorbeitrittshilfen in Polen
- Mögliche Einschränkungen der Wirksamkeit der EU-Strukturpolitik in Polen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel stellt die aktuelle Herausforderung der EU-Erweiterung vor, insbesondere die Etablierung einer effizienten öffentlichen Verwaltung zur Implementierung des "acquis communautaire". Es skizziert den Reformprozess der Dezentralisierung in Polen und das Ziel der Arbeit, diesen Prozess nachzuzeichnen und den Einfluss der EU-Strukturpolitik darauf zu analysieren.
- Kapitel 2: Grundzüge der EU-Strukturpolitik: Dieses Kapitel erklärt die "EU-Strukturpolitik" als regionale Wirtschaftspolitik der EU, die auf die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes in der EU zielt. Es beschreibt die verschiedenen Strukturfonds und deren Koordinierung im Rahmen einer mehrjährigen Förderperiode. Es werden die Ziele der Strukturpolitik und die wichtigsten Prinzipien wie Additionalität, Komplementarität und Kofinanzierung erläutert.
- Kapitel 3: Die Europäisierung lokaler und regionaler Selbstverwaltung in Polen: Dieses Kapitel beleuchtet den Prozess der Dezentralisierung in Polen, der in zwei Reformphasen gegliedert ist. Es analysiert die Auswirkungen der EU-Strukturpolitik auf die Reformen und untersucht, inwieweit die territoriale Gliederung und die Verwaltungsebene der NUTS-2-Regionen im Kontext der Strukturpolitik relevant sind.
- Kapitel 4: Die EU-Strukturpolitik in Polen - Erfahrungen und Prognosen: Dieses Kapitel diskutiert die Erfahrungen mit den Vorbeitrittshilfen der EU in Polen und geht auf mögliche Einschränkungen der erhofften positiven Effekte der EU-Strukturpolitik ein. Es analysiert die Verwaltung der Strukturfonds durch die Mitgliedsstaaten und betrachtet die Rolle der Regionen bei der Programmierung und Umsetzung der Strukturfonds-Projekte.
Schlüsselwörter
Dezentralisierung, Regionalpolitik, EU-Strukturpolitik, Polen, Europäische Union, lokale und regionale Selbstverwaltung, Vorbeitrittshilfen, NUTS-Klassifizierung, Strukturfonds, Additionalität, Komplementarität, Kofinanzierung, Verwaltung, Programmierung, Management, Erfahrungen, Prognosen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit über Dezentralisierung in Polen?
Das Ziel besteht darin, den Reformprozess der lokalen und regionalen Selbstverwaltung in Polen seit 1989 nachzuzeichnen und zu analysieren, wie die Aussicht auf EU-Strukturfondsmittel diesen Prozess beeinflusst hat.
Was bedeutet der Begriff "acquis communautaire" im Kontext Polens?
Es handelt sich um den gemeinschaftlichen Besitzstand der EU. Die Herausforderung für Polen bestand darin, eine effiziente Verwaltung aufzubauen, die in der Lage ist, diese EU-Gesetzgebung auf nationaler Ebene zu implementieren.
Welche Rolle spielt die NUTS-Klassifizierung für die polnische Regionalpolitik?
Die NUTS-Klassifizierung ist eine territoriale Gliederung, auf die sich Polen mit der EU-Kommission verständigt hat. Besonders die NUTS-2-Ebene ist für die Programmierung und Umsetzung der EU-Strukturpolitik von zentraler Bedeutung.
Was sind die wichtigsten Prinzipien der EU-Strukturpolitik?
Die Arbeit erläutert zentrale Prinzipien wie Additionalität (Zusätzlichkeit), Komplementarität (Ergänzung) und Kofinanzierung (gemeinsame Finanzierung durch EU und Mitgliedstaat).
Welche Faktoren könnten die positiven Wirkungen der EU-Strukturpolitik in Polen einschränken?
Einschränkungen können durch administrative Hürden, Probleme bei der Verwaltung der Strukturfonds auf regionaler Ebene oder mangelnde Erfahrungen bei der Umsetzung von Projekten entstehen.
Wie viele Reformphasen der Selbstverwaltung gab es in Polen?
Die Arbeit gliedert den Prozess der Dezentralisierung in zwei wesentliche Reformphasen, die die lokale und regionale Selbstverwaltung nachhaltig verändert haben.
- Arbeit zitieren
- Martin Weber (Autor:in), 2004, Dezentralisierung und Regionalpolitik in Polen vor dem Hintergrund der EU-Strukturpolitik , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80236