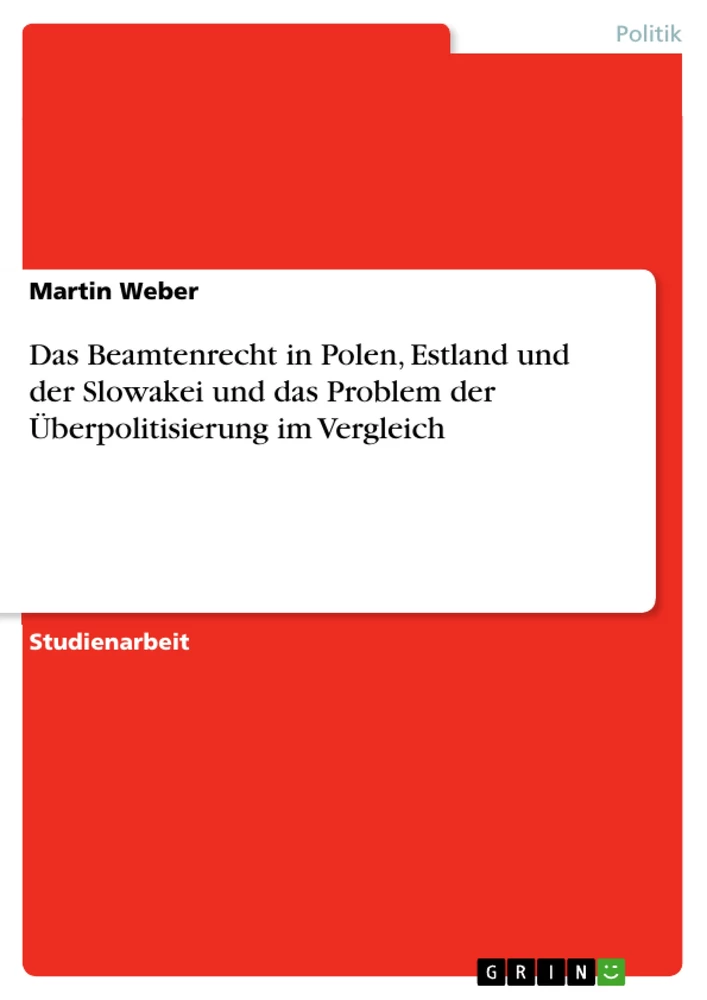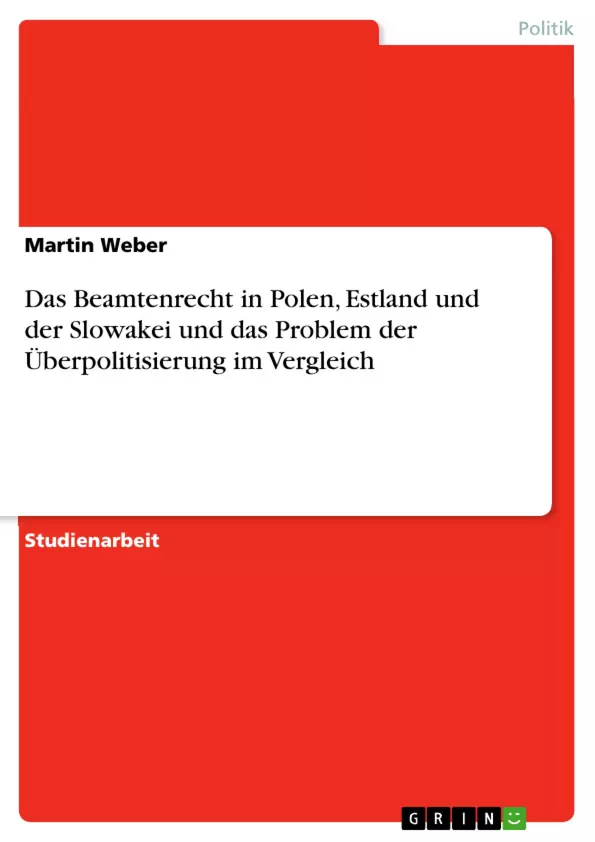Negative Folgen häufiger politisch motivierter Personalwechsel in der öffentlichen Verwaltung sind Instabilität des Regierungshandelns und mangelnde Professionalität. Dies ist in den mittel- und osteuropäischen Staaten besonders problematisch, weil dort die Anforderungen an die öffentliche Verwaltung transformationsbedingt immens hoch waren und sind. Erfahrenes, professionelles Personal ist also dringend nötig, um die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu erhöhen, was nicht zuletzt im Hinblick auf das EU-Beitrittskriterium der „institutionellen Stabilität“ eine wesentliche Rolle spielte.
Polen, Estland und die Slowakei eignen sich für einen Vergleich besonders gut, weil sie einerseits sehr ähnliche Voraussetzungen mitbringen. Zunächst teilen sie die Erfahrung des real existierenden Sozialismus und die Alleinherrschaft der kommunistischen Partei. Sie haben also nicht nur sehr ähnliche Erfahrungen in Bezug auf die Verwaltung im sozialistischen Staat und die damit verbundene Personalpolitik, sondern auch hinsichtlich der nach dem Regimewechsel zu bewältigenden Aufgaben. Aus dieser Warte ist ihre Ausgangsposition nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus prinzipiell gleich. Auf der anderen Seite weisen sie aber auch beträchtliche Unterschiede auf. So unterscheiden sie sich stark in ihrer Größe. Auch in Bezug auf die staatliche Geschichte und Traditionen im Beamtenrecht vor dem Zweiten Weltkrieg sind erhebliche Unterschiede auszumachen. Darüber hinaus blieb allein Polen nach dem Regimewechsel als Nation bestehen und verfügte 1989/90 so über alle Attribute souveräner Staatlichkeit, während Estland diese vollkommen und die Slowakei zumindest teilweise neu aufbauen musste.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Entwicklung des Beamtenrechts vor dem Hintergrund dieser Besonderheiten nachzuzeichnen und zu vergleichen. Dazu werde ich nach der Definition einiger zentraler Begriffe (2) zunächst generell auf die Bedeutung der öffentlichen Verwaltung, die Probleme zwischen Bürokratie und Politik sowie auf die besonderen Voraussetzungen in den drei zu untersuchenden Ländern eingehen (Punkt 3). Nach einer kurzen Darstellung des Regimewandels (4), folgt die ausführliche Entwicklung und Bewertung des Beamtenrechts in Polen, Estland und der Slowakei.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Beamte, Überpolitisierung und Modelle für den Staatsdienst
- 3. Die Prinzipal-Agent-Beziehung zwischen politischer Führung und Beamten
- 4. Transformation in Polen, Estland und der Slowakei
- 5. Die Entwicklung des Beamtenrechts in Polen, Estland und der Slowakei
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Beamtenrechts in Polen, Estland und der Slowakei nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Entwicklungen vor dem Hintergrund ähnlicher Ausgangsbedingungen (Sozialismus) und gleichzeitig erheblicher Unterschiede (Größe, Geschichte, Staatsaufbau). Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der Überpolitisierung des Staatsdienstes und die unterschiedlichen Modelle des Beamtenrechts.
- Entwicklung des Beamtenrechts in Polen, Estland und der Slowakei
- Das Problem der Überpolitisierung des Staatsdienstes
- Vergleich verschiedener Modelle des Beamtenrechts (Laufbahnmodell vs. Positionsmodell)
- Einfluss des Regimewandels auf die öffentliche Verwaltung
- Die Prinzipal-Agent-Beziehung zwischen politischer Führung und Beamten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem der Politisierung des Staatsdienstes in mittel- und osteuropäischen Ländern dar, wobei die Untersuchung auf Polen, Estland und die Slowakei fokussiert. Sie betont die Notwendigkeit erfahrenen Personals für eine funktionierende öffentliche Verwaltung und die Relevanz im Hinblick auf den EU-Beitritt. Die Länder werden als vergleichbar (Erfahrung mit Sozialismus) und gleichzeitig unterschiedlich (Größe, Geschichte) dargestellt. Das Ziel der Arbeit ist die Nachzeichnung und der Vergleich der Entwicklung des Beamtenrechts in diesen drei Ländern.
2. Beamte, Überpolitisierung und Modelle für den Staatsdienst: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Beamter" und differenziert zwischen den Begriffen "Politisierung" der öffentlichen Verwaltung. Es unterscheidet drei Dimensionen der Politisierung: die Mitwirkung an politischen Entscheidungen, das Auftreten der Beamtenschaft als politische Kraft und politisch motivierte Personalentscheidungen. Es wird argumentiert, dass Politisierung nur dann problematisch wird, wenn die Professionalität gefährdet ist. Das Kapitel vergleicht das Weber'sche Bürokratiemodell (Laufbahnmodell) mit dem Positionsmodell, wobei die Unterschiede in Bezug auf Arbeitsverhältnisse, Bezahlung und Karrierewege hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Beamtenrecht, Polen, Estland, Slowakei, Überpolitisierung, Staatsdienst, Transformation, Regimewandel, Weber'sche Bürokratie, Laufbahnmodell, Positionsmodell, Prinzipal-Agent-Beziehung, öffentliche Verwaltung, mittel- und osteuropäische Länder, EU-Beitritt.
FAQ: Entwicklung des Beamtenrechts in Polen, Estland und der Slowakei
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Beamtenrechts in Polen, Estland und der Slowakei nach dem Fall des Sozialismus. Der Fokus liegt auf einem Vergleich der Entwicklungen vor dem Hintergrund ähnlicher Ausgangsbedingungen (Sozialismus) und gleichzeitig erheblicher Unterschiede (Größe, Geschichte, Staatsaufbau). Die Arbeit analysiert insbesondere die Herausforderungen der Überpolitisierung des Staatsdienstes und die unterschiedlichen Modelle des Beamtenrechts.
Welche Länder werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf Polen, Estland und die Slowakei.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Entwicklung des Beamtenrechts in den drei untersuchten Ländern, das Problem der Überpolitisierung des Staatsdienstes, ein Vergleich verschiedener Modelle des Beamtenrechts (Laufbahnmodell vs. Positionsmodell), der Einfluss des Regimewandels auf die öffentliche Verwaltung und die Prinzipal-Agent-Beziehung zwischen politischer Führung und Beamten.
Was versteht man unter Überpolitisierung des Staatsdienstes?
Die Arbeit unterscheidet drei Dimensionen der Politisierung: Mitwirkung an politischen Entscheidungen, das Auftreten der Beamtenschaft als politische Kraft und politisch motivierte Personalentscheidungen. Überpolitisierung wird als problematisch angesehen, wenn die Professionalität des Staatsdienstes gefährdet ist.
Welche Modelle des Beamtenrechts werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das Weber'sche Bürokratiemodell (Laufbahnmodell) mit dem Positionsmodell. Die Unterschiede betreffen Arbeitsverhältnisse, Bezahlung und Karrierewege.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Beamten, Überpolitisierung und Modellen für den Staatsdienst, die Prinzipal-Agent-Beziehung, die Transformation in den drei Ländern, die Entwicklung des Beamtenrechts in diesen Ländern und schließlich ein Schluss-Kapitel.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Beamtenrecht, Polen, Estland, Slowakei, Überpolitisierung, Staatsdienst, Transformation, Regimewandel, Weber'sche Bürokratie, Laufbahnmodell, Positionsmodell, Prinzipal-Agent-Beziehung, öffentliche Verwaltung, mittel- und osteuropäische Länder, EU-Beitritt.
Welches ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Beamtenrechts in Polen, Estland und der Slowakei nachzuzeichnen und zu vergleichen. Die Relevanz wird im Hinblick auf den EU-Beitritt und die Notwendigkeit erfahrenen Personals für eine funktionierende öffentliche Verwaltung betont.
Wie werden die untersuchten Länder verglichen?
Die Länder werden als vergleichbar (Erfahrung mit Sozialismus) und gleichzeitig unterschiedlich (Größe, Geschichte, Staatsaufbau) dargestellt.
Wo finde ich eine detailliertere Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Eine detailliertere Zusammenfassung der einzelnen Kapitel ist im Inhaltsverzeichnis und den Kapitelabschnitten der vollständigen Arbeit enthalten.
- Arbeit zitieren
- Martin Weber (Autor:in), 2005, Das Beamtenrecht in Polen, Estland und der Slowakei und das Problem der Überpolitisierung im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80246