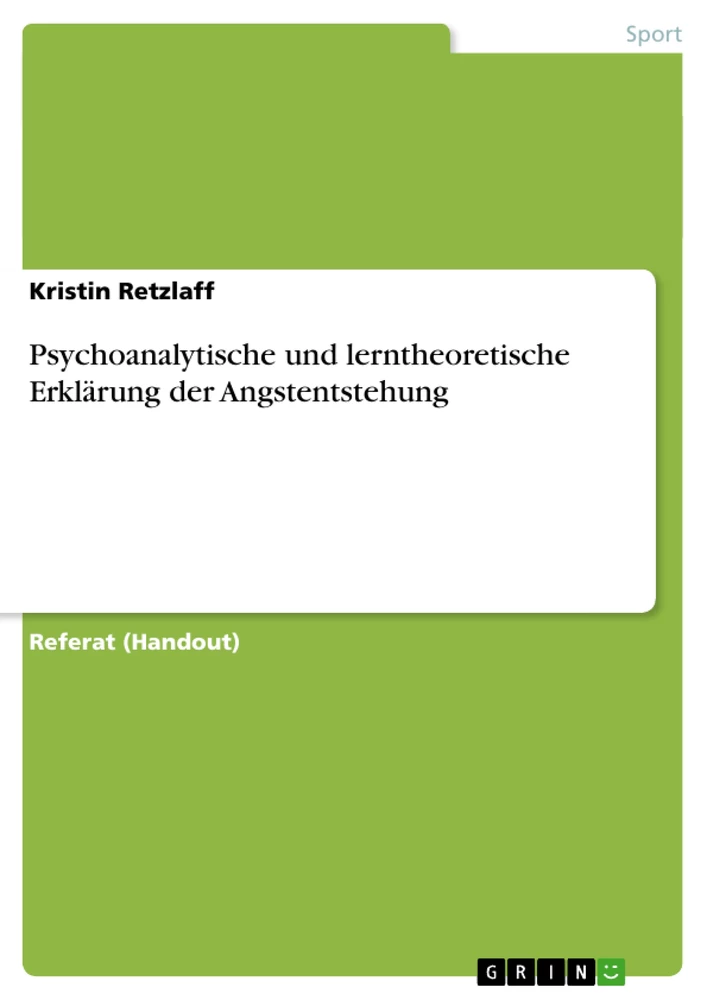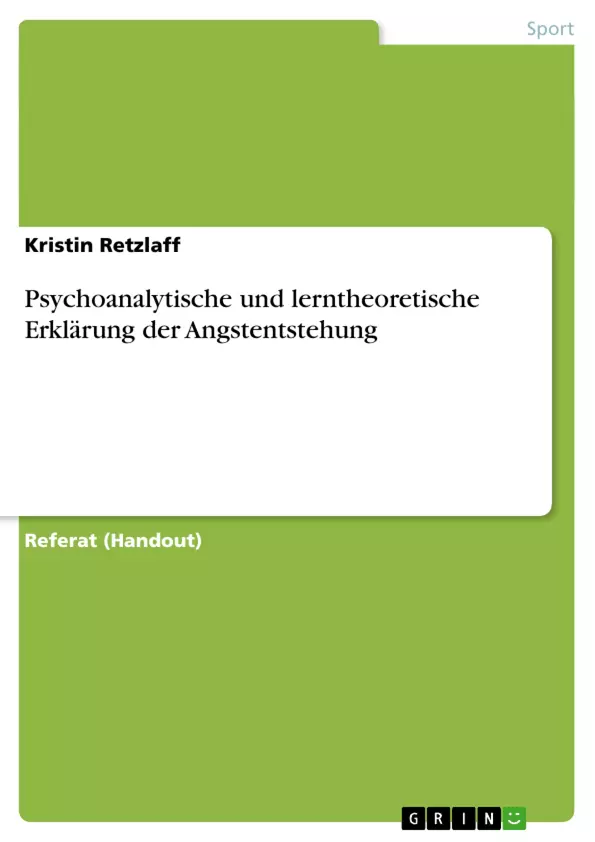- Gefühle oder Emotionen sind miteinander eng verknüpfte innerorganismische Vorgänge; sie treten auf, wenn Veränderungen in der Mensch-Umwelt-Beziehung widergespiegelt werden
- es sind also Erlebnisse, die positiv und angenehm (z. B. Freude, Lust) oder negativ und unangenehm (z. B. Angst, Traurigkeit) sein können
- von früher Kindheit an bis ins hohe Alter erlebt jeder Mensch vielfältige Ängste – Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, treibt uns voran, Angst vor möglichen Gefahren hält uns zurück
- unsere Aufgabe ist es nun, genauer zu erkennen, welche Rolle die Angst im menschlichen Leben spielt, wie sie zustande kommt und sich weiterentwickelt
- dann erst können wir lernen, Ängste schöpferisch zu verarbeiten und zu meistern
Gliederung:
1 Einleitung Angst
2 Psychoanalyse - Grundannahmen
2.1 Triebe
2.2 1. Topisches Modell
2.3 2. Topisches Modell
2.4 Zusammenspiel zwischen den Modellen
2.5 Angstentstehung nach Freud
2.6 Abwehrmechanismen des ICHs
3 Lerntheorien - Grundannahmen
3.1 Klassisches Konditionieren
3.2 Instrumentelles/Operantes Konditionieren
3.3 2-Phasen-Theorie nach Mowrer
3.4 Beispiele
Literatur
1 Einleitung - Angst
- Gefühle oder Emotionen sind miteinander eng verknüpfte innerorganismische Vorgänge; sie treten auf, wenn Veränderungen in der MenschUmwelt-Beziehung widergespiegelt werden
- es sind also Erlebnisse, die positiv und angenehm (z. B. Freude, Lust) oder negativ und unangenehm (z. B. Angst, Traurigkeit) sein können
- von früher Kindheit an bis ins hohe Alter erlebt jeder Mensch vielfältige Ängste - Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, treibt uns voran, Angst vor möglichen Gefahren hält uns zurück
- unsere Aufgabe ist es nun, genauer zu erkennen, welche Rolle die Angst im menschlichen Leben spielt, wie sie zustande kommt und sich weiterentwickelt
- dann erst können wir lernen, Ängste schöpferisch zu verarbeiten und zu meistern
2 Psychoanalyse - Grundannahmen
- Begründer war Freud (1856-1939)
- Lebensdaten
- die Psychoanalyse hat wenigstens drei Bedeutungen
1. sie bezeichnet eine psychologische Methode, speziell ein Verfahren zur Untersuchung psychischer Vorgänge wie Träumen, Handlungen, Reden und Wahrnehmungen
2. sie bezeichnet eine bestimmte Form der Psychotherapie - Methode zur Behandlung psychischer Störungen
3. sie bezeichnet ein ganzes System von psychologischen und psycho- pathologischen Theorien von Freud, durch die die Ergebnisse der Untersuchungsmethoden und der psychotherapeutischen Methoden systematisiert wurden
- Freud benutzte im wesentlichen 3 Informationsquellen:
1. klinisches Fallmaterial
2. autobiographisches Material
3. Erscheinungsweisen, Verhaltensweisen aus alltäglichen Beobachtungen, aus Sprichwörtern, Mythen, Märchen, Liedern, klassischer Dichtung, Trivialliteratur
2.1 Triebe
- die Quelle der Motivation menschlicher Handlungen wird psychischer Energie, der sog. Libido zugeschrieben
- diese Energiequellen sind Triebe, die unbewusst in jedem von uns schlummern, einesteils erblich und angeboren, anderenteils verdrängt und erworben
- es ist sozusagen als der emotionale Haushalt des Menschen zu verstehen; dieser beinhaltet widersprüchliche Triebregungen, Wünsche, Lie- besbedürfnisse, Sehnsüchte, die als Kräfte in uns gedacht werden können
- die Triebstruktur des Menschen beinhaltet zwei Grundtriebarten, nämlich der Lebenstrieb und der Todestrieb
- der Lebenstrieb (Eros) beinhaltet Energien zum Eingehen von Bindungen (Sexualität, Zärtlichkeit, Liebe, Zuneigung, Sympathie), die gegenüber einem anderen Menschen empfunden wird
- der Todestrieb (Thanatos) ist diejenige Energie, die am Werke ist, wenn Aggression oder Hass durchbricht; damit ist die Energie der Zerstörung, der Destruktion gemeint; sie ist aber auch dann im Spiel, wenn wir andere Menschen ablehnen, wenn wir uns abgrenzen oder andere ausgrenzen; es ist die Kraft der Ablehnung, der Verneinung
- neben diesen beiden Grundtrieben gibt es weiterhin den Sexualtrieb, den Selbsterhaltungstrieb, den Aggressionstrieb
2.2 1. Topisches Modell (Schichtenmodell)
Grundaussagen: es gibt drei Ebenen:
das Bewusste - das Vorbewusste - das Unbewusste
- Bewusst sind alle diejenigen Gedanken, Vorstellungen und Wahrnehmungen, die eine Person bemerkt und zu denen sie unmittelbaren Zugang hat
- Vorbewusst sind alle seelischen Vorgänge, um die wir nicht spontan wissen, die jedoch aufgrund einer Bemühung dem Bewusstsein wieder relativ voll zugänglich gemacht werden kann
- Beziehung zwischen Vorbewusstsein und Bewusstsein:
- jeder Gedanke, der ins Bewusstsein tritt, war unmittelbar davor noch nicht präsent und verschwindet früher oder später wieder aus dem Bewusstsein;
- er befindet sich somit vorher und nachher im Vorbewussten und lässt sich von da jederzeit mit mehr oder weniger großer Willensanstrengung oder Verschiebung der Aufmerksamkeit ins Bewusstsein holen
- Unbewusst:
- sind seelische Vorgänge, um die wir nicht bzw. nicht mehr wissen, die aber immer wieder in das Bewusstsein drängen und unser Erleben und Verhalten in einem nicht unerheblichen Maße bestimmen;
- Inhalte können nicht durch Willensanstrengungen, sondern nur unter ganz bestimmten Bedingungen ins Bewusstsein geholt werden;
- dabei handelt es sich um Erlebnisse, Gefühle und Wünsche, die als beschämend oder bedrohlich erlebt wurden
- zum 1. topischen Modell gehört der Begriff der Verdrängung: dies bedeutet, das psychische Anteile aus dem Bewusstsein herausgedrängt und in das Vorbewusste oder sogar in das Unbewusste gedrängt und dort über sogenannte Gegenbesetzungen gehalten werden
- z. B. Erinnerungen an ein traumatisches Ereignis oder an eine Handlung, in die ich schuldhaft verstrickt war
- Verdrängung gehört zu einer normalen menschlichen Entwicklung; wer die Fähigkeit, zu verdrängen, nicht beherrscht, ist nicht lebensfähig
- daraus folgt aber nicht, das der am besten lebt, der am meisten verdrängt, sondern vielmehr gilt: wenn ein bestimmtes Maß an Verdrängung überschritten wird, muss viel Energie für die sogenannte Gegenbesetzung aufgewandt werden, um das Verdrängte in der Verdrängung zu behalten
- wenn ich viel Energie aufbringen muss, um Gegenbesetzungen aufrechtzuerhalten, habe ich weniger Energie für mein aktives Leben zur Verfügung - meine Liebes- und Arbeitsfähigkeit wird eingeschränkt
2.3 2. Topisches Modell (Instanzenmodell)
- Freud unterscheidet in diesem Persönlichkeitsmodell drei Instanzen, durch die er die Erlebens- und Verhaltensweisen eines Individuums erklärt:
das ES - das ICH - das ÜBER-ICH
- sie repräsentieren verschiedene Teilaspekte der Persönlichkeit und stehen miteinander in enger Wechselbeziehung
- die Dynamik und Gesamtheit der Beziehungen zwischen den drei Instanzen macht nach Freud die Persönlichkeit des Menschen aus
Das ES
- ist die elementarste Schicht; sie ist ab dem 1. Lebenstag vorhanden und beinhaltet alle Triebe, Wünsche und Bedürfnisse eines Individuums
- im ES gelten keine Gesetze des logischen Denkens
- die Impulse drängen rücksichtslos nach außen und wollen befriedigt werden, egal ob dieses Ziel realisierbar oder moralisch annehmbar ist
- das ES arbeitet nach dem Lustprinzip, also sofortige und totale Triebbefriedigung ohne Rücksicht auf Verluste zu erreichen sowie Schmerz und Unbehagen zu vermeiden
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- das Lustprinzip ist entweder ziel- oder objektgerichtet
Das ICH
- ist die Instanz des bewussten Lebens, die die bewusste Auseinandersetzung mit der Realität leistet
- die Aufgabe des ICH besteht darin, die Wünsche des ES zum Ausdruck zu bringen und im Einklang mit der Realität zu befriedigen
- es vermittelt sozusagen zwischen den Wünschen des ES und den Anforderungen der Außenwelt
- das ICH arbeitet nach dem Realitätsprinzip - die Triebbefriedigung wird bis zu einem günstigen Zeitpunkt aufgeschoben, an dem ein Maximum an Vergnügen mit den geringst möglichen negativen Konsequenzen oder Schmerzen verknüpft ist
- bei der Realitätsprüfung helfen ICH-Funktionen wie Gedächtnis, Wahrnehmung, Beherrschung des Bewegungsapparates, Denken, Sprechen oder Beurteilen
Das ÜBER-ICH
- ist diejenige Instanz, welche die Wert- und Normvorstellungen einer Gesellschaft umfasst und das Verhalten und Handeln des ICH's im Sinne der geltenden Moral führt
- ist das Gewissen, das das Verhalten insofern kontrolliert, als es Belohnung für „gutes“ und Bestrafung für „schlechtes“ Verhalten verspricht
- die Aufgabe des ÜBER-ICHs besteht also darin, unser Verhalten, aber auch unsere Wünsche und Gedanken an den verinnerlichten Normen zu prüfen
- es missbilligt und bestraft, was diesen Normen nicht entspricht (Gewissensbisse, Schuldgefühle) und billigt und belohnt, was diesen Normen entspricht (Stolz, Eigenliebe)
- das ÜBER-ICH vertritt das Moralitätsprinzip; es bewertet die Triebwünsche, ob sie zugelassen werden oder nicht
2.4 Zusammenspiel der beiden topischen Modelle
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. aus: ASENDORPF (1998, 16)
- das Wechselspiel zwischen den Wünschen des ES, den moralischen Bewertungen des ÜBER-ICHs, den Anforderungen der Realität und den Vermittlungs- und Anpassungsleistungen des ICHs bewirken die Dynamik der Persönlichkeit; dementsprechend verhält sich eine Person in bestimmten Situationen charakteristisch
- das ES bringt bestimmte Wünsche oder Bedürfnisse an, die vom ÜBER- ICH bewertet werden und das ICH versucht, zwischen beiden zu vermitteln und überprüft die Realität danach, ob Befriedigung möglich ist oder nicht
- nicht zugelassene Wünsche müssen vom ICH abgewehrt, „unbewusst“ gemacht, verdrängt werden
2.5 Angstentstehung
- die Ursachen der Angst sind einerseits in persönlichen Faktoren zu suchen (z. B. im Grad der Ängstlichkeit) andererseits in der Umwelt (Hinweisreize)
- Angst stellt einen ICH-Zustand dar, der als beklemmend, bedrückend und als unangenehm empfunden wird
- dieser ICH-Zustand wird in der Regel durch gedankliche Vorwegnahme der Nicht-Bewältigung einer bestimmten Situation ausgelöst und deshalb als bedrohlich erlebt
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie erklärt Freud die Entstehung von Angst?
Angst entsteht laut Freud durch einen Konflikt zwischen den Triebwünschen des ES, den moralischen Forderungen des ÜBER-ICHs und der Realität.
Was ist der Unterschied zwischen dem ES, ICH und ÜBER-ICH?
Das ES steht für Triebe (Lustprinzip), das ÜBER-ICH für Moral (Gewissen) und das ICH für die bewusste Vermittlung und Realitätsprüfung.
Wie erklären Lerntheorien die Angst?
Angst wird als erlerntes Verhalten durch klassische Konditionierung (Koppelung eines Reizes mit Schmerz) oder operante Konditionierung (Vermeidungslernen) gesehen.
Was sind Abwehrmechanismen des ICHs?
Dazu gehören Verdrängung, Projektion oder Sublimierung, die das ICH einsetzt, um unerträgliche Ängste aus dem Bewusstsein fernzuhalten.
Was besagt die 2-Phasen-Theorie nach Mowrer?
Sie kombiniert klassische Konditionierung (Angstentstehung) und instrumentelle Konditionierung (Angstaufrechterhaltung durch Vermeidung).
- Arbeit zitieren
- Kristin Retzlaff (Autor:in), 2002, Psychoanalytische und lerntheoretische Erklärung der Angstentstehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8025