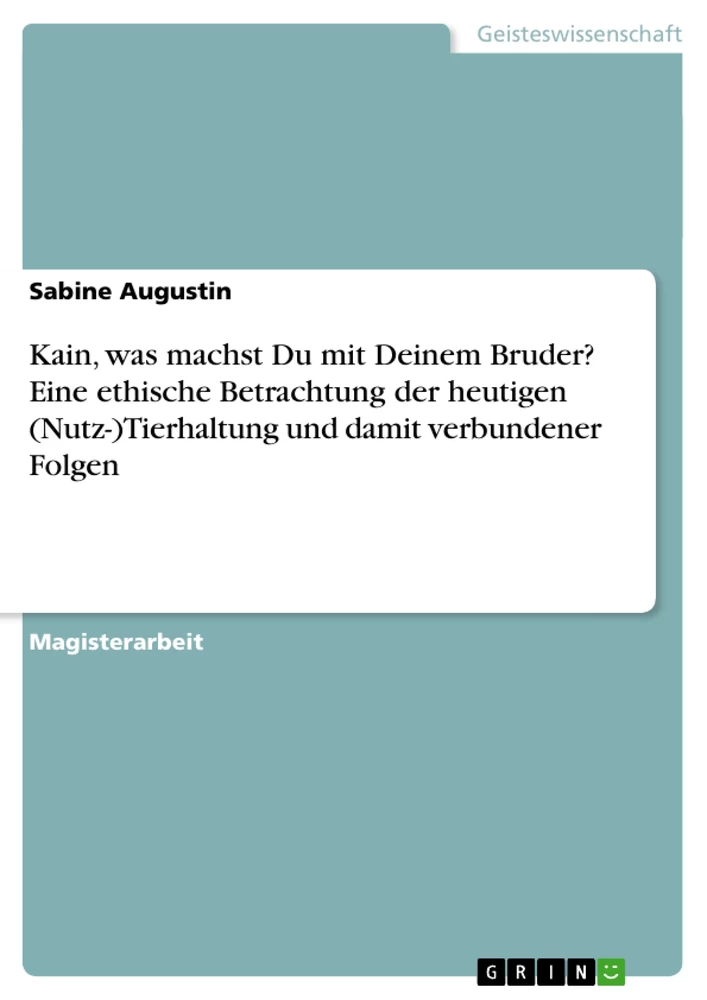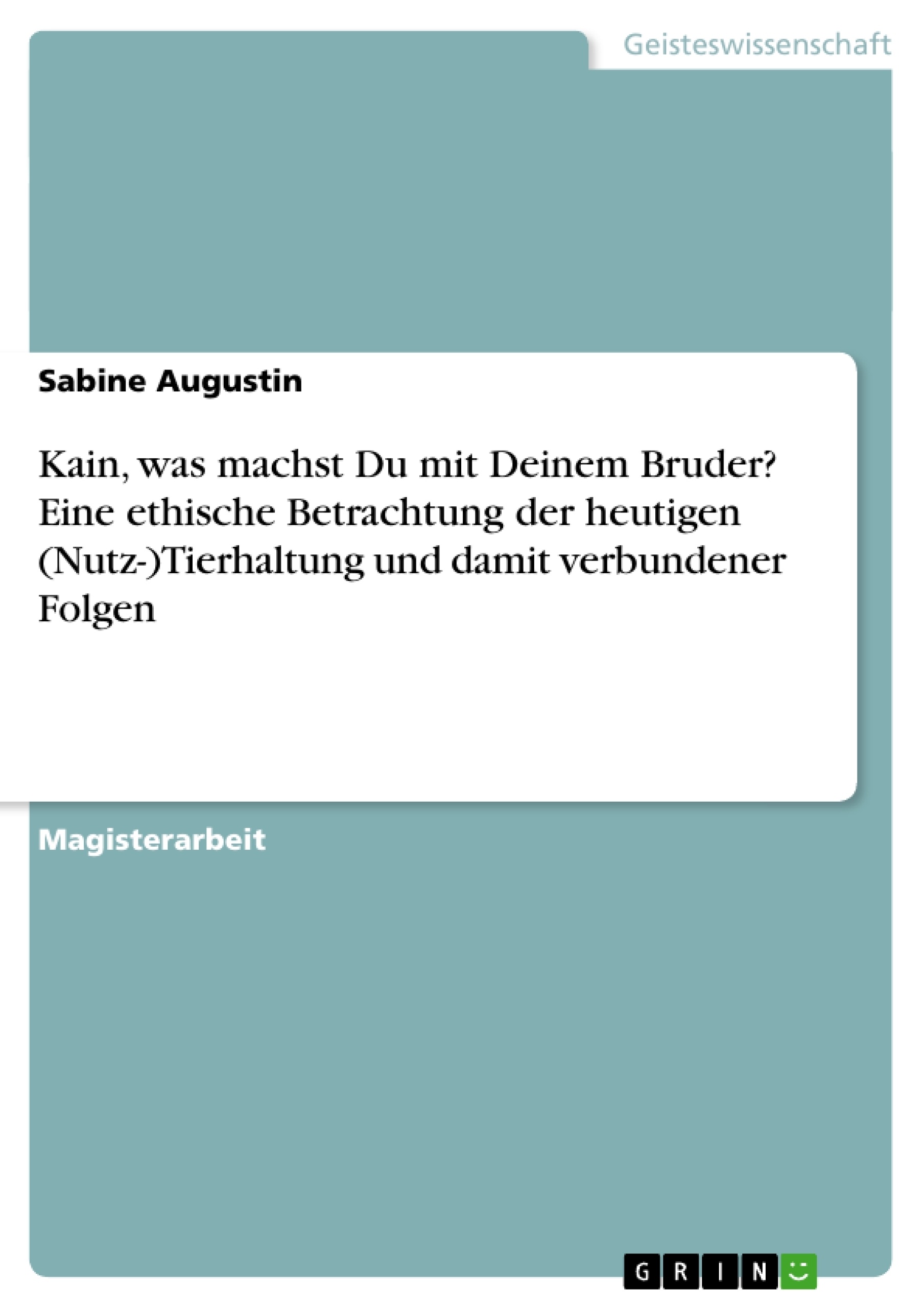Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der heiklen Thematik der Tierethik auseinander. Auf der Suche nach einem Merkmal, welches die menschliche Spezies von allen anderen trennt, rückt das Kriterium der Leidensfähigkeit zunehmend in den Mittelpunkt. Anhand konkreter Beispiele aus verschiedenen Lebensbereichen, in denen Tiere vom Menschen instrumentalisiert werden, soll eine Grundlage geschaffen werden, um aufgrund der menschlichen Empathie über ein moralisches Verhalten gegenüber anderen Spezies Diskurs zu führen. Dabei werden Gebiete wie Ökologie, Ökonomie und Theologie gestreift, denn auch wenn der Begriff des Speziesismus relativ jung ist, so ist seine Geschichte so alt wie die Menschheit selbst und berührt nahezu alle menschlichen Lebensbereiche. Nicht zuletzt die Ernährungswissenschaft deckt so manche Lüge der Nahrungsmittelindustrie auf, auch die Ethologie lässt keinen Zweifel offen, dass die moderne Erzeugung tierischer Produkte letztlich nur Nachteile hat - nicht nur für die Tiere. Darum soll auch die rechtliche Lage für Tiere erörtert werden und die Möglichkeit bzw. der Bedarf der Einführung von Tierrechten begründet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Terminologie
- Definition Tier
- Der Begriff Domestizierung
- Speziesismus
- Der kleine Unterschied
- Entwicklung einer These
- Über Gleichheit und Ungleichheit
- Unterscheidungskriterien
- Schmerzempfindung
- Seele
- Bewusstsein, Intelligenz und Kultur
- Sprache und Zählen
- Selbstbewusstsein und Vernunft
- Interessen, Autonomie und die Leidensfähigkeit
- Würde und Moral
- Bilanz der „Beweise und daraus abgeleitete Folgerungen
- Grundlagen der Tierzüchtungslehre
- Entwicklung der Haustiere
- Geschichte der Tierzucht
- Heutige Nutztierrassen
- Rodentia-Ordnung der Nagetiere
- Lagomorpha-Ordnung der Hasenartigen
- Carnivora-Ordnung der Raubtiere
- Artiodactyla-Ordnung der Paarhufer
- Perissodactyla-Ordnung der Unpaarhufer
- Aves-Klasse der Vögel
- Pisces-Reihe der Fische
- Insecta-Klasse der Insekten
- Perversionen der Tierzucht
- Folgen der Zucht und Selektion
- Folgen der heutigen Nutztierzucht
- Tierhaltung
- Vom Bauernhof zur Massentierhaltung
- Tierfabriken und Fütterung
- Schweine
- Rinder
- Geflügel
- Schafe
- Pelze und Pelztierzucht
- Auswirkungen der Intensivhaltung
- (Schlacht-)Tiertransporte und Schlachthöfe
- Subventioniertes Tierleid
- Das Ende des Schreckens
- Tierversuche
- Hinter den Kulissen
- Nutzen von Tierversuchen
- Die Alternativen
- Koeffizient Wirtschaftlichkeit
- Welternährung bzw. unser täglich Fleisch
- Konsequenzen des Konsumverhaltens
- Nachhaltiger Konsum
- Jenseits der Krone der Schöpfung
- Von der Diskriminierung – die Geschichte des Speziesismus
- Töten erlaubt?
- Menschen und Unmenschen
- Tierrechte und Tierrechtsbewegung
- Biologische Erklärung zum ethischen Tierschutz
- Tierrechte
- Konsequenzen der Tierrechtsbewegung
- Verbesserungen
- Menschliches und Allzumenschliches
- Essverhalten - Vegetarier und Veganer
- Die Macht der Gewohnheit
- Die große Lüge
- Milch ist gesund
- Fleisch ist ein Stück Lebenskraft
- Mangelerscheinungen
- Zwingende Argumente
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der ethischen Betrachtung der heutigen (Nutz-)Tierhaltung und den damit verbundenen Folgen. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung im Laufe der Geschichte und hinterfragt die ethische Legitimität der Nutzung von Tieren für menschliche Zwecke.
- Der Speziesismus als Form der Diskriminierung
- Die Frage nach der moralischen Verantwortung des Menschen gegenüber Tieren
- Die Folgen der Massentierhaltung für Tiere und Umwelt
- Die ethische Rechtfertigung von Tierversuchen
- Die Bedeutung von Tierrechten und die Rolle der Tierrechtsbewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Arbeit und die Relevanz des Themas erläutert. Anschließend werden wichtige Begrifflichkeiten wie „Tier“, „Domestizierung“ und „Speziesismus“ definiert.
In Kapitel 3 wird die These entwickelt, dass Tiere, trotz ihrer Unterschiede zum Menschen, moralische Rechte besitzen. Es werden verschiedene Kriterien zur Unterscheidung von Menschen und Tieren betrachtet, wie z.B. Schmerzempfindung, Seele, Bewusstsein, Intelligenz und Kultur.
Kapitel 4 beleuchtet die Grundlagen der Tierzüchtungslehre und untersucht die Entwicklung der Haustiere sowie die Folgen der Zucht und Selektion. Besondere Aufmerksamkeit wird den Perversionen der Tierzucht gewidmet.
Kapitel 5 widmet sich dem Thema der Tierhaltung und beschreibt die Entwicklung von der traditionellen Bauernhofhaltung zur modernen Massentierhaltung. Es werden die Folgen der Intensivhaltung für die Tiere sowie die ethischen Aspekte der Pelztierzucht untersucht.
Kapitel 6 thematisiert die (Schlacht-)Tiertransporte und Schlachthöfe und beleuchtet die ethischen und tierschutzrelevanten Probleme in diesem Bereich.
Kapitel 7 beschäftigt sich mit dem Thema Tierversuche und beleuchtet die ethischen und wissenschaftlichen Aspekte dieser Praxis. Es werden auch alternative Methoden zu Tierversuchen vorgestellt.
Kapitel 8 analysiert den Koeffizienten Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die Fleischproduktion und die Folgen des Konsumverhaltens.
Kapitel 9 geht der Frage nach, ob und wie die menschliche Spezies über andere Lebewesen steht und setzt sich mit dem Konzept des Speziesismus auseinander.
Kapitel 10 befasst sich mit den Tierrechten und der Tierrechtsbewegung. Es wird die biologische Grundlage für den ethischen Tierschutz erläutert und die Konsequenzen der Tierrechtsbewegung diskutiert.
Kapitel 11 untersucht das menschliche Essverhalten und die Rolle von Vegetariern und Veganern. Es wird auf die Macht der Gewohnheit und die großen Mythen rund um den Konsum von Fleisch und Milchprodukten eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den ethischen Herausforderungen der modernen (Nutz-)Tierhaltung und verwendet Schlüsselbegriffe wie Speziesismus, Tierrechte, Massentierhaltung, Tierversuche, Nachhaltigkeit, Vegetarismus und Veganismus. Weitere wichtige Themen sind die Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung, die moralische Verantwortung des Menschen gegenüber Tieren sowie die Folgen des Konsumverhaltens für die Tiere, die Umwelt und die menschliche Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff Speziesismus?
Speziesismus bezeichnet eine Form der Diskriminierung, bei der Lebewesen allein aufgrund ihrer Artzugehörigkeit unterschiedlich moralisch bewertet werden.
Welche Kriterien werden zur Unterscheidung von Mensch und Tier herangezogen?
In der ethischen Debatte werden Merkmale wie Leidensfähigkeit, Schmerzempfindung, Bewusstsein, Intelligenz, Sprache und Selbstbewusstsein untersucht.
Was sind die Folgen der modernen Massentierhaltung?
Die Massentierhaltung hat negative Auswirkungen auf das Tierwohl, die Umwelt (Ökologie) und führt zu ethischen Konflikten in der Gesellschaft.
Gibt es Alternativen zu Tierversuchen?
Ja, die Arbeit stellt alternative Methoden zu Tierversuchen vor und diskutiert deren Nutzen sowie die ethische Rechtfertigung dieser Praxis.
Welche Rolle spielt die Tierrechtsbewegung?
Die Tierrechtsbewegung setzt sich für die rechtliche Anerkennung von Tieren als Wesen mit eigenen Rechten ein und fordert Verbesserungen im Umgang mit (Nutz-)Tieren.
Wie beeinflusst das Konsumverhalten die Tierethik?
Das Essverhalten (Vegetarismus, Veganismus) und die Nachfrage nach tierischen Produkten haben direkte Konsequenzen für die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit der Tierproduktion.
- Quote paper
- Dipl. Inf. Sabine Augustin (Author), 2007, Kain, was machst Du mit Deinem Bruder? Eine ethische Betrachtung der heutigen (Nutz-)Tierhaltung und damit verbundener Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80279