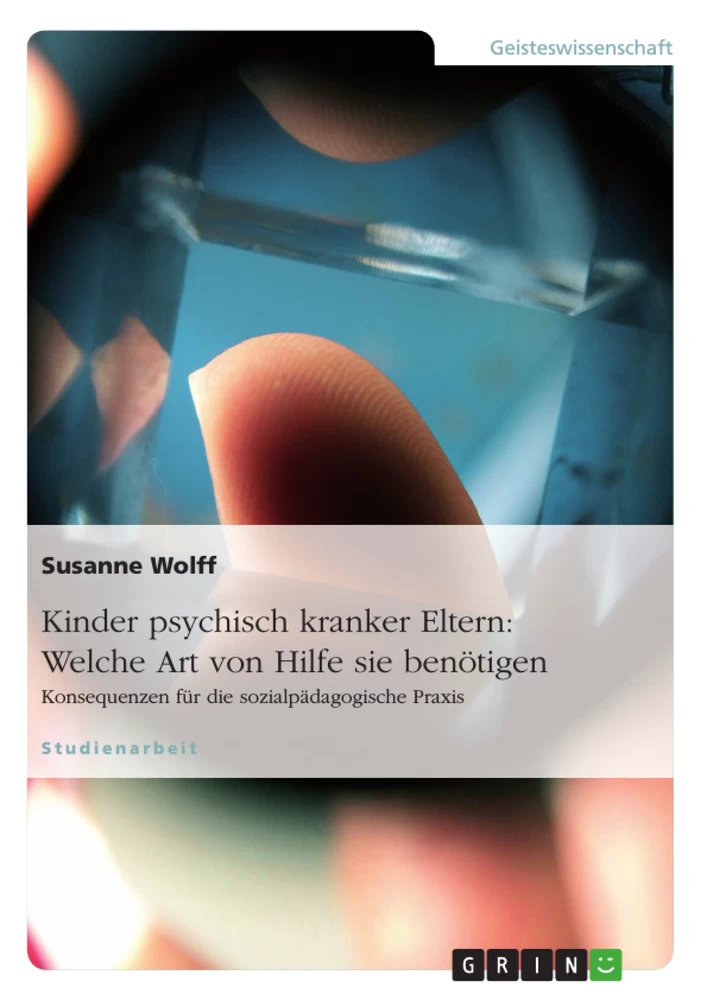In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ca. 500.000 Kinder, deren Eltern an einer Schizophrenie oder Depression erkrankt sind, 40.000 Eltern sind drogenabhängig und 2,65 Millionen Kinder leben mit Eltern zusammen, die eine alkoholbezogene Störung haben.
Nicht nur die Eltern leiden hier, sondern auch die Kinder. Viele Kinder werden von ihren Eltern vernachlässigt oder sogar psychisch und/oder physisch misshandelt, sie müssen Verantwortung übernehmen für die sie noch viel zu jung sind, werden häufig sozial ausgegrenzt und kaum unterstützt.
Diese Arbeit beschäftigt sich damit, wie es den Kindern von psychisch kranken Eltern geht, was sich in ihrem Leben durch die Krankheit ändert, welche Themen sie beschäftigen und welche Hilfestellungen sie benötigen, welche Hilfe Sozialarbeiter und -pädagogen an dieser Stelle leisten können und worauf geachtet werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stand der Forschung
- "high-risk" - Forschung
- Resilienzforschung
- Vulnerabilitätsforschung
- Fazit zur Forschung
- Perspektive der Eltern
- Daten und Einstieg
- Untersuchung
- Ergebnisse
- Gefühle der Eltern
- Perspektiven der Kinder
- Einstieg
- Untersuchung
- Ergebnisse
- Wahrnehmung und Erleben der Krankheit
- Gefühle und Gedanken
- Auswirkungen auf das Familienleben
- Subjektive Krankheitstheorien der Kinder
- Besuchskontakte
- Informationsquellen der Kinder
- Bewältigungsstrategien
- Hilfsangebote
- Konsequenzen für die Praxis
- Informationsvermittlung und Aufklärung
- Formen der Einbeziehung in die Behandlung
- Möglichkeiten der Förderung und Stärkung sozialer Ressourcen
- Perspektiven der Experten
- Einstieg
- Untersuchung
- Ergebnisse
- Ambivalente Haltung der Experten zu Kooperation
- Erfahrungen mit den Kooperationsbeziehungen und Konfliktlinien
- Vorstellungen zu internen Strukturveränderungen
- Interinstitutionelle Voraussetzungen für eine Kooperation
- Fazit
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Situation von Kindern, deren Eltern an einer psychischen Störung leiden. Sie beleuchtet verschiedene Perspektiven auf die Problematik, darunter die Sichtweisen der Kinder, der Eltern und der Experten. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Krankheit auf die Kinder, die Herausforderungen, die sie bewältigen müssen, sowie mögliche Hilfestellungen und Unterstützungsmöglichkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung von interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Experten und Familien.
- Auswirkungen der psychischen Erkrankung der Eltern auf die Kinder
- Bewältigungsstrategien der Kinder
- Hilfestellungen und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder und Familien
- Perspektiven der Eltern und die Bedeutung von Elternschaft trotz Krankheit
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Experten und Familien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt anhand einer persönlichen Geschichte die Relevanz der Problematik für betroffene Kinder heraus. Das Kapitel "Stand der Forschung" beleuchtet verschiedene Forschungsansätze, die sich mit der Situation von Kindern psychisch kranker Eltern beschäftigen. Insbesondere die "high-risk"-Forschung zeigt das erhöhte Risiko für psychische Störungen bei diesen Kindern auf. Das Kapitel "Perspektive der Eltern" fokussiert auf die Erfahrungen und Gefühle der Eltern, während "Perspektiven der Kinder" die Auswirkungen der Krankheit auf die Kinder aus deren Sicht beleuchtet. Dieses Kapitel behandelt Themen wie Wahrnehmung der Krankheit, emotionale Reaktionen, Veränderungen im Familienleben und Bewältigungsstrategien. Abschließend widmet sich das Kapitel "Perspektiven der Experten" den Erfahrungen und Herausforderungen der Zusammenarbeit zwischen Experten und Familien.
Schlüsselwörter
Psychische Erkrankung, psychisch kranke Eltern, Kinder, Auswirkungen, Bewältigung, Resilienz, Vulnerabilität, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Familienhilfe, Kooperation, Unterstützungsmöglichkeiten, Forschung, "high-risk" - Forschung, Elternschaft, Familienleben.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kinder sind in Deutschland von psychisch kranken Eltern betroffen?
Schätzungen zufolge leben ca. 500.000 Kinder mit Eltern mit Schizophrenie oder Depression, und Millionen weitere sind von alkoholbezogenen Störungen oder Drogenabhängigkeit der Eltern betroffen.
Was versteht man unter „Parentifizierung“?
Parentifizierung bedeutet, dass Kinder die Verantwortung für ihre Eltern übernehmen müssen, für die sie emotional und entwicklungsmäßig noch viel zu jung sind.
Welche Rolle spielt die Resilienzforschung in diesem Kontext?
Sie untersucht, warum manche Kinder trotz der hohen Belastung psychisch gesund bleiben und welche Schutzfaktoren (z. B. soziale Ressourcen) sie dabei unterstützen.
Welche Art von Hilfe benötigen diese Kinder konkret?
Wichtig sind altersgerechte Informationen über die Krankheit, emotionale Entlastung, die Stärkung sozialer Netzwerke und die Einbeziehung in den Behandlungsprozess der Eltern.
Warum ist die Kooperation zwischen Experten oft schwierig?
Es gibt oft Konflikte zwischen Erwachsenenpsychiatrie und Jugendhilfe aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten, Schweigepflichten und mangelnder interinstitutioneller Strukturen.
Was sind „subjektive Krankheitstheorien“ von Kindern?
Es sind die eigenen Erklärungsversuche der Kinder für das Verhalten ihrer Eltern. Ohne Aufklärung geben sich Kinder oft selbst die Schuld an der Erkrankung.
- Quote paper
- Susanne Wolff (Author), 2007, Kinder psychisch kranker Eltern: Welche Art von Hilfe sie benötigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80558