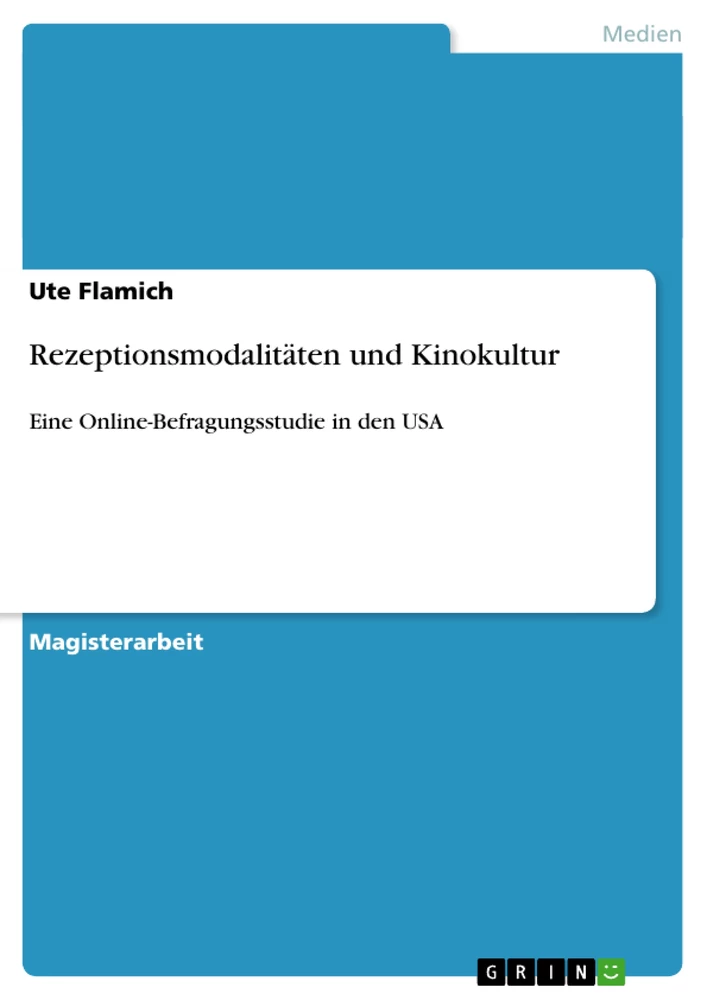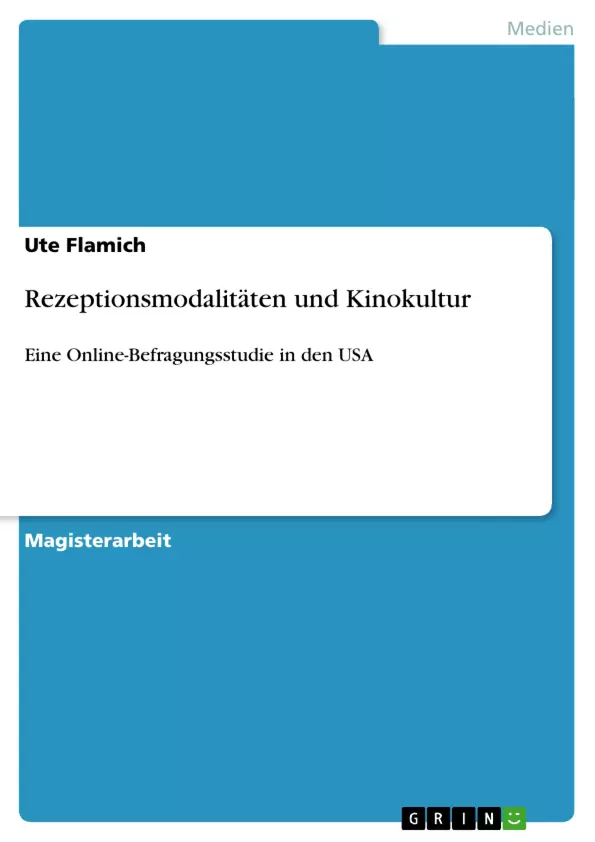The study presented is based on the model of Rezeptionsmodalitäten (reception modalities) developed by Suckfüll (u.m.). The four-factor-model is a multidimensional construct of involvement in fictional films with the hierarchical factors of second order Identity Work and Trust and the factors of first order Imagination and Control. The factor Identity Work serves to explain the factors of first order Socio- and Ego-Involvement whereas the factor Trust explains the factors of first order Diegetic and Emotional Involvement.
The work presented analyzed, if the four-factor-model of reception modalities is transferable to the US-American population. The author of this work presumed that because of country-specific aspects of the American cinema culture a transfer is only possible with some limitations.
The validation of the hypothesis using an online survey was carried out from the 4th of August till the 15th of October with 261 US-American respondents.
The data was analyzed by using an explorative factor analysis. For the US-American population four factors of first order could be identified. Those factors correspond to the modalities of Suckfüll (u.m.) Control, Imagination, Identity Work and Trust as far as possible. Mainly, there are differences concerning interfactor relations. So the hypothesis of the author was validated.
Following studies in the USA using the model of reception modalities by Suckfüll (u.m.) could provide promising results, inter alia with regard to the operationalization and development of reception modalities for television.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Abstract
- 1 Einleitung
- 2 Kinokultur in den USA und in Deutschland
- 2.1 Der Kulturbegriff: Etymologie und Definitionen
- 2.1.1 Kultur aus evolutionspsychologischer Sicht
- 2.1.2 Definition Kinokultur
- 2.2 Kinokultur aus medienökonomischer Perspektive
- 2.2.1 Erfolgsfaktoren von Kinofilmen
- 2.2.2 Gründe für die ökonomische Dominanz US-amerikanischer Filme
- 2.2.2.1 Markt der Filmstars
- 2.2.2.2 Cultural Discount
- 2.2.2.3 Größe des Sprach- bzw. Kulturraums
- 2.2.2.4 Standortfaktoren
- 2.2.2.5 Vertikale Integration
- 3 Das Konstrukt der Rezeptionsmodalitäten
- 3.1 Vita Monika Suckfüll
- 3.2 Rezeptionsmodalitäten als integratives Konstrukt in der Medienwirkungsforschung
- 3.3 Rezeptionsmodalitäten als Modalitäten der Filmrezeption
- 3.3.1 Definition der Rezeptionsmodalitäten
- 3.3.2 Operationalisierung und Validierung
- 3.3.3 Das Involvement Konstrukt
- 3.3.4 Das 4-Faktoren-Modell
- 3.3.4.1 Modelländerung und Hypothese
- 3.3.4.2 Stichprobe
- 3.3.4.3 Ergebnisse und Interpretation
- 3.3.5 Aspekte der Filmrezeption aus evolutionspsychologischer Sicht
- 3.4 Zusammenfassung
- 4 Exkurs: Internet und internetbasierte Erhebungsmethoden
- 4.1 Definition und Entstehung des Internet
- 4.2 Internetgestützte Datenerhebungsverfahren
- 4.3 Vor- und Nachteile von Online-Befragungen
- 4.4 Internetnutzung in den USA
- 5 Fragestellungen und Forschungshypothesen
- 6 Untersuchungsdesign
- 6.1 Interkulturelle Forschung
- 6.2 Datenerhebung
- 6.2.1 Erhebungsmethode
- 6.2.2 Aufbau und Inhalt des Fragebogens
- 6.2.3 Pretest
- 6.2.4 Stichprobenziehung
- 6.2.5 Untersuchungsablauf
- 6.3 Störfaktoren und kritische Anmerkungen zur empirischen Studie
- 6.3.1 Befragtenverhalten
- 6.3.2 Stichprobenziehung, Selbstselektion und Repräsentativität
- 6.3.3 Kontaktierung der Probanden per direkter E-Mail-Anfrage
- 6.3.4 Nonresponse
- 6.3.5 Länge des Fragebogens
- 6.3.6 Incentives
- 6.3.7 Zusammenfassung der kritischen Anmerkungen
- 7 Ergebnisse
- 7.1 Auswertung der Rezeptionsmodalitäten mittels explorativer Faktorenanalyse
- 7.2 Interpretation der Faktorenstruktur
- 7.3 Auswertung des Fragebogens
- 7.3.1 Auswertung der Fragen F2 und F3: weitere Rezeptionsmodalitäten
- 7.3.2 Auswertung F4 und F5: Lieblingsfilme nach Produktionsland
- 7.3.3 Auswertung F7 und F8: Die Bedeutung der Filmstars
- 8 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Rezeption von Kinofilmen in den USA und beleuchtet die Bedeutung der Rezeptionsmodalitäten für das Filmerlebnis. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Rezeption von Kinofilmen in den USA mithilfe einer Online-Befragungsstudie zu erforschen und die Relevanz der Rezeptionsmodalitäten für das Filmerlebnis zu beleuchten.
- Rezeption von Kinofilmen in den USA
- Rezeptionsmodalitäten und deren Einfluss auf das Filmerlebnis
- Kulturvergleich zwischen USA und Deutschland
- Medienökonomische Aspekte der Kinokultur
- Anwendung evolutionspsychologischer Ansätze auf die Medienrezeption
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2: Die Einleitung führt in das Thema Rezeption von Kinofilmen ein und stellt den Bezug zur Kultur und zum Medienmarkt her.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel widmet sich dem Konstrukt der Rezeptionsmodalitäten und deren Rolle in der Medienwirkungsforschung.
- Kapitel 4: Der Exkurs behandelt das Internet und internetbasierte Erhebungsmethoden und erläutert die Bedeutung des Internets für die Datenerhebung in der Medienforschung.
- Kapitel 5: Es werden die Fragestellungen und Forschungshypothesen der Arbeit definiert.
- Kapitel 6: Das Untersuchungsdesign wird vorgestellt, einschließlich der interkulturellen Forschungsmethode, der Datenerhebung und der kritischen Anmerkungen zur empirischen Studie.
- Kapitel 7: Die Ergebnisse der Online-Befragungsstudie werden präsentiert, einschließlich der Auswertung der Rezeptionsmodalitäten und der Interpretation der Faktorenstruktur.
Schlüsselwörter
Rezeptionsmodalitäten, Kinokultur, Filmrezeption, Online-Befragung, USA, Kulturvergleich, Medienökonomie, Evolutionspsychologie, Internet, Datenerhebung, Medienwirkungsforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Rezeptionsmodalitäten?
Es ist ein Modell von Monika Suckfüll, das das Involvement in fiktionale Filme durch Faktoren wie Identitätsarbeit, Vertrauen, Imagination und Kontrolle beschreibt.
Unterscheidet sich die Kinokultur in den USA von der in Deutschland?
Ja, die Arbeit zeigt, dass länderspezifische Aspekte die Filmrezeption beeinflussen und das deutsche Modell nur bedingt auf die US-Bevölkerung übertragbar ist.
Welche Rolle spielen Filmstars für den Erfolg?
Filmstars sind ein wesentlicher medienökonomischer Erfolgsfaktor, der besonders die Dominanz US-amerikanischer Filme auf dem Weltmarkt stärkt.
Was bedeutet "Cultural Discount"?
Es beschreibt den Wertverlust eines Medienprodukts, wenn es in einem anderen Kulturraum konsumiert wird, da kulturelle Bezüge weniger verstanden werden.
Wie wurde die empirische Studie durchgeführt?
Die Validierung erfolgte über eine Online-Befragung mit 261 US-amerikanischen Teilnehmern und einer anschließenden explorativen Faktorenanalyse.
- Quote paper
- Magistra Artium (M.A.) Ute Flamich (Author), 2006, Rezeptionsmodalitäten und Kinokultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80575