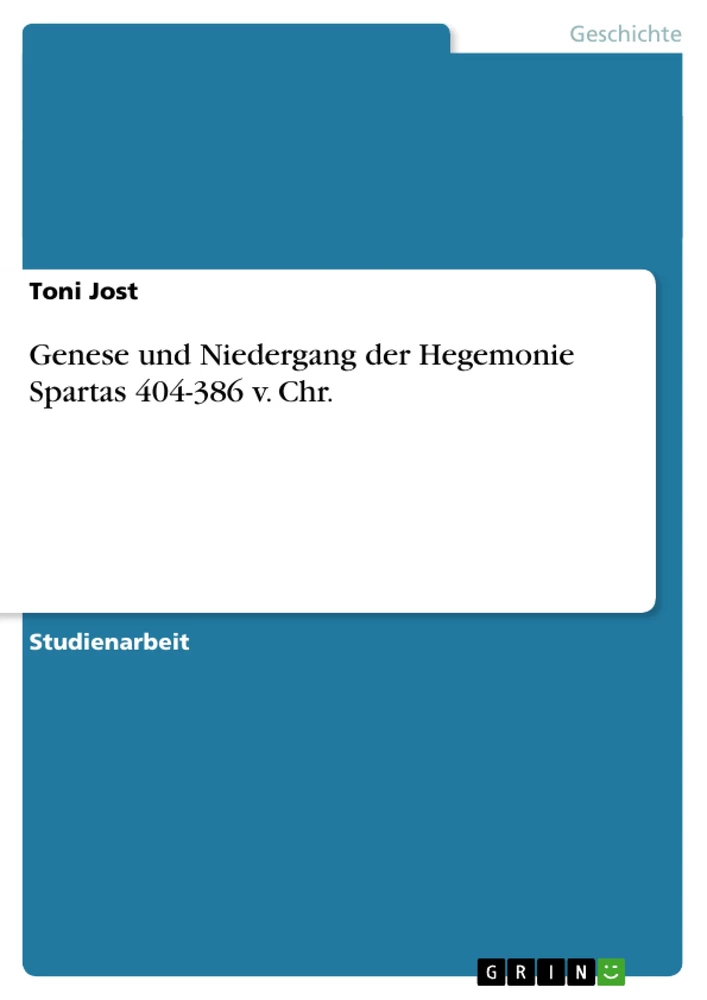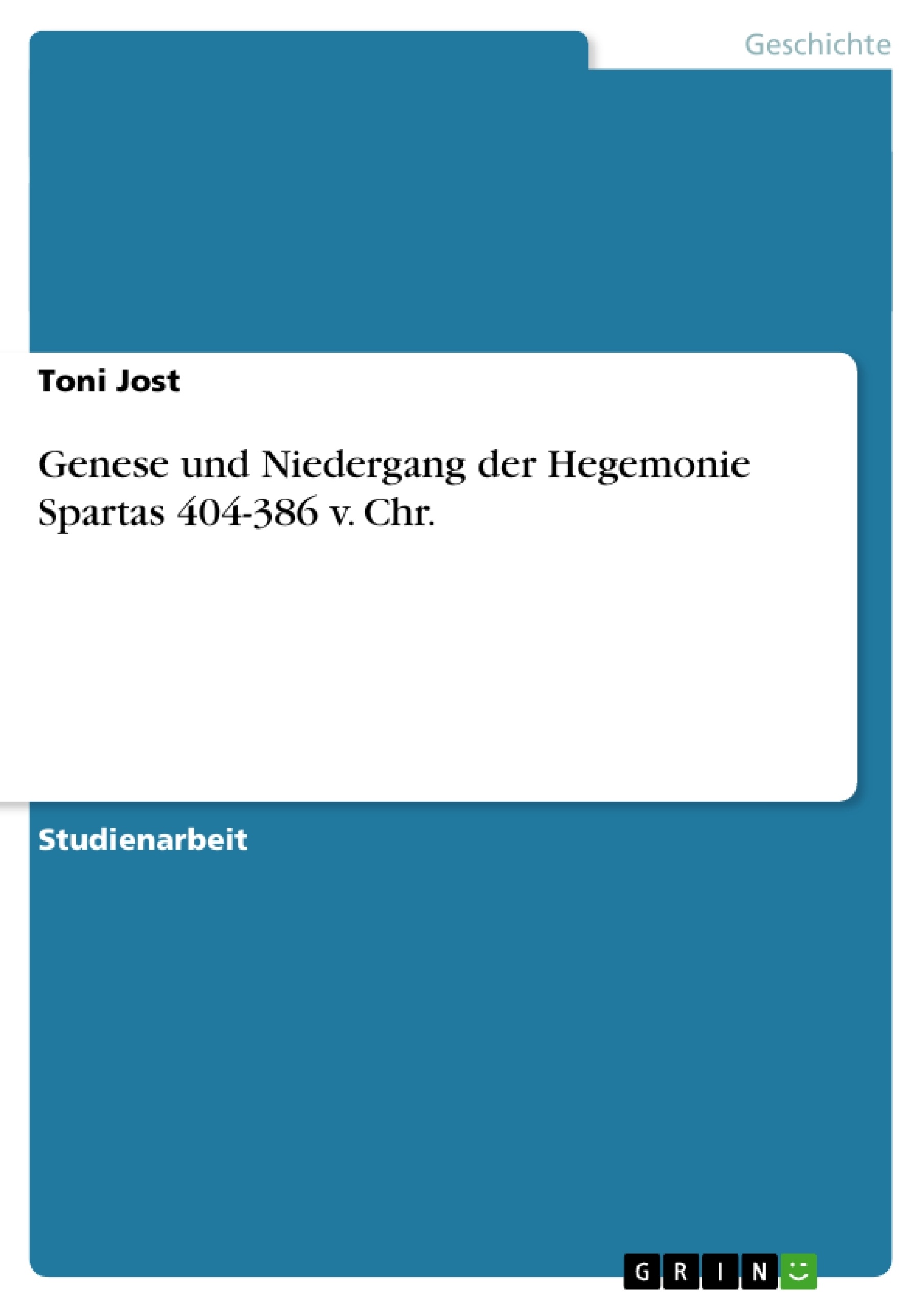Konsens besteht in der Forschung darin, dass eine spartanische Hegemonie tatsächlich existierte. Fatal erscheint jedoch der leichtfertige Umgang mit diesem Begriff, denn kein einziger Beitrag setzt sich mit ihm ernsthaft auseinander. Im engeren Sinne bedeutet Hegemonie „Führerschaft“, im antiken Verständnis militärische Führung. Auch galten die Führer von militärischen Bündnissystemen (wie etwa der Peloponnesische Bund Spartas oder der Attische Seebund) als „Hegemone“. Die 404 konstatierte Hegemonie Spartas fällt aber aus diesen Definitionen heraus. Zum einen gründete sie sich auf Friedensverträge und zum anderen war Spartas Stellung im Peloponnesischen Bund vor wie nach 404 unbestritten. Das Neue an dieser Situation war die (vermeintliche) Vorherrschaft über alle Griechen, nicht nur über die direkten Nachbarn.
Aus der politikwissenschaftlichen Systemforschung ist bekannt, dass die Etablierung einer Herrschaft mehrere Phasen durchläuft. Wenngleich begrifflich zwischen Herrschaft und Hegemonie zu unterscheiden ist – herrschaftlich wird Macht direkt und mit weitaus mehr Zwang eingesetzt als unter einer Hegemonie, die die Souveränität des Gegenübers achtet – so muss sich jede neu errichtete Ordnung in einer Konsolidierungsphase bewähren. Bereits Triepel stellte 1938 fest, dass eine voll ausgebildete Hegemonie die Anerkennung der Untergebenen voraussetzt. Die Fähigkeit, Regeln und Ziele zu setzen, bezieht der Hegemon aus einer militärischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Überlegenheit, aber auch moralische Vorbildhaftigkeit kann integrierend und willensbrechend wirken. Hegemonie bedeutet aber letztlich immer Reziprozität, nicht Unterdrückung. Die geleistete Gefolgschaft muss durch Sicherheitsgewinne und wirtschaftliche Vorteile entlohnt werden, die es dem Untergebenen unbillig erscheinen lassen, sich aus der Hegemonie befreien zu wollen.
Aus dieser letzteren Definition heraus behauptet diese Arbeit, dass eine voll ausgereifte Hegemonie Spartas nach dem Peloponnesischen Krieg nicht bestand, sondern dass sie in der Konsolidierungsphase am Widerstand Thebens und Athens und an innenpolitischen Verwerfungen scheiterte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Grundzüge der Hegemonialpolitik Spartas bis 400
- Der persisch-spartanische Krieg als Vorbedingung allen Widerstands
- Formen des Widerstands
- Ausloten der Grenzen
- Der Korinthische Krieg als erneuter Befreiungsschlag der Griechen
- Der „Königsfrieden“ von 386 – Ein Triumph Spartas?
- Ursachen der Ressourcenknappheit
- Militärische Revolution
- Bevölkerungsrückgang
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Genese und dem Niedergang der Hegemonie Spartas zwischen 404 und 386 v. Chr. Sie analysiert die Voraussetzungen und Techniken, die notwendig sind, um einer Hegemonie Stabilität zu verleihen, anhand des Fallbeispiels der spartanischen Vormachtstellung nach dem Sieg im Peloponnesischen Krieg. Dabei wird die Frage untersucht, warum es nie zur Anerkennung Spartas als Führungsmacht kam und welche Ursachen zum Scheitern der Hegemonie führten.
- Die Hegemonialpolitik Spartas nach dem Peloponnesischen Krieg
- Die Bedeutung des persisch-spartanischen Krieges für den Widerstand gegen Sparta
- Die verschiedenen Formen des Widerstands gegen die spartanische Hegemonie
- Die Bewertung des Königsfriedens von 386 und dessen Auswirkungen auf Spartas Stellung im griechischen Machtgefüge
- Mögliche innenpolitische Ursachen für das Scheitern der spartanischen Hegemonie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet den Begriff der Hegemonie im historischen Kontext. Sie stellt die These auf, dass eine voll ausgebildete Hegemonie Spartas nicht bestand, sondern in der Konsolidierungsphase am Widerstand Thebens und Athens scheiterte. Kapitel 2 beleuchtet die Grundzüge der spartanischen Hegemonialpolitik, die Widerstand seitens der Bündner hervorrief. Kapitel 3 verortet den Konflikt zwischen Persien und Sparta um die Vorherrschaft in der Ägäis, der im Jahr 400 ausbrach. Kapitel 4 analysiert die verschiedenen Formen des Widerstands, die im Korinthischen Krieg von 395-386 kulminierten. Kapitel 5 bewertet den Königsfrieden von 386 und untersucht dessen Bedeutung für Spartas Stellung im griechischen Machtgefüge. Schließlich beleuchtet Kapitel 6 mögliche innenpolitische Ursachen für das Scheitern der spartanischen Hegemonie.
Schlüsselwörter
Hegemonie, Sparta, Peloponnesischer Krieg, Königsfrieden, Widerstand, Theben, Athen, Persien, Korinthischer Krieg, Ressourcenknappheit, militärische Revolution, Bevölkerungsrückgang.
- Quote paper
- Toni Jost (Author), 2006, Genese und Niedergang der Hegemonie Spartas 404-386 v. Chr., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80607