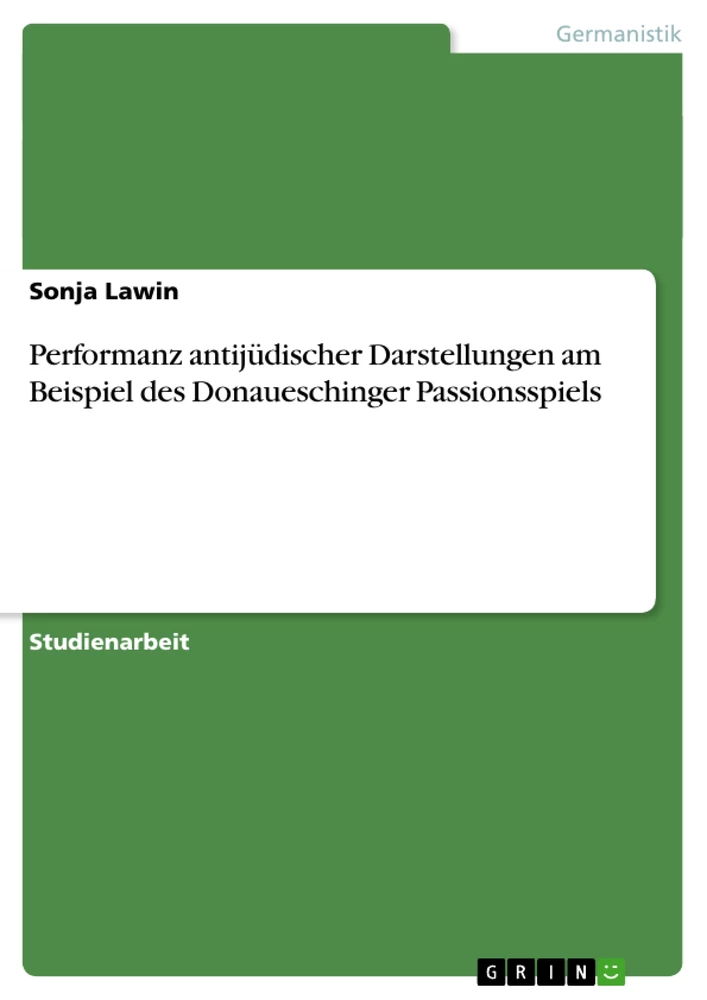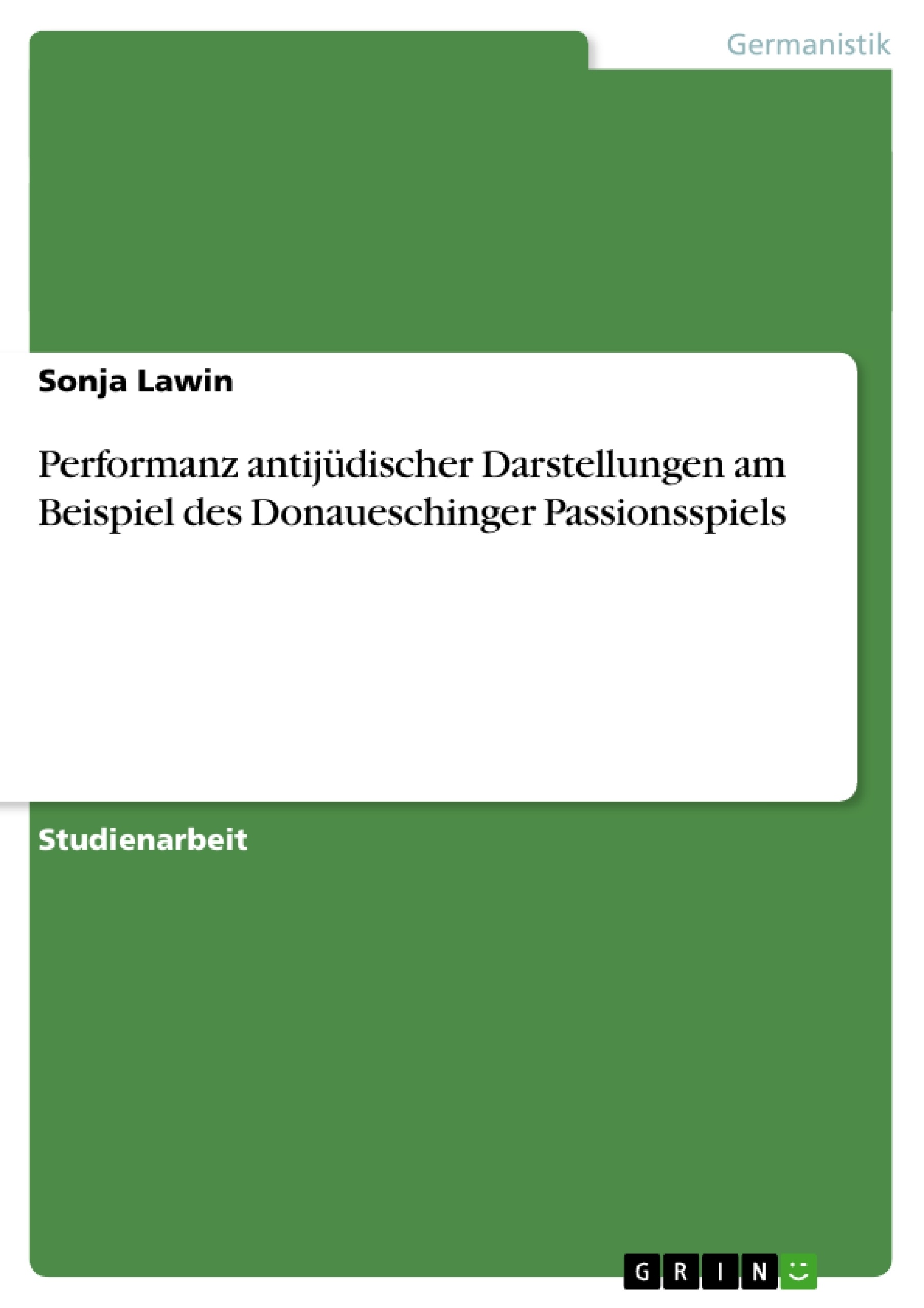Literarische Äußerungen erschaffen Situationen, auf die sie sich beziehen. In Jonathan Cullers „Literaturtheorie“ wird u.a. die Idee der amerikanischen Philosophin Judith Butler erläutert, die Identität als gesellschaftliches und kulturelles Ereignis bestimmt. Sie schlägt vor, Geschlechter als performativ anzusehen, d.h. nicht als gegeben, sondern als eine Handlung. Übertragen auf die Zuschreibung bestimmter Bilder auf eine Gruppe kann auch dieses Gruppenphänomen als eine Handlung aufgefasst werden. Mit Bezug auf die Judenbilder in Passionsspielen kann nun gefragt werden: Sind literarische Äußerungen also primär Aktivitäten, die durch Handlung erschaffen werden, oder sind sie nur Nachahmungen gewesener Zustände in Gesellschaftskontexten?
Gruppenidentitäten entstehen durch Abgrenzung zur Masse. Gruppen, denen eine negative Identität anhängt, erlangen diese durch das Urteil der Gesellschaft. Wie kommt es im Falle der Juden zu solch einem Massenurteil? Laut Lexikon „Religion in Geschichte und Gegenwart“ bilden die Passionsspiele im Mittelalter „... die Massenmedien ihrer Zeit, die über rel. Belehrungen hinaus auch die Soziogenese der stadtbürgerlichen Gemeinschaft unterstützen sollten.“ Speziell auf das Bild der Gruppe der Juden im Mittelalter projiziert, bedeutet dies, jenes wurde durch die Passionsspiele in die Gesellschaft getragen. Sollte das Donaueschinger Passionsspiel als literarische Äußerung Handlung sein und damit Realitäten geschaffen haben, könnte dies in sozialen, politischen und religiösen Bildern ablesbar sein. Bezogen auf die Gruppe der Juden soll hier gezeigt werden, welcher Bilder man sich in den Passionsspielen bedient.
Nach einer allgemeinen Darstellung der Passionsspiele werden in der vorliegenden Arbeit am speziellen Fall des Donaueschinger Passionsspiels einzelne Judenbilder des Mittelalters herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung, Blütezeit und Zentren der Passionsspiele des Mittelalters
- Die Entstehung der Passionsspiele im Mittelalter
- Das Donaueschinger Passionsspiel und die Rolle der Juden darin
- Die Judenbilder in einzelnen Szenen des Donaueschinger Passionsspiels
- Das Bild des Fremden
- Das Bild vom Ungläubigen
- Das Bild vom Separierer und Wucherer
- Das Bild vom Blinden
- Das Bild des ewig Diskutierenden und des Sünders
- Das Bild vom wahren christlichen Dominanzanspruch
- Das Bild von der Unzulänglichkeit der jüdischen Lehre
- Das Bild vom Sünder
- Das Bild vom ewig Leugnenden
- Das Bild vom Wucherer
- Das Bild von der Weltverschwörung
- Das Bild vom Gottesmörder
- Das Bild des Feigen und Blinden in der Finsternis
- Das Bild des Gewalttätigen und Hinterhältigen
- Das Bild von der alleinigen Schuld am Tod Jesu
- Das Bild von Judea als Vertreterin des jüdischen Glaubens
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die antijüdischen Darstellungen im Donaueschinger Passionsspiel des Mittelalters und analysiert, wie diese Bilder die Wahrnehmung der jüdischen Gruppe in der damaligen Gesellschaft prägten. Die Arbeit verfolgt dabei das Ziel, die Entstehung und Entwicklung antijüdischer Stereotype im Kontext des mittelalterlichen Passionsspiels aufzuzeigen und zu beleuchten, wie diese Stereotype zur Konstruktion einer negativen Identität der Juden beitrugen.
- Die Entstehung und Entwicklung der Passionsspiele im Mittelalter
- Die Rolle des Donaueschinger Passionsspiels im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft
- Die spezifischen antijüdischen Bilder im Donaueschinger Passionsspiel
- Die Konstruktion der jüdischen Identität durch die Passionsspiele
- Der Einfluss antijüdischer Stereotype auf die soziale Wahrnehmung der Juden im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den konzeptionellen Rahmen der Arbeit dar und beleuchtet die Relevanz der performativen Aspekte antijüdischer Darstellungen in mittelalterlichen Passionsspielen. Kapitel 2 befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Passionsspiele im Mittelalter, mit besonderem Fokus auf das Donaueschinger Passionsspiel und die Rolle der Juden darin. Kapitel 3 analysiert die antijüdischen Bilder in einzelnen Szenen des Donaueschinger Passionsspiels und beleuchtet die stereotypen Zuschreibungen an die jüdische Gruppe.
Schlüsselwörter
Passionsspiele, Mittelalter, Antijudaismus, Judenbilder, Stereotype, Donaueschinger Passionsspiel, Fremdheit, Unglaube, Separation, Wucher, Schuld, Gottesmörder, Weltverschwörung, Performanz, Identität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Donaueschinger Passionsspiel?
Es ist ein bedeutendes geistliches Spiel des Mittelalters, das das Leiden Christi darstellt und gleichzeitig gesellschaftliche und religiöse Vorstellungen seiner Zeit widerspiegelt.
Welche antijüdischen Bilder werden in dem Spiel vermittelt?
Die Arbeit identifiziert Stereotype wie den "ewig Ungläubigen", den "Wucherer", den "Gottesmörder" und den "Hinterhältigen", die den Juden zugeschrieben wurden.
Was bedeutet "Performanz" in diesem Kontext?
Performanz bezieht sich darauf, dass diese literarischen Darstellungen nicht nur Nachahmungen waren, sondern durch die Aufführung soziale Realitäten und Gruppenidentitäten erst erschufen.
Warum waren Passionsspiele "Massenmedien" des Mittelalters?
Sie dienten der religiösen Belehrung der breiten Bevölkerung und unterstützten die Soziogenese der stadtbürgerlichen Gemeinschaft durch Abgrenzung gegenüber den Juden.
Wer ist "Judea" in dem Passionsspiel?
Judea fungiert als allegorische Vertreterin des jüdischen Glaubens, die oft im Kontrast zur christlichen Kirche (Ecclesia) negativ dargestellt wird.
Welchen Einfluss hatten diese Spiele auf das reale Leben der Juden?
Durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien und Feindbildern trugen sie maßgeblich zur Ausgrenzung und Verfolgung der jüdischen Minderheit bei.
- Arbeit zitieren
- Sonja Lawin (Autor:in), 2006, Performanz antijüdischer Darstellungen am Beispiel des Donaueschinger Passionsspiels, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80619