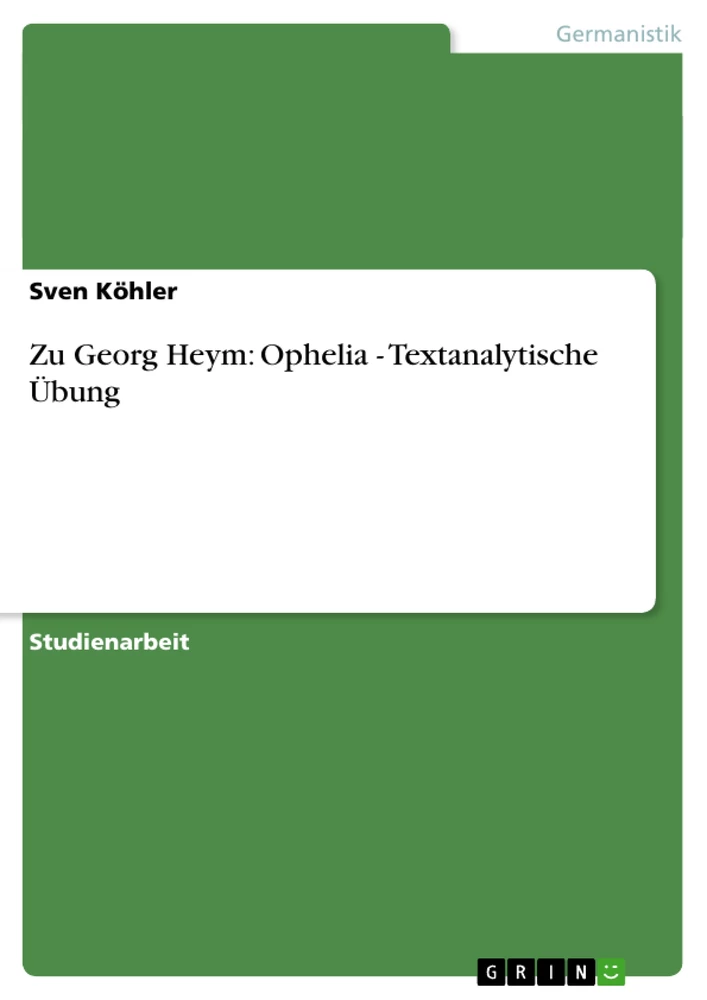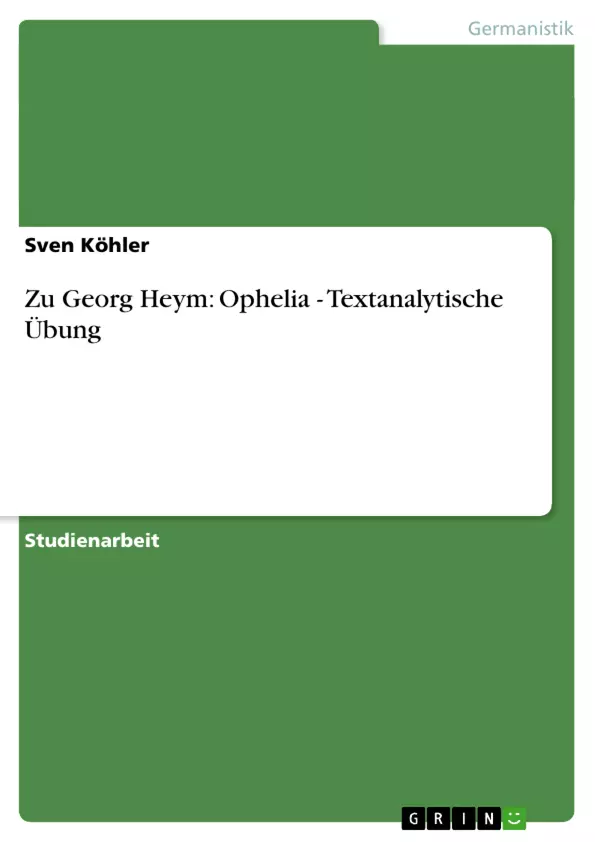Die vorliegende Arbeit soll GEORG HEYMS Gedicht OPHELIA nach den Kategorien der formalen Gedichtanalyse beschreiben und erläutern. Dies geschieht unter Berücksichtigung des Paratextes HAMLET von WILLIAM SHAKESPEARE. Wie sich an späterer Stelle zeigen wird, hat jener Text eine wesentliche Funktion für das vorliegende Werk. Eventuell vorstellbare Analogien zwischen beiden Werken sollen aufgezeigt, in ihrer Wirkung beurteilt und schließlich das Für und Wider abgewogen werden. Weiterhin werden die im Verlaufe dieser Arbeit näher beschriebenen Oppositionsbildungen innerhalb der OPHELIA näher untersucht. Abschließend soll eine Zusammenfassung zeigen, welche Charakteristika das Werk HEYMS prägen und wie sich deren Wirkung gestaltet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1 Aufbau
- 2 Kommunikationsstrukturen
- 2.1 Perspektive
- 2.1.1 Textsubjekt und erste Person
- 2.1.2 Die zweite Person
- 2.1.3 Die dritte Person
- 2.2 Zeit
- 2.3 Raum
- 2.1 Perspektive
- 3 Metrische Analyse
- 3.1 Versform
- 3.2 Reimschema
- 3.3 VERSENDEN
- 4 Syntaktische Analyse
- 5 Rhetorische Analyse
- 5.1 Der Fluss
- 5.2 Die Tiere
- 5.3 Die Farben
- 5.4 Die Wasserleiche
- 5.5 Die Stadt
- 5.6 Die Naturlandschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Georg Heyms Gedicht "Ophelia" unter Berücksichtigung von Shakespeares Hamlet. Ziel ist die Beschreibung und Erläuterung des Gedichts anhand formaler Kategorien der Gedichtanalyse. Dabei werden Analogien zwischen beiden Werken untersucht und Oppositionsbildungen innerhalb des Heymschen Werks näher beleuchtet. Abschließend soll charakteristische Merkmale des Gedichts und deren Wirkung zusammengefasst werden.
- Formale Analyse von Heyms "Ophelia"
- Vergleich mit Shakespeares "Hamlet"
- Identifizierung von Oppositionsbildungen im Gedicht
- Analyse der Wirkung der stilistischen Mittel
- Charakterisierung der Merkmale von Heyms Werk
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Zweck der Arbeit: die formale Gedichtanalyse von Georg Heyms "Ophelia" unter Berücksichtigung von Shakespeares "Hamlet". Es wird die Bedeutung des Paratextes "Hamlet" hervorgehoben und die Absicht angekündigt, Analogien zwischen den beiden Werken aufzuzeigen und deren Wirkung zu beurteilen. Schließlich soll eine Zusammenfassung die Charakteristika und die Wirkung des Heymschen Werkes darstellen. Die Arbeit kündigt eine Analyse der Oppositionsbildungen innerhalb des Gedichts an.
II. Hauptteil - 1 Aufbau: Der Aufbau des Gedichts wird analysiert. Die zwölf Strophen, bestehend aus 48 Versen, werden in zwei Abschnitte geteilt. Die erste Hälfte beschreibt Ophelias Drift durch eine natürliche Umgebung, die zweite Hälfte zeigt eine aktivere Bewegung des Leichnams durch ländliche und städtische Landschaften. Die formale Struktur, besonders die vierzeiligen Strophen, wird betrachtet, wobei die Diskrepanz zwischen äußerem und innerem Aufbau, sprich die Überspielung der strophischen Gliederung durch inhaltliche Zusammenhänge über Strophengrenzen hinweg, als erstes Indiz für eine Entfremdung vom literarischen Vorbild interpretiert wird. Dies deutet auf eine Oppositionsbildung auf motivischer Ebene hin.
II. Hauptteil - 2 Kommunikationsstrukturen: Dieser Abschnitt untersucht die Kommunikationsstrukturen des Gedichts im Kontext zu Shakespeares "Hamlet". Die Rezeption von Heyms "Ophelia" wird als ein ständiger Vergleich mit Shakespeares Werk interpretiert. Es werden Stellen analysiert, an denen Analogien zwischen beiden Werken existieren, und es werden Argumente für und gegen eine solche Parallele diskutiert.
Schlüsselwörter
Georg Heym, Ophelia, Hamlet, Gedichtanalyse, formale Analyse, Kommunikationsstrukturen, Perspektive, Zeit, Raum, Metrik, Syntax, Rhetorik, Oppositionsbildungen, Paratext, literarische Vorläufer, Analogien.
Häufig gestellte Fragen zur Gedichtanalyse von Georg Heyms "Ophelia"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Georg Heyms Gedicht "Ophelia" unter Berücksichtigung von Shakespeares Hamlet. Der Fokus liegt auf einer formalen Gedichtanalyse, die den Aufbau, die Kommunikationsstrukturen, die Metrik, die Syntax und die rhetorischen Mittel untersucht. Dabei werden Analogien zu Shakespeares Werk und Oppositionsbildungen innerhalb von Heyms Gedicht untersucht.
Welche Aspekte von Heyms "Ophelia" werden analysiert?
Die Analyse umfasst verschiedene Ebenen: den Aufbau des Gedichts (Anzahl der Strophen, Verse, Zweiteilung des Inhalts), die Kommunikationsstrukturen (Perspektive, Zeit, Raum), die Metrik (Versform, Reimschema), die Syntax und die Rhetorik (Stilmittel, Motive wie Fluss, Tiere, Farben, Wasserleiche, Stadt, Naturlandschaft). Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich mit Shakespeares Hamlet und der Identifizierung von Analogien und Oppositionen.
Wie ist der Aufbau der Analyse?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Fazit (implizit durch die Zusammenfassung der Kapitel und die Schlussfolgerung über die Merkmale und Wirkung des Gedichts). Der Hauptteil analysiert den Aufbau des Gedichts, die Kommunikationsstrukturen im Vergleich zu Hamlet, die Metrische Analyse, die Syntaktische Analyse und die Rhetorische Analyse, wobei die einzelnen Aspekte eng miteinander verwoben sind.
Welche Rolle spielt Shakespeares "Hamlet" in der Analyse?
Shakespeares "Hamlet" dient als wichtiger Bezugspunkt. Die Arbeit untersucht Analogien und Unterschiede zwischen Heyms "Ophelia" und Shakespeares Werk. Die Rezeption von Heyms Gedicht wird als ein ständiger Vergleich mit Shakespeares "Hamlet" interpretiert, wobei sowohl Übereinstimmungen als auch Abweichungen analysiert werden.
Welche Ziele verfolgt die Analyse?
Die Analyse zielt darauf ab, die formalen Strukturen von Heyms "Ophelia" zu beschreiben und zu erläutern. Sie untersucht den Einfluss von Shakespeares "Hamlet" und identifiziert Oppositionsbildungen innerhalb des Gedichts. Letztlich soll die Wirkung der stilistischen Mittel und die charakteristischen Merkmale von Heyms Werk zusammengefasst werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Georg Heym, Ophelia, Hamlet, Gedichtanalyse, formale Analyse, Kommunikationsstrukturen, Perspektive, Zeit, Raum, Metrik, Syntax, Rhetorik, Oppositionsbildungen, Paratext, literarische Vorläufer, Analogien.
Wie ist der Aufbau des Gedichts in der Analyse beschrieben?
Das Gedicht besteht aus zwölf Strophen mit jeweils vier Versen (insgesamt 48 Verse). Es wird in zwei Hälften geteilt: die erste beschreibt Ophelias Drift durch die Natur, die zweite zeigt eine aktivere Bewegung des Leichnams durch ländliche und städtische Landschaften. Die Diskrepanz zwischen äußerem und innerem Aufbau wird als Indiz für eine Entfremdung vom literarischen Vorbild interpretiert.
Welche Kommunikationsstrukturen werden analysiert?
Die Analyse der Kommunikationsstrukturen betrachtet die Perspektive (Erzähler, Subjekt), die Zeit und den Raum im Gedicht und vergleicht diese mit den entsprechenden Aspekten in Shakespeares "Hamlet". Die Rezeption von Heyms "Ophelia" wird als ständiger Vergleich mit Shakespeares Werk interpretiert.
- Quote paper
- Sven Köhler (Author), 2005, Zu Georg Heym: Ophelia - Textanalytische Übung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80667