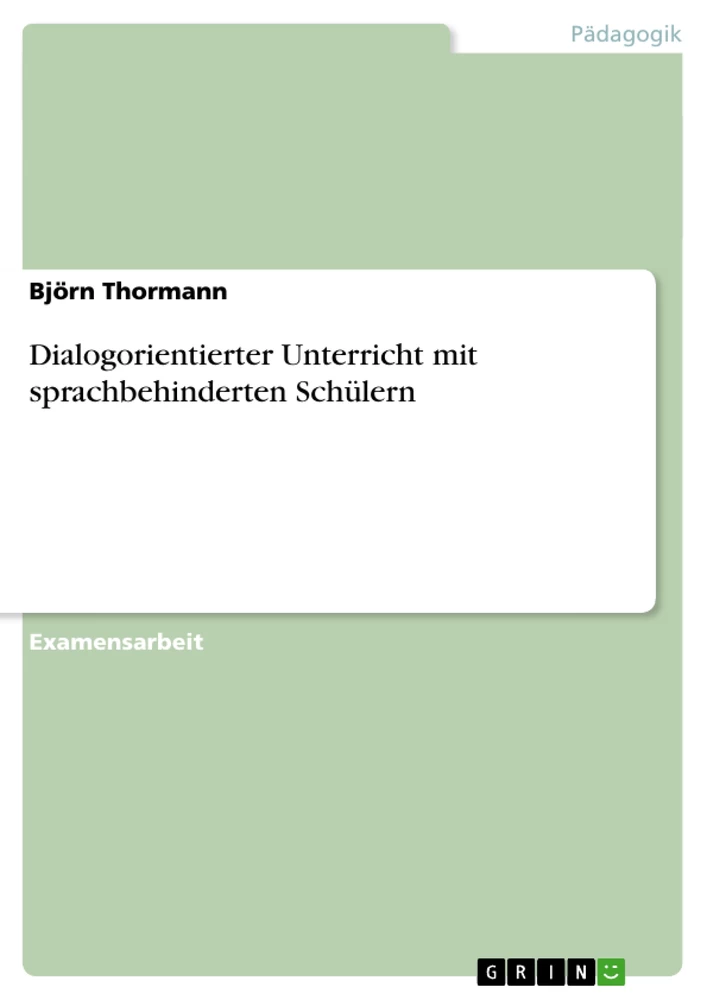In den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zum Förderschwerpunkt Sprache, die am 26.06.1998 beschlossen wurden, wird das Recht der sprachbehinderten Kinder und Jugendlichen auf eine schulische Bildung und Erziehung, die ihren jeweiligen persönlichen Möglichkeiten entspricht, als vordringlichstes Ziel und damit Aufgabe der Sonderpädagogischen Förderung festgestellt. Weiter heißt es wörtlich: "Es soll erreicht werden, daß die Kinder und Jugendlichen über einen dialoggerichteten Gebrauch Sprache aufbauen und ausgestalten, diese in Bewährungssituationen anwenden, sich als kommunikationsfähig erleben und lernen, mit sprachlichen Beeinträchtigungen und deren Auswirkungen umzugehen" (KMK 1998).
Um das Ziel einer bestmöglichen Förderung verwirklichen zu können, sollen die Lehrer in der Erziehung und beim Unterricht folgende von der Kultusministerkonferenz vorgegebene Prinzipien berücksichtigen:
"Erziehung und Unterricht zielen auf den Erwerb von Wissen, die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten unter erschwerten sprachlichen Bedingungen sowie den Aufbau von Einstellungen und Haltungen. Die Förderbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler machen eine spezifische Gestaltung der Erziehungs- und Unterrichtsangebote notwendig. Es müssen insbesondere kommunikationsförderliche Erziehungs- und Unterrichtsangebote und -zusammenhänge hergestellt werden, in denen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Fähigkeiten und Neigungen, mit ihren Motiven, Fragen und Zielvorstellungen als handelnde Personen erleben und begegnen sowie Interesse an der Weiterentwicklung ihrer sprachlichen Handlungskompetenzen aufbauen können" (KMK 1998).
Wird dem Lehrer mit dem Hinweis, seinen Unterricht kommunikationsfördernd zu gestalten, eine Möglichkeit angeboten, um seine Stunden effektiver durchzuführen? Oder erfordert der Dialog mit den Schülern vom Lehrer mehr als sich nur methodisch darauf einzulassen? Warum empfiehlt überhaupt die Kultusministerkonferenz einen dialoggerichteten Unterricht bei sprachbehinderten Schülern?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- PROLOG
- I. Ausgangspunkt
- II. Entwicklung einer kommunikationstheoretischen Sichtweise auf Sprachbehinderungen
- III. Gliederung und Themenschwerpunkte
- 1. FRIEDEMANN SCHULZ VON THUN UND DIE GRUNDLAGEN DER KOMMUNIKATION
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Die Nachricht
- 1.3 Der Sender und das Nachrichtenquadrat
- 1.4 Der Empfänger und die „vier Ohren“
- 1.5 Das Feedback
- 1.6 Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation
- 1.7 Kommunikation ist Interaktion
- 1.8 Die explizite Metakommunikation hilft bei Störungen
- 1.9 Resümee
- 2. PAULO FREIRE UND DER DIALOGISCHE UNTERRICHT
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Das „Bankiers-Konzept der Erziehung“
- 2.3 Pädagogik der Unterdrückten
- 2.3.1 Problemformulierende Bildungsarbeit
- 2.3.2 Dialogisches Lernen
- 2.4 Resümee
- 3. RUTH C. COHN UND DAS „LEBENDIGE LERNEN“: DIE THEMENZENTRIERTE INTERAKTION (TZI)
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Grundlagen der Themenzentrierten Interaktion
- 3.2.1 Die Axiome
- 3.2.2 Die Postulate
- 3.2.3 Das Strukturmodell
- 3.2.4 Die Hilfsregeln
- 3.3 Die Themenzentrierte Interaktion in der Schule
- 3.4 Resümee
- 4. THOMAS GORDON UND DE METHODEN ZUR KONFLIKTLÖSUNG
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Lehrer-Schüler-Beziehung
- 4.3 Wer hat das Problem?
- 4.3.1 Der Schüler hat das Problem: das „aktive Zuhören“
- 4.3.2 Der Lehrer hat das Problem: die Ich-Botschaft
- 4.3.3 Schüler und Lehrer haben ein Problem: Konfliktlösung ohne Niederlage
- 4.4 Resümee
- EPILOG
- LITERATUR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Umsetzung eines dialogorientierten Unterrichtskonzepts im Kontext der Sprachbehindertenpädagogik. Sie analysiert die Bedeutung von Kommunikation und Interaktion für den Lernerfolg von sprachbehinderten Schülern und diskutiert verschiedene Ansätze zur Förderung einer gelingenden Kommunikation im Unterricht.
- Kommunikationstheoretische Grundlagen der Sprachbehinderung
- Die Rolle des Dialogs im Unterricht für sprachbehinderte Schüler
- Verschiedene Ansätze zur Förderung der Kommunikation im Unterricht
- Praxisbezogene Beispiele und Anwendungsbeispiele für dialogorientierten Unterricht
- Die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für den Lernerfolg
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Ausgangspunkt: Dieses Kapitel stellt die aktuelle Situation der Sprachbehindertenpädagogik in den Kontext der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vor. Die Notwendigkeit eines dialogorientierten Unterrichts wird anhand von aktuellen Bildungsrichtlinien erläutert.
- II. Entwicklung einer kommunikationstheoretischen Sichtweise auf Sprachbehinderungen: Der Fokus liegt hier auf der Veränderung des Verständnisses von Sprachbehinderungen. Es wird deutlich, dass Sprachbehinderungen nicht als ein Defizit der Sprache selbst, sondern als Störung der Kommunikation betrachtet werden sollten.
- 1. FRIEDEMANN SCHULZ VON THUN UND DIE GRUNDLAGEN DER KOMMUNIKATION: Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Kommunikationstheorie von Friedemann Schulz von Thun. Es werden die zentralen Elemente wie Nachricht, Sender, Empfänger und Feedback erläutert, sowie die "vier Ohren" des Empfängers als zentrale Konzepte dargestellt.
- 2. PAULO FREIRE UND DER DIALOGISCHE UNTERRICHT: Das Kapitel beleuchtet den Ansatz der "Pädagogik der Unterdrückten" von Paulo Freire und zeigt, wie dialogisches Lernen zum Empowerment von Lernenden beitragen kann.
- 3. RUTH C. COHN UND DAS „LEBENDIGE LERNEN“: DIE THEMENZENTRIERTE INTERAKTION (TZI): Dieses Kapitel stellt die Grundlagen und Prinzipien der Themenzentrierten Interaktion (TZI) von Ruth C. Cohn vor. Es wird die Anwendung der TZI in der Schule als Instrument zur Förderung von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung im Lernprozess beschrieben.
- 4. THOMAS GORDON UND DE METHODEN ZUR KONFLIKTLÖSUNG: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Methoden der Konfliktlösung nach Thomas Gordon. Es werden verschiedene Techniken wie "aktives Zuhören" und "Ich-Botschaften" vorgestellt, die zur Deeskalation von Konflikten im Lehrer-Schüler-Kontext beitragen können.
Schlüsselwörter
Dialogorientierter Unterricht, Sprachbehinderte Schüler, Kommunikationstheorie, Interaktion, Themenzentrierte Interaktion (TZI), Konfliktlösung, "aktives Zuhören", "Ich-Botschaften", Pädagogik der Unterdrückten, Empowerment, Förderung, Lehrer-Schüler-Beziehung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dialogorientiertem Unterricht?
Es ist ein Unterrichtskonzept, das auf Kommunikation und Interaktion basiert, um Schülern – insbesondere solchen mit Sprachbehinderungen – eine aktive Teilhabe und Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt Friedemann Schulz von Thun in diesem Kontext?
Sein Modell der "vier Ohren" und des Nachrichtenquadrats hilft Lehrern, Kommunikationsstörungen zu verstehen und die Qualität der Interaktion im Unterricht zu verbessern.
Was ist das Ziel der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach Ruth C. Cohn?
TZI zielt auf "lebendiges Lernen" ab, bei dem die Balance zwischen dem Individuum, der Gruppe und dem Thema (Ich-Wir-Es) im Zentrum steht.
Wie helfen die Methoden von Thomas Gordon Lehrkräften?
Durch Techniken wie "aktives Zuhören" und "Ich-Botschaften" können Konflikte in der Lehrer-Schüler-Beziehung ohne "Niederlage" gelöst werden.
Warum ist Dialog für sprachbehinderte Kinder besonders wichtig?
Sprachbehinderung wird hier als Kommunikationsstörung begriffen. Der Dialog ermöglicht es den Schülern, sich als kommunikationsfähig zu erleben und Ängste abzubauen.
- Arbeit zitieren
- Björn Thormann (Autor:in), 2002, Dialogorientierter Unterricht mit sprachbehinderten Schülern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8069