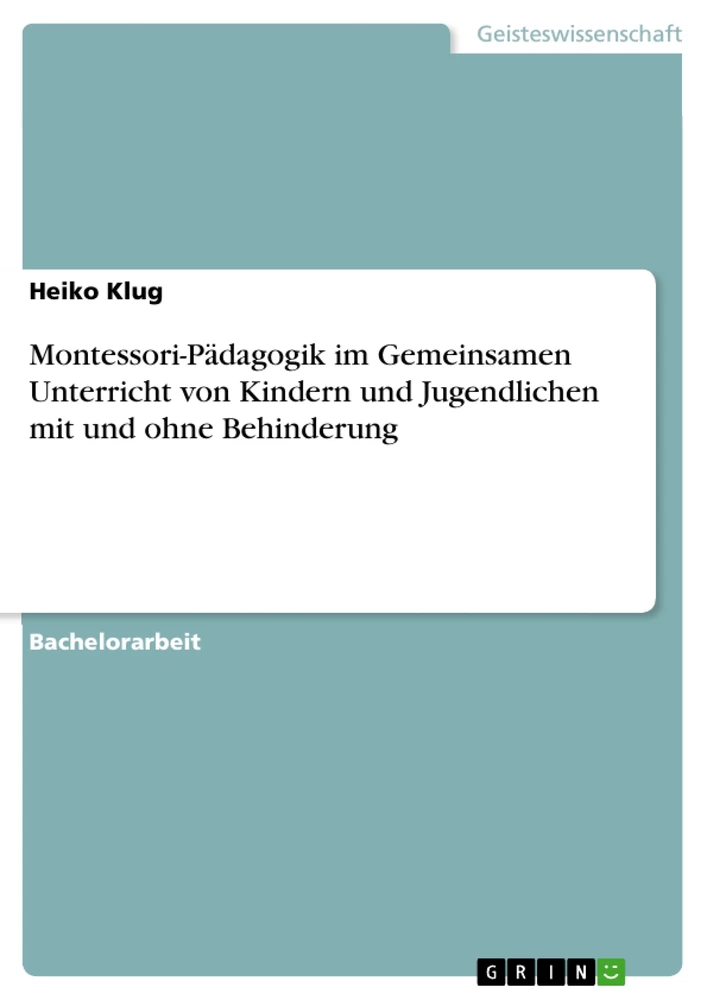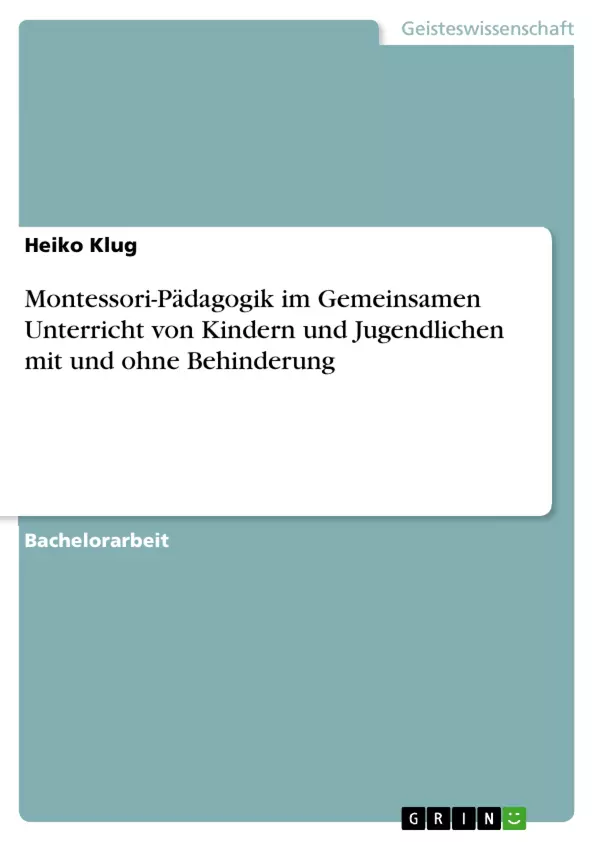Der Wunsch, mich ausführlicher mit der Thematik der Montessori-Pädagogik zu befassen, entstand bei einem Besuch der integrativen Montessori Kindertagesstätte St. Martin in Gießen. Da ich meine Kindergarten- und Schulsozialisation in reinen Regeleinrichtungen erlebte, waren die Erfahrungen, die ich dort im Rahmen eines Praktikums machte, sehr überraschend. Ich muss dazu sagen, dass ich zuvor nie etwas von einer „integrativen Pädagogik“ gehört hatte; die Montessori-Pädagogik war mir ebenfalls fremd. So haben mich allein die Räumlichkeiten in dieser Institution beeindruckt. Auf der ersten und zweiten Etage gibt es zwei Gruppen mit jeweils bis zu fünf so genannten „Integrativkindern“ mit und etwa zehn Kindern ohne Behinderung. Im zweiten Stock befindet sich ein Raum für Logopädie, eine Bücherei mit kindgerechter EDV- Ausstattung, ein Ergotherapieraum, eine kleine Werkstatt und sämtliche Orffinstrumente zur musikalischen Früherziehung. Der Flur wird ebenfalls als pädagogischer Raum genutzt, um beispielsweise eine Murmelbahn zu bauen. Im Keller befinden sich: die Küche, ein großer Bewegungsraum und schließlich das Atrium. Die von Montessori so genannte „Übungskirche“ für Kinder wird als Einübung in liturgische Kenntnisse, Fertigkeiten und in Haltungen gebraucht.
Die Kinder haben Zugang zu allem, sie kommen also auch in Kontakt mit dem Küchen- und Reinigungspersonal. Der Tagesablauf ist strukturiert. In freien Phasen lässt sich beobachten, wie die Kinder sich selbst beschäftigen und sich auch selber profilieren, in dem sie jüngeren Kindern helfen. Denn „nur wer hilft, wird selbständig“ (Hellbrügge 2002: 326). Es ist erstaunlich zu sehen, wie ein Kind seinem Freund hilft das Sauerstoffgerät auf den Hof zu tragen. Was für ein Gewinn, wenn Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung durch Spiel-, Lern-, und Lebenserfahrungen gar nicht erst entstehen.
Durch das gemeinsame Tischgebet wird offensichtlich, dass auf jeden Punkt im Tagesablauf großen Wert gelegt wird. Nachmittags kommen die ehemaligen Kindergartenkinder von der Schule zur Nachmittagsbetreuung und erfahren so Integration über die Jahre im Kindergarten hinaus.
Nachdem das Praktikum abgeschlossen war, wuchs in mir der Wunsch, zu erfahren wie die Montessori-Pädagogik in der Schule umgesetzt würde. Das im Januar diesen Jahres gefeierte 100-jährige Jubiläum bedeutete für mich einen zusätzlichen Anreiz, mich mit der Thematik „Montessori-Schule“ näher auseinanderzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Klärungen
- Der Begriff „Behinderung“
- Zum Begriff „Integration“
- Gemeinsamer Unterricht in der Schule
- Integrationsentwicklung in Deutschland
- Zum aktuellen Stand des gemeinsamen Lernens
- Integrative Schule – auf dem Weg zu einer „Schule für Alle“?
- Pädagogisch-didaktische Prinzipien der integrationsfähigen Grundschule
- Montessori-Pädagogik im Gemeinsamen Unterricht
- Vorzüge der Montessori-Pädagogik für den Gemeinsamen Unterricht
- Montessori-Arbeit in Grundschule und Sekundarstufe
- Montessori-Pädagogik und Gehirnforschung
- Schulische Konzepte und Erfahrungsberichte
- Erfahrungen aus einer Montessori-Grundschule
- Montessori-Pädagogik in der weiterführenden Schule
- Montessoris Idee einer Jugendschule des sozialen Lebens
- Möglichkeiten der Umsetzung des Erdkinderplans
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Montessori-Pädagogik im Gemeinsamen Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Ziel ist es, die Anwendbarkeit und Wirksamkeit der Montessori-Pädagogik in diesem Kontext zu untersuchen.
- Begriffliche Klärung der Begriffe „Behinderung“ und „Integration“
- Entwicklung des Gemeinsamen Unterrichts in Deutschland
- Pädagogisch-didaktische Prinzipien der integrationsfähigen Grundschule
- Vorzüge der Montessori-Pädagogik für den Gemeinsamen Unterricht
- Zusammenhang zwischen Montessori-Pädagogik und Gehirnforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert den Entstehungskontext der Arbeit. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe „Behinderung“ und „Integration“ im Kontext der Arbeit geklärt. Das dritte Kapitel stellt die Geschichte und den aktuellen Stand des Gemeinsamen Unterrichts in Deutschland dar, fokussiert sich auf die Herausforderungen und Chancen der Integration und beschreibt die pädagogisch-didaktischen Prinzipien der integrationsfähigen Grundschule. Das vierte Kapitel behandelt die Montessori-Pädagogik im Kontext des Gemeinsamen Unterrichts, erläutert deren Vorzüge und beleuchtet die Parallelen zwischen den Erkenntnissen Montessoris und der modernen Gehirnforschung. Im fünften Kapitel werden schulische Konzepte und Erfahrungsberichte aus einer Montessori-Grundschule sowie einer weiterführenden Schule vorgestellt, die die Montessori-Pädagogik in der Praxis erfahrbar machen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind Montessori-Pädagogik, Gemeinsamer Unterricht, Integration, Inklusion, Behinderung, Sensible Phasen, Vorbereitete Umgebung, Freiarbeit, Selbstständigkeit, Gehirnforschung, Differenzierung, Individualisierung, Schulische Konzepte, Erfahrungsberichte, Erdkinderplan.
- Quote paper
- Heiko Klug (Author), 2007, Montessori-Pädagogik im Gemeinsamen Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80690