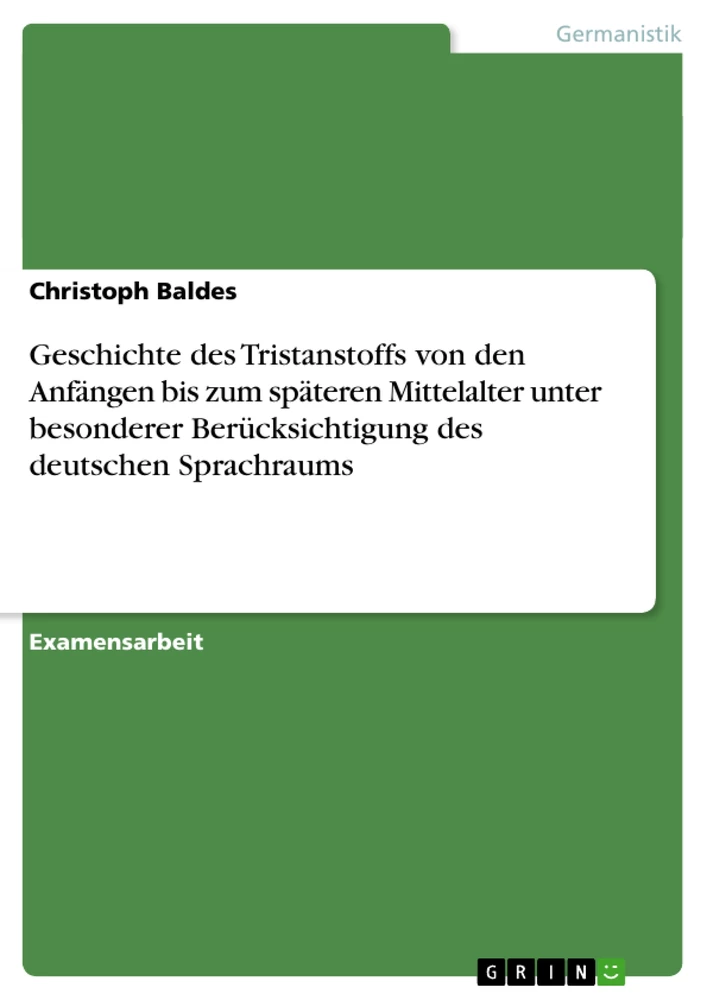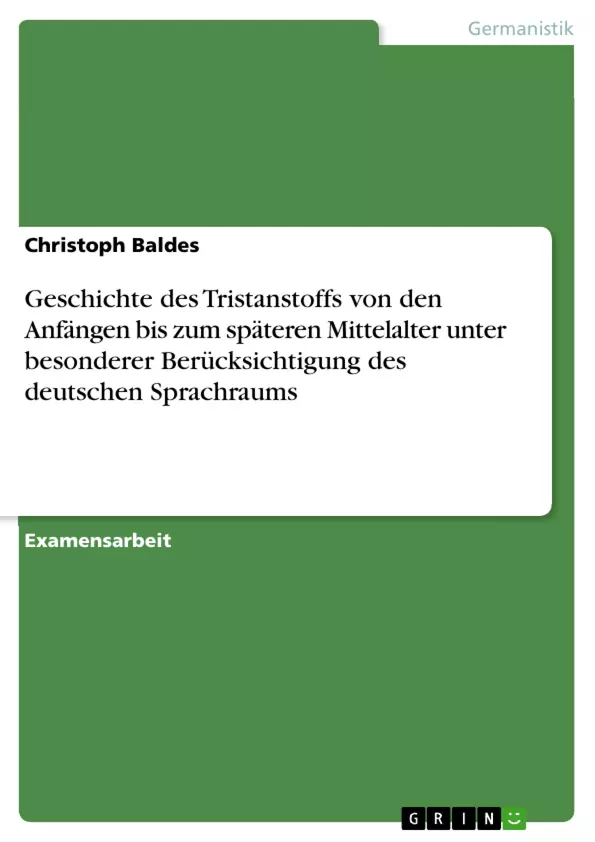Mit den Namen von Tristan und Isolde verbindet man in erster Linie die Geschichte von der Allgewalt der Liebe in ihrer „Absolutheit und Totalität“. Diese Charakterisierung ist in ihrer Einfachheit richtig, da hier ohne Frage der Hauptaspekt der Tristansage benannt wird. Der Komplexität des Stoffs genügt sie jedoch nicht, denn der Stoff bietet über die Liebesthematik hinaus eine Vielzahl von Facetten, die im Laufe der Entwicklung in Abhängigkeit des sozialen, kulturellen und theologischen Denkens der jeweiligen Zeit eine unterschiedlich starke Ausprägung erfahren und zum Teil sogar unterschiedlich interpretiert werden. Und obwohl den meisten Bearbeitern der Versuch gemeinsam sein dürfte, die Geschichte in „gewohnte Bahnen und Denkformen“ zu lenken, erfährt der Stoff doch die unterschiedlichsten Ausprägungen, so dass er im Laufe seiner Entwicklung sowohl unter den Bearbeitern als auch unter den Rezipienten für „heillose Verwirrung“ gesorgt hat. Diese Arbeit beleuchtet die Entwicklungen und Veränderungen des Stoffs, die mit den verschiedenen Bearbeitungen der Sage einhergehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hinführung zum Thema
- 1.2 Zeitliche und räumliche Abgrenzungen
- 1.3 Vorgehensweise und Schwerpunktsetzung
- 2. Der erste Tristanroman und seine Ursprünge
- 2.1 Der keltische, Urtristan'
- 2.1.1 Die historischen Grundlagen des Stoffs
- 2.1.2 Die Struktur der ersten Tristandichtung
- 2.1.3 Der, Tochmarc Emire' als mögliche Quelle des Stoffs
- 2.1.4 Die Sage von Dhiarmuda und Ghráinne als weitere mögliche Quelle des Stoffs
- 2.1.5 Weitere mögliche Grundlagen der ersten Tristandichtung
- 2.1.6 Die zeitliche Einordnung des keltischen, Urtristan'
- 2.2 Das, Älteste Epos'
- 2.2.1 Die wesentlichen Neuerungen des, Ältesten Epos'
- 2.2.2 Das Leben der Liebenden
- 2.2.3 Das Ende des ‚Ältesten Epos'
- 2.2.4 Zum Stil des, Ältesten Epos'
- 2.2.5 Der Entstehungskontext des‚Ältesten Epos'
- 2.3 Die,Estoire'
- 2.3.1 Die Einbettung des Tristanstoffs in einen biographischen Rahmen
- 2.3.2 Veränderungen im ursprünglichen Handlungsgerüst
- 2.3.3 Die,,Fortsetzung“: König Artus und Isolde Weißhand
- 2.3.4 Zur Veränderung der Konzeption des Stoffs
- 2.3.5 Die Frage nach der Verfasserschaft
- 2.3.6 Entstehungsumfeld und Wirkung der, Estoire'
- 2.4 Alternative Entstehungstheorien I: Orientalischer Ursprung
- 2.4.1 Wis und Râmîn
- 2.4.2 Verbindungen zwischen Orient und Okzident
- 2.4.3 Wertung der orientalischen Ursprungstheorie
- 2.5 Alternative Entstehungstheorien II: Germanischer Ursprung
- 2.5.1 Parallelen zwischen der germanischen Sagenwelt und dem Tristanstoff
- 2.5.2 Wertung der germanischen Ursprungstheorie
- 3. Die deutschen Tristanbearbeitungen
- 3.1 Eilhart von Oberg
- 3.1.1 Überlegungen zur Datierung
- 3.1.2 Der Dichter und sein Auftraggeber
- 3.1.3 Die Entstehung zweier Überlieferungstraditionen
- 3.1.4 Die literarhistorische Einordnung des, Tristrant' – inhaltliche Aspekte
- 3.1.5 Die literarhistorische Einordnung des, Tristrant' – formale Aspekte
- 3.1.6 Abschließende Zusammenfassung und Wertung von Eilharts Werk
- 3.2 Gottfried von Straßburg
- 3.2.1 Der Entstehungskontext des, Tristan'
- 3.2.2 Hypothesen über Gottfrieds Quellen
- 3.2.3 Strukturelle Veränderungen des Stoffs
- 3.2.4 Gottfrieds Präsentation des Stoffs
- 3.2.5 Deutungsansätze zu Gottfrieds Werk
- 3.3 Die Fortsetzer Gottfrieds
- 3.3.1 Ulrich von Türheim
- 3.3.2 Heinrich von Freiberg
- 3.4 Weitere deutschsprachige Bearbeitungen
- 3.4.1 , Tristan als Mönch'
- 3.4.2 Das, Niederdeutsche Tristanfragment'
- 3.4.3 Die Prosaromane
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte des Tristanstoffs von seinen Anfängen bis zum späten Mittelalter, mit besonderem Fokus auf den deutschen Sprachraum. Ziel ist es, die Entwicklung des Stoffes nachzuvollziehen, die verschiedenen Bearbeitungen zu analysieren und die jeweiligen Einflüsse und Veränderungen zu beleuchten.
- Entwicklung des Tristanstoffs von den keltischen Ursprüngen bis zu den deutschen Versionen.
- Vergleichende Analyse verschiedener Tristan-Bearbeitungen.
- Untersuchung der Einflüsse von Kultur, Religion und Gesellschaft auf die Gestaltung des Stoffes.
- Die Rolle der Liebe und des höfischen Lebens im Tristanstoff.
- Analyse der literarischen und sprachlichen Gestaltung der verschiedenen Versionen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein, erläutert die Fragestellung und die methodische Vorgehensweise. Sie grenzt das Thema zeitlich und räumlich ein und skizziert die verschiedenen Aspekte des Tristanstoffs, die im Laufe der Arbeit detailliert behandelt werden, wie beispielsweise die Minnethematik, höfisches Leben und die religiösen Implikationen.
2. Der erste Tristanroman und seine Ursprünge: Dieses Kapitel befasst sich mit der Suche nach den Ursprüngen des Tristan-Stoffes. Es untersucht verschiedene Theorien, darunter keltische, orientalische und germanische Einflüsse und analysiert mögliche Quellen wie den "Tochmarc Emire" und die Sage von Dhiarmuda und Ghráinne. Es werden die zentralen Elemente der frühesten Versionen des Stoffes herausgearbeitet und ihre Entwicklung im Vergleich zu späteren Bearbeitungen dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich des keltischen "Urtristan", dem "Ältesten Epos" und der "Estoire", unter Berücksichtigung der jeweils relevanten historischen und kulturellen Kontexte.
3. Die deutschen Tristanbearbeitungen: Dieses Kapitel widmet sich den deutschen Bearbeitungen des Tristan-Stoffes, mit Schwerpunkt auf den Werken von Eilhart von Oberg und Gottfried von Straßburg. Es untersucht die Besonderheiten ihrer jeweiligen Versionen, den Einfluss der jeweiligen Entstehungszeit und Kontext sowie die sprachlichen und literarischen Mittel, die sie verwenden. Der Vergleich der Arbeiten Eilharts und Gottfrieds zeigt deutlich die stilistische und inhaltliche Entwicklung des Stoffes im deutschen Sprachraum auf, einschließlich der Arbeiten der Fortsetzer Gottfrieds und weiteren, weniger bekannten Versionen.
Schlüsselwörter
Tristan, Isolde, Tristansage, Minne, höfisches Leben, keltische Literatur, mittelalterliche Literatur, Eilhart von Oberg, Gottfried von Straßburg, deutsche Literatur, Sagenforschung, literarische Analyse, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Tristanstoff
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Geschichte des Tristanstoffs vom frühen Mittelalter bis in die deutsche Spätmittelalterliche Literatur. Sie verfolgt die Entwicklung des Stoffes, analysiert verschiedene Bearbeitungen und beleuchtet die jeweiligen Einflüsse und Veränderungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den deutschen Versionen, einschließlich der Werke von Eilhart von Oberg und Gottfried von Straßburg.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Tristanstoffs von seinen keltischen Ursprüngen bis zu den deutschen Fassungen. Im Mittelpunkt stehen der Vergleich verschiedener Bearbeitungen, die Analyse der Einflüsse von Kultur, Religion und Gesellschaft auf die Gestaltung des Stoffes, die Rolle der Liebe und des höfischen Lebens, sowie die literarische und sprachliche Gestaltung der verschiedenen Versionen.
Welche Quellen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene mögliche Quellen des Tristanstoffs, darunter den keltischen "Urtristan", das "Älteste Epos", die "Estoire", den "Tochmarc Emire", die Sage von Dhiarmuda und Ghráinne sowie verschiedene deutsche Bearbeitungen wie die Werke von Eilhart von Oberg und Gottfried von Straßburg, einschließlich der Arbeiten der Fortsetzer Gottfrieds und weiterer, weniger bekannter Versionen. Auch alternative Entstehungstheorien, wie ein orientalisch oder germanischer Ursprung, werden diskutiert.
Welche Autoren und Werke werden im Detail behandelt?
Die Arbeit analysiert detailliert die Werke von Eilhart von Oberg ("Tristrant") und Gottfried von Straßburg ("Tristan"). Darüber hinaus werden die Fortsetzer Gottfrieds (Ulrich von Türheim und Heinrich von Freiberg) sowie weitere deutschsprachige Bearbeitungen wie "Tristan als Mönch" und das "Niederdeutsche Tristanfragment" und die Prosaromane erwähnt und in den Kontext eingeordnet. Die Arbeit vergleicht die verschiedenen Versionen und zeigt die stilistische und inhaltliche Entwicklung des Stoffes im deutschen Sprachraum auf.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Literaturwissenschaftliche Methode. Sie analysiert die verschiedenen Versionen des Tristanstoffs, vergleicht sie miteinander und untersucht die Entwicklung des Stoffes im Laufe der Zeit. Dabei werden die literarischen, sprachlichen und kulturellen Kontexte berücksichtigt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung des Tristanstoffs nachzuvollziehen, die verschiedenen Bearbeitungen zu analysieren und die jeweiligen Einflüsse und Veränderungen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Darstellung der Entwicklung des Stoffes im deutschen Sprachraum.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter: Tristan, Isolde, Tristansage, Minne, höfisches Leben, keltische Literatur, mittelalterliche Literatur, Eilhart von Oberg, Gottfried von Straßburg, deutsche Literatur, Sagenforschung, literarische Analyse, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Einleitung, Hauptteil und Zusammenfassung gegliedert. Der Hauptteil untersucht zunächst die Ursprünge des Tristanstoffs und analysiert dann die verschiedenen deutschen Bearbeitungen. Die Einleitung führt in das Thema ein, erläutert die Fragestellung und die methodische Vorgehensweise. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
- Quote paper
- Christoph Baldes (Author), 2005, Geschichte des Tristanstoffs von den Anfängen bis zum späteren Mittelalter unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachraums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80788