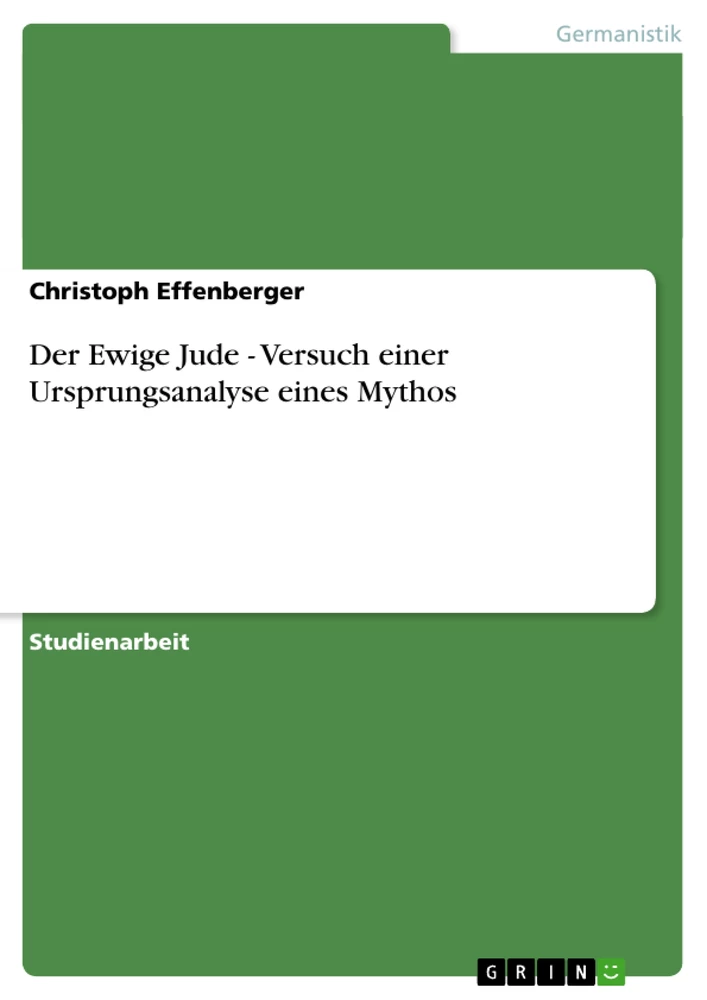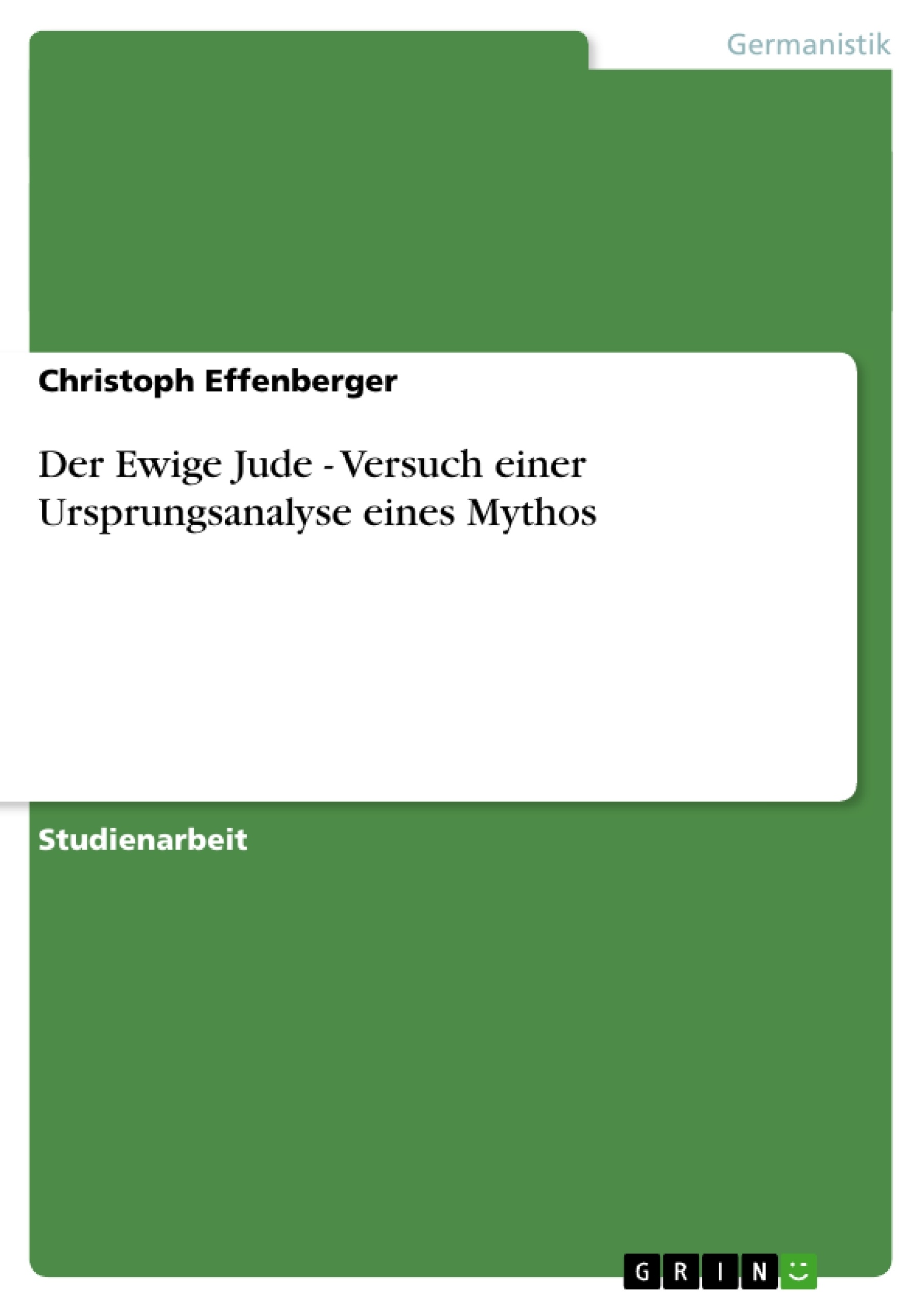Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit einem weiteren Judenstereotyp - neben dem Mörder Jesu, dem Wucherer, Brunnenvergifter und Ritualmörder - dem "Ewigen Juden". Wohl kaum ein Mythos um das Volk der Israeliten hat auf literarischer Ebene eine derart große und unterschiedliche Interpretation und Rezeption gefunden. Ausgangspunkt bzw. Anstoß für eine riesige Anzahl von schriftstellerischer und dichterischer Bearbeitung des Motivs ist das deutsche Volksbuch "Kurze Beschreibung und Erzählung von einem Juden mit Namen Ahasverus" aus dem Jahre 1602. Betrachtet man nun das Ergebnis der unterschiedlichen Interpretationen des Ahasverus-Mythos, so muss ein breites Spektrum sowohl an antijüdischer, als auch judenfreundlicher bzw. liberaler Tendenzen konstatiert werden. Diese Tatsache ist bezeichnend für die scheinbare Seriosität und Unparteilichkeit des Ur-Textes. Nun kann der Mittelpunkt einer Hausarbeit im Fach Mediävistik nicht die Analyse der literarischen Rezeption sein, vielmehr gestaltet es sich als weitaus interessanter, die Umstände der Entstehung und die Ursprünge des Textes zu untersuchen. Diese Analyse soll die scheinbare Nüchternheit, den scheinbar objektiven Berichtcharakter des Textes durchleuchten.
Die Notwendigkeit einer derartigen Untersuchung ergibt sich aus der Tatsache, dass ein tendenzloser Text für den Entstehungszeitraum der Frühen Neuzeit eher untypisch war und allein deswegen einer weiteren Betrachtung bedarf. Daraus ergeben sich für die nachfolgende Arbeit folgende Prämissen: 1. Kann der Berichtcharakter und die daraus folgende Objektivität und Seriosität bestätigt werden? 2.Welche Angaben lassen sich aus den zu gewinnenden Erkenntnissen, auf die Persönlichkeit bzw. auf die Intention des Autors machen? Grundsatz und Ausgangspunkt für die Klärung der gestellten Aufgaben soll die Analyse der Quellen (benannte und nicht benannte!) des Autors sein. Dabei können aber nur die offensichtlichsten berücksichtigt werden, da sonst der Rahmen dieser Arbeit gesprengt werden würde. Auch deshalb gilt es zu beachten, dass der Anspruch auf Vollständigkeit und somit einer absoluten Wahrheit nicht erhoben wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Die „Kurtze beschreibung und Erzehlung von einem Juden, mit Namen Ahasverus“
- 2.1 Fakten zum Volksbuch
- 2.2 Inhalt des Textes
- 2.3 Bewertung der Quellen des Volksbuches
- 2.3.1 Quellenangaben des Autors
- 2.3.1.1 Paulus von Eitzen
- 2.3.1.2 „Mattheiam 16“
- 2.3.2 Quellenerkenntnisse der Forschung
- 2.3.2.1 Der Autor als Kopist
- 2.3.2.2 Der Name „Ahasverus“
- 2.3.2.3 Die Anonymität des Autors
- 2.3.1 Quellenangaben des Autors
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Mythos des Ewigen Juden, insbesondere das deutsche Volksbuch „Kurtze beschreibung und Erzehlung von einem Juden, mit Namen Ahasverus“ aus dem Jahr 1602. Die Zielsetzung liegt in der Analyse der Ursprünge des Textes und der Überprüfung seines scheinbar objektiven Berichtcharakters. Die Arbeit hinterfragt die Quellenangaben des Autors und beleuchtet dessen mögliche Intentionen.
- Analyse der Quellen des Volksbuches „Ahasverus“
- Untersuchung des Berichtcharakters und der Objektivität des Textes
- Ermittlung der Intention des Autors
- Bewertung der Glaubwürdigkeit der Quellenangaben
- Einordnung des Textes in den Kontext der Frühen Neuzeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt den Mythos des Ewigen Juden und seine vielfältige literarische Rezeption vor. Sie betont die scheinbare Objektivität des Volksbuches „Ahasverus“ und formuliert die Forschungsfragen: Kann die Objektivität des Textes bestätigt werden, und welche Rückschlüsse lassen sich auf die Persönlichkeit und Intention des Autors ziehen? Die Analyse der Quellen des Autors bildet den methodischen Ansatz der Arbeit. Der Anspruch auf Vollständigkeit wird jedoch nicht erhoben.
2. Die „Kurtze beschreibung und Erzehlung von einem Juden, mit Namen Ahasverus“: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Volksbuch selbst. Es beschreibt die ersten Drucke im Jahr 1602, die anfängliche Anonymität des Autors und die spätere Nennung von Chrysostomus Dudulaeus Westphalus als Urheber. Die hohe Leserfrequenz wird durch die vielen Drucke des 17. Jahrhunderts belegt. Der Inhalt des Textes wird als Bericht des Schleswiger Bischofs Paulus von Eitzen, wiedergegeben von einem Ich-Erzähler, charakterisiert. Dieser Abschnitt legt den Fokus auf faktische Informationen zum Volksbuch und seinem Inhalt, ohne dessen Interpretation oder die darin vertretenen Perspektiven weiter zu vertiefen.
Schlüsselwörter
Ewiger Jude, Ahasverus-Mythos, Volksbuch, Quellenanalyse, Frühe Neuzeit, Antijudaismus, Objektivität, Autorschaft, Chrysostomus Dudulaeus Westphalus, Paulus von Eitzen.
Häufig gestellte Fragen zu „Kurtze beschreibung und Erzehlung von einem Juden, mit Namen Ahasverus“
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert das deutsche Volksbuch „Kurtze beschreibung und Erzehlung von einem Juden, mit Namen Ahasverus“ (1602) und untersucht den Mythos des Ewigen Juden. Der Fokus liegt auf der Analyse der Quellen des Textes, der Überprüfung seines objektiven Anspruchs und der Ermittlung der Intention des Autors.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Quellenanalyse des Volksbuches „Ahasverus“, Untersuchung des Berichtcharakters und der Objektivität des Textes, Ermittlung der Intention des Autors, Bewertung der Glaubwürdigkeit der Quellenangaben und Einordnung des Textes in den Kontext der Frühen Neuzeit.
Welche Quellen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht die vom Autor des Volksbuches angegebenen Quellen, insbesondere Paulus von Eitzen und die Textstelle „Mattheiam 16“. Zusätzlich werden die Erkenntnisse der Forschung zur Quellenlage berücksichtigt, einschließlich der Frage nach der Autorschaft (Chrysostomus Dudulaeus Westphalus) und der Anonymität des ursprünglichen Textes.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Analyse der Ursprünge des Textes und die Überprüfung seines scheinbar objektiven Berichtcharakters. Es wird untersucht, ob die Objektivität des Textes bestätigt werden kann und welche Rückschlüsse sich auf die Persönlichkeit und Intention des Autors ziehen lassen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur detaillierten Analyse des Volksbuches „Ahasverus“ (inkl. Unterkapiteln zu Fakten, Inhalt und Quellen), und eine Zusammenfassung. Das Kapitel zur Analyse des Volksbuches unterteilt sich in die Untersuchung der Quellenangaben des Autors und der Quellenerkenntnisse der Forschung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ewiger Jude, Ahasverus-Mythos, Volksbuch, Quellenanalyse, Frühe Neuzeit, Antijudaismus, Objektivität, Autorschaft, Chrysostomus Dudulaeus Westphalus, Paulus von Eitzen.
Wer ist der vermeintliche Autor des Volksbuches?
Das Volksbuch wurde anfänglich anonym veröffentlicht. Später wurde Chrysostomus Dudulaeus Westphalus als Urheber genannt.
Welche Rolle spielt Paulus von Eitzen im Volksbuch?
Der Text des Volksbuches wird als Bericht des Schleswiger Bischofs Paulus von Eitzen dargestellt, der von einem Ich-Erzähler wiedergegeben wird.
Wie wird die Objektivität des Volksbuches bewertet?
Die Arbeit hinterfragt den scheinbar objektiven Berichtcharakter des Volksbuches und untersucht kritisch die Quellenangaben und die möglichen Intentionen des Autors.
- Quote paper
- Christoph Effenberger (Author), 2002, Der Ewige Jude - Versuch einer Ursprungsanalyse eines Mythos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8079