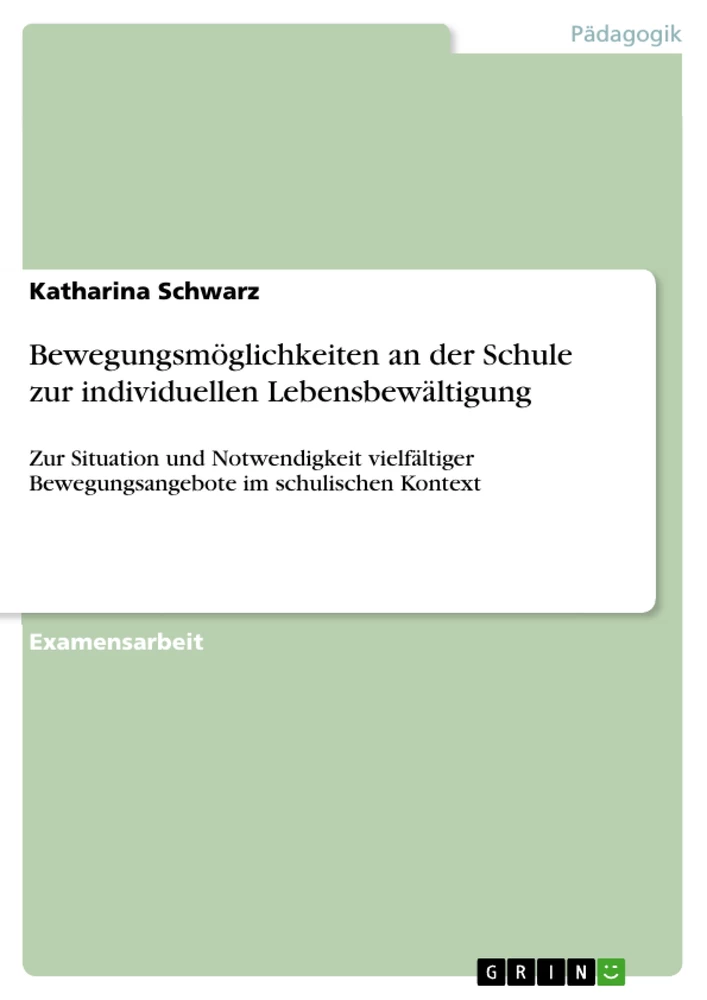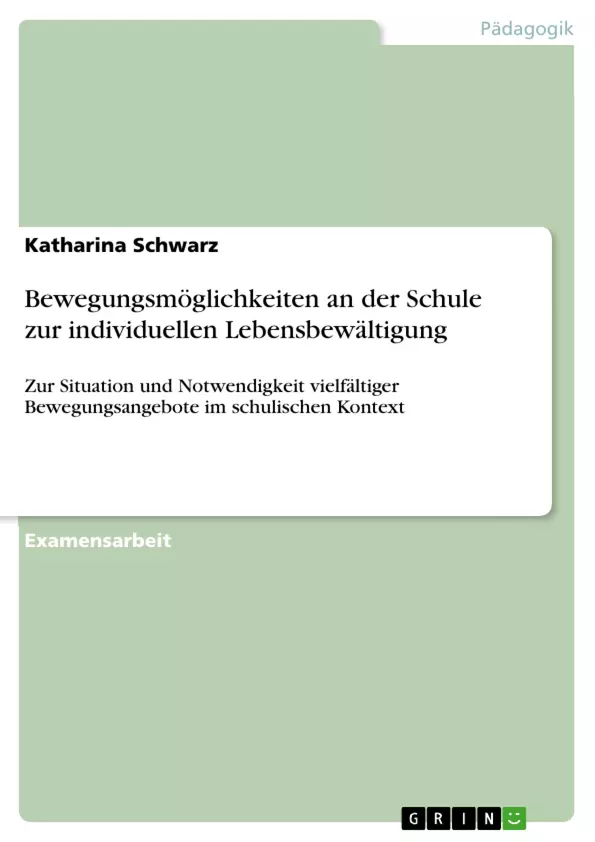Einleitung
Veröffentlichungen zum Thema „Bewegte Schule“ sind gerade in den letzten Jahren sehr zahlreich in Fachbüchern und Fachzeitschriften zu den Themen Motorik, Bewegung, allgemeine Schulpädagogik, Grundschulpädagogik und so weiter erschienen (vgl. Breithecker, 1997, 2001; Müller & Obier, 2001; Hildebrandt-Stramann, 1999, 2001; Landau & Sobczyk, 1996; Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, 2000,2001, 2004). Immer wieder weisen die Autorinnen und Autoren in ihren Beiträgen auf die Bedeutung der Bewegung für die Gesamtentwicklung der Kinder hin und heben die Verantwortung der Institution Schule auch für den Bereich der „Bewegungs-, Spiel- und Sporterziehung der Kinder und Jugendlichen“ hervor (Kultusministerkonferenz [KMK], 2004, S. 3). Dabei geht es eben nicht mehr nur um die reine körperliche und motorische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, sondern wie bereits erwähnt um die Gesamtentwicklung, also in Bezug auf die Institution Schule um eine ganzheitliche Bildung und Erziehung.
Aus dem Wissen um die engen Bezüge zwischen Bewegung und Lernen erwächst die
Forderung, Bewegung – über den strukturellen Rahmen des Schulsportes hinaus – stärker als bisher auch in die allgemeinen Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler und damit in alle Unterrichtsfächer und die Gestaltung des gesamten Schullebens [Hervorhebung v. Verf.] zu integrieren. Für die Vernetzung von motorischem und kognitivem Lernen gibt es z.B. bei den bewegungsorientierten Grundschulen hilfreiche Ansätze, die verstetigt, ausgebaut und auf alle anderen Schulformen übertragen werden müssen. (KMK, 2004, S. 3)
Hildebrandt – Stramann kritisiert 1999: „Für Bewegung gibt es in der Schule zweckbestimmte Räume und Zeiten wie die Sporthalle und den Schulhof bzw. die Sportstunden und die Pausenzeiten.“ (S. 5). Die Aussage der Kultusministerkonferenz zeigt einen eindeutigen Weg - weg von dieser eingegrenzten Betrachtung der Bewegungsmöglichkeiten an den Schulen. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass bisherige Projekte sich überwiegend auf den Bereich der Grundschulen beziehen. Tatsächlich bestätigt dies die Veröffentlichung der KMK vom 11.12.2001 zum Thema „Bewegungsfreundliche Schule“ (Bericht über den Entwicklungsstand in den Ländern). Projekte wie die „Verlässliche Grundschule“ in Baden-Württemberg, die „Bewegte Grundschule“ in Bayern oder die „Bewegte Schule“ in Berlin beziehen sich ausschließlich auf den Bereich der Primarstufe und bestenfalls noch auf die Sekundarstufe I.
In Mecklenburg-Vorpommern wird seit 1999 an mehreren Grundschulen das Projekt „Gesundheitsförderung in neuen Bahnen“ erprobt. Eine „Vernachlässigung“ der weiterführenden Schulen und anderer Schulformen (z.B. der Sonderschulen) ist meines Erachtens ersichtlich, auch wenn es z.B. in Bayern seit dem Schuljahr 2000/2001 ein Projekt „Bewegte Schule“, welches sich an alle weiterführenden Schulen im Land richtet, gibt. Informationen zu einer Umsetzung derartiger Projekte an Schulen für Geistig- behinderte bzw. Schulen zur individuellen Lebensbewältigung habe ich im Rahmen meiner Recherchen nicht gefunden.
Gerade an diesem Punkt soll meine Arbeit ansetzen. Als Studentin der Sonderpädagogik in der Fachrichtung Geistige Behinderung und Sport auf Lehramt richtet sich mein Interesse auf die Schulen zur individuellen Lebensbewältigung in Mecklenburg-Vorpommern und ihre Schüler, die Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Geistige Behinderung
- 2.1 Terminologische Klärung und Definition
- 2.2 Geistige Behinderung aus der Sicht verschiedener Wissenschaftsdisziplinen
- 2.3 Entwicklungsbesonderheiten von Kindern mit einer geistigen Behinderung
- 2.4 Pädagogik bei geistiger Behinderung
- 2.4.1 Historischer Rückblick
- 2.4.2 Die Schule für geistig Behinderte
- 3 Bedeutung der Bewegung für Entwicklung und Lernen
- 3.1 Begriffsklärungen
- 3.2 Bewegung und Entwicklung
- 3.3 Bewegung und Lernen
- 3.3.1 Entwicklungspsychologischer Aspekt
- 3.3.2 Biologisch bzw. neurophysiologischer Aspekt
- 3.4 Die besondere Bedeutung der Bewegung für Kinder mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
- 4 Wandel der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt
- 4.1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- 4.2 Veränderung der Familienstrukturen
- 4.3 Wandel der Erziehungsziele und -normen
- 4.4 Kindliche Lebensräume – Verändertes Zeit- und Raumerleben
- 4.5 Ebene der Freizeitgestaltung und Mediatisierung
- 4.6 Zusammenfassung
- 5 Das pädagogische Konzept der bewegten Schule
- 5.1 Warum mehr Bewegung in der Schule?
- 5.2 Aspekte und Inhalte einer bewegten Schule
- 5.3 Ziele und Effekte
- 5.4 Zusammenfassung
- 6 Bewegungsunterricht und Bewegungsangebote
- 6.1 Curriculare Analyse
- 6.2 Untersuchung
- 6.2.1 Fragestellung und Ziel der Untersuchung
- 6.2.2 Methodisches Vorgehen
- 6.2.3 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- 6.3 Diskussion: Bewegte Schule an der Schule zur individuellen Lebensbewältigung?
- 6.3.1 Schulsport
- 6.3.2 Bewegter Unterricht
- 6.3.3 Bewegte Pause
- 6.3.4 Bewegtes Schulleben und bewegte Freizeit
- 6.3.5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung von Bewegung für Kinder mit geistiger Behinderung im schulischen Kontext. Sie analysiert den Wandel der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt und beleuchtet die Notwendigkeit vielfältiger Bewegungsangebote in der Schule. Die Arbeit untersucht auch die praktische Umsetzung von Bewegungsangeboten im schulischen Alltag.
- Bedeutung von Bewegung für die Entwicklung von Kindern mit geistiger Behinderung
- Wandel der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt und dessen Auswirkungen auf Kinder mit geistiger Behinderung
- Analyse von Bewegungsangeboten im schulischen Kontext
- Pädagogische Konzepte einer "bewegten Schule"
- Zusammenhang zwischen Bewegung und individueller Lebensbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beschreibt die Relevanz von Bewegung für Kinder mit geistiger Behinderung im schulischen Kontext. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und formuliert die Forschungsfrage.
2 Geistige Behinderung: Dieses Kapitel bietet eine terminologische Klärung und Definition von geistiger Behinderung. Es beleuchtet die Sichtweise verschiedener Wissenschaftsdisziplinen und beschreibt die Entwicklung und den historischen Kontext der Pädagogik bei geistiger Behinderung. Es werden spezifische Entwicklungsbesonderheiten von Kindern mit geistiger Behinderung erörtert und die Rolle der Schule für geistig Behinderte im historischen und aktuellen Kontext betrachtet.
3 Bedeutung der Bewegung für Entwicklung und Lernen: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Bewegung für die Entwicklung und das Lernen von Kindern im Allgemeinen und Kindern mit geistiger Behinderung im Besonderen. Es werden sowohl entwicklungspsychologische als auch biologisch-neurophysiologische Aspekte der Bewegung erörtert. Der Abschnitt betont die essentielle Rolle von Bewegung für die ganzheitliche Entwicklung und den Lernerfolg von Kindern mit geistiger Behinderung.
4 Wandel der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt: Dieses Kapitel analysiert den Wandel der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt. Es betrachtet gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Veränderungen in den Familienstrukturen, den Wandel von Erziehungszielen und -normen, veränderte kindliche Lebensräume sowie den Einfluss von Freizeitgestaltung und Mediatisierung auf die Bewegungsmuster von Kindern. Es zeigt auf, wie diese Entwicklungen die Notwendigkeit für gezielte Bewegungsförderung unterstreichen.
5 Das pädagogische Konzept der bewegten Schule: Dieses Kapitel beschreibt das pädagogische Konzept der bewegten Schule und argumentiert für die Notwendigkeit erhöhter Bewegungsangebote in der Schule. Es werden Aspekte und Inhalte einer bewegten Schule erläutert und die Ziele sowie die positiven Effekte für die Entwicklung und das Lernen der Kinder dargestellt.
6 Bewegungsunterricht und Bewegungsangebote: In diesem Kapitel wird eine curriculare Analyse von Bewegungsunterricht und Bewegungsangeboten durchgeführt. Eine empirische Untersuchung mit Fragestellung, Methodik und Ergebnisinterpretation wird vorgestellt, um die Situation an Schulen zu beleuchten. Die Diskussion verknüpft die Ergebnisse mit dem Konzept der bewegten Schule und beleuchtet Schulsport, bewegten Unterricht, bewegte Pausen und ein bewegtes Schulleben. Die verschiedenen Bereiche werden umfassend analysiert und in Bezug zur individuellen Lebensbewältigung der Kinder gesetzt.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Bewegung, Entwicklung, Lernen, Schule, inklusive Pädagogik, Bewegungsangebote, bewegte Schule, Lebensbewältigung, Kindliche Entwicklung, Empirische Untersuchung, Curriculare Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Bewegung und Geistige Behinderung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Bedeutung von Bewegung für Kinder mit geistiger Behinderung im schulischen Kontext. Sie analysiert den Wandel der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt und beleuchtet die Notwendigkeit vielfältiger Bewegungsangebote in der Schule. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung von Bewegungsangeboten im schulischen Alltag und deren Zusammenhang mit der individuellen Lebensbewältigung.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Bedeutung von Bewegung für die Entwicklung von Kindern mit geistiger Behinderung; den Wandel der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt und dessen Auswirkungen auf Kinder mit geistiger Behinderung; die Analyse von Bewegungsangeboten im schulischen Kontext; pädagogische Konzepte einer "bewegten Schule"; und den Zusammenhang zwischen Bewegung und individueller Lebensbewältigung.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Geistige Behinderung (inkl. Definition, historischer Kontext der Pädagogik), Bedeutung der Bewegung für Entwicklung und Lernen (entwicklungspsychologische und biologisch-neurophysiologische Aspekte), Wandel der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt (gesellschaftliche Einflüsse, Familienstrukturen, Erziehungsziele, Mediatisierung), Das pädagogische Konzept der bewegten Schule (Aspekte, Ziele, Effekte) und Bewegungsunterricht und Bewegungsangebote (curriculare Analyse, empirische Untersuchung mit Ergebnisinterpretation und Diskussion).
Welche Methoden werden in der Hausarbeit angewendet?
Die Hausarbeit verwendet eine Kombination aus Literaturrecherche, deskriptiver Analyse und einer empirischen Untersuchung. Die empirische Untersuchung beinhaltet eine klare Fragestellung, ein definiertes methodisches Vorgehen, die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse sowie eine anschließende Diskussion.
Welche Ergebnisse werden in der Hausarbeit präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im Kapitel "Bewegungsunterricht und Bewegungsangebote" präsentiert und interpretiert. Die Interpretation wird im Kontext des pädagogischen Konzepts der "bewegten Schule" diskutiert und in Bezug zur individuellen Lebensbewältigung der Kinder gesetzt. Die konkreten Ergebnisse sind im Detail im Text der Hausarbeit nachzulesen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit kommt zu dem Schluss, dass Bewegung für Kinder mit geistiger Behinderung von essentieller Bedeutung für ihre Entwicklung und Lebensbewältigung ist. Der Wandel der kindlichen Lebens- und Bewegungswelt unterstreicht die Notwendigkeit von gezielten und vielfältigen Bewegungsangeboten im schulischen Kontext. Die "bewegte Schule" wird als ein pädagogisches Konzept vorgestellt, welches diesen Bedürfnissen Rechnung trägt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, Bewegung, Entwicklung, Lernen, Schule, inklusive Pädagogik, Bewegungsangebote, bewegte Schule, Lebensbewältigung, Kindliche Entwicklung, Empirische Untersuchung, Curriculare Analyse.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für Pädagogen, Lehrer, Studenten der Pädagogik und anderer relevanter Studiengänge, sowie für alle, die sich für die inklusive Pädagogik und die Förderung von Kindern mit geistiger Behinderung interessieren. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Bewegung im Kontext der individuellen Lebensbewältigung von Kindern mit geistiger Behinderung.
- Citar trabajo
- Katharina Schwarz (Autor), 2006, Bewegungsmöglichkeiten an der Schule zur individuellen Lebensbewältigung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80837